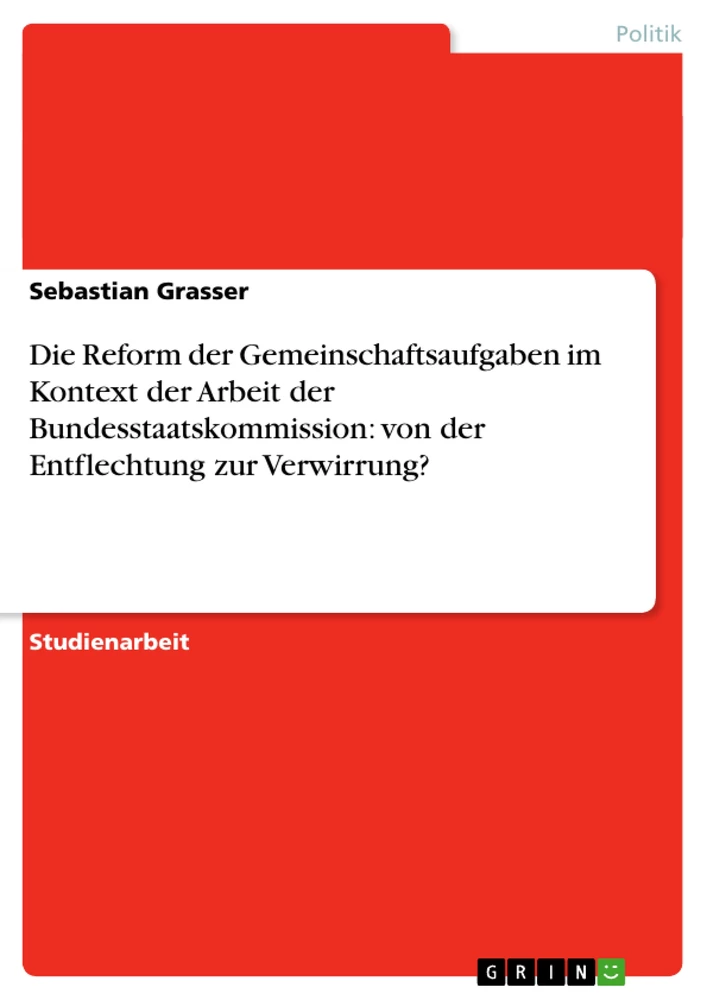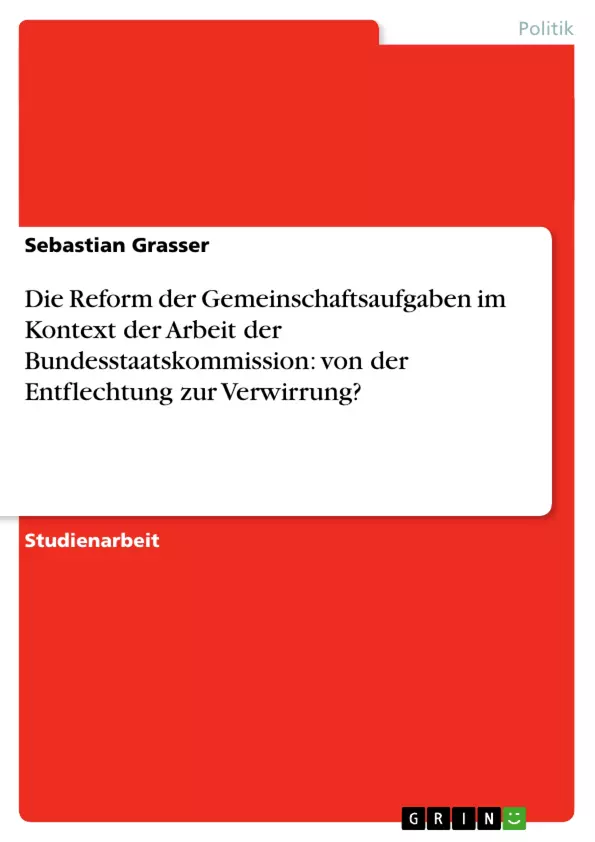"Der deutsche Föderalismus macht - einmalig in der Welt - die Gesetzgebung abhängig von der Zustimmung der Landesregierungen im Bundesrat, während die Länder ihrerseits kaum noch eigene Gesetzgebungskompetenzen haben und auch für ihre Einnahmen völlig von Bundesgesetzen abhängig sind."
Scharpf, Fritz (2002)
Fritz Scharpf hat seine Kritik am deutschen Föderalismus mit einem sehr scharfen Unterton belegt. Er nennt drei Hauptschwächen des deutschen Föderalismus: die Möglichkeit parteipolitischer Blockaden, die generelle Schwerfälligkeit und Intransparenz bundespolitischer Entscheidungsprozesse und die eingeschränkten Handlungsspielräume der Landespolitik (vgl. Margedant 2003: S. 10). Dies bilanzierend erscheint eine Reform des bundesdeutschen Föderalismus als dringend notwendig.
Heute sind weder kooperativer, Mitwirkungs- oder Beteiligungsföderalismus die dominierenden Schlagwörter, sondern es regieren die Begriffe des Gestaltungs- und Wettbewerbsföderalismus die Reformdebatten der Politik und Wissenschaft. Seit fast einem Jahrzehnt schon versuchen Politiker und Wissenschaftler mit verschiedensten Ansätzen und unterschiedlichsten communities die als so dringend erachtete Reform des deutschen Föderalismus voranzubringen. Der große Wurf sollte mit der von Bundestag und Bundesrat eingesetzten Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung (KOMBO) gelingen, der neben Mitgliedern aus den beiden deutschen gesetzgebenden Bundesorganen auch beratende Experten aus der Wissenschaft angehörten, welche vielfältige und verheißungsvolle Alternativvorschläge ausgearbeitet hatten (vgl. Deutscher Bundestag 2003: S. 1).
Die konstituierende Sitzung der KOMBO fand am 7. November 2003 im Bundesrat statt. Als Zielsetzung hatte die Kommission vornehmlich die Entflechtung des deutschen föderalen Systems, die sich durch die Reform von insgesamt drei Hauptschwerpunkten ergeben sollte. Darunter zählen neben der Überprüfung der „Zuordnung von Gesetzgebungszuständigkeiten auf Bund und Länder“ auch die Überprüfung der „Zuständigkeiten und Mitwirkungsrechte der Länder in der Bundesgesetzgebung“ und schließlich die „Finanzbeziehungen (insbesondere Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzierungen) zwischen Bund und Ländern“ (vgl. Deutscher Bundestag 2003: S. 1).
Inhaltsverzeichnis
- EINE KOMMISSION ZUr EntflechtUNG DES DEUTSCHEN FÖDERALISMUS..
- DIE GEMEINSCHAFTSAUFGABEN NACH ARTIKEL 91 GG..
- Bundesgesetze zur Regelung der Gemeinschaftsaufgaben….
- Darstellung des Artikels 91 GG......
- Weitere Möglichkeiten der Mischfinanzierung....
- Politikverflechtung durch die Gemeinschaftsaufgaben……...
- Schwachstellen und Probleme durch die Gemeinschaftsaufgaben...
- Internalisierung der Spill-over-Effekte......
- WISSENSCHAFTLICHE VORSCHLÄGE ZUR POLITIKENTFLECHTUNG DURCH REFORM DER
GEMEINSCHAFTSAUFGABEN..
- Geschichtliche Darstellung bisheriger Reformversuche...
- Bertelsmann-Stiftung......
- Stiftung Marktwirtschaft….
- Konrad-Adenauer-Stiftung..\li>
- Gemeinschaftsausschuss der dt. gewerblichen Wirtschaft..\li>
- Finanzierungsvorschläge aus der Politik.....
- de Maizieres indikatorbasierte Mittelverteilung und weitere
- Bewertung der wissenschaftlichen Vorschläge.......
- DIE ARBEIT DER KOMBO BEZÜGLICH DER REFORM DER GEMEINSCHAFTSAUFGABEN....
- Gründung und Zusammensetzung der KOMBO...
- Ausgangslage: von Verflechtung zur Entflechtung..\li>
- Ausgangsposition des Bundes und der Länder....
- Die Positionspapiere von Bund und Länder….....
- Positionspapier des Bundes vom April 2003....
- Positionspapier der Länder vom Mai 2004...
- Vorschlag der Vorsitzenden der KOMBO zu den Gemeinschaftsaufgaben und den Mischfinanzierungen....
- DER GROBE WURF ODER DOCH KEIN WEG AUS DER SACKGASSE?..\li>
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Reform der Gemeinschaftsaufgaben im Kontext der Arbeit der Bundesstaatskommission (KOMBO). Sie analysiert die Bedeutung der Gemeinschaftsaufgaben für die Politikverflechtung im deutschen Föderalismus und untersucht verschiedene Reformvorschläge aus Wissenschaft und Politik.
- Die Entflechtung des deutschen Föderalismus als Zielsetzung der KOMBO
- Die Bedeutung der Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzierungen als Quelle der Politikverflechtung
- Reformansätze aus Wissenschaft und Politik zur Entflechtung
- Die Positionen und Vorschläge der KOMBO zur Reform der Gemeinschaftsaufgaben
- Eine kritische Bewertung der Erfolgsaussichten der vorgeschlagenen Reformen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den deutschen Föderalismus und dessen Reformbedarf, wobei die Arbeit der KOMBO als ein bedeutender Versuch zur Entflechtung des Systems hervorgehoben wird.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91 GG, beschreibt deren Funktionsweise und zeigt die Probleme und Schwachstellen dieses Finanzierungsmodells auf.
Das dritte Kapitel präsentiert wissenschaftliche Reformvorschläge zur Entflechtung durch die Reform der Gemeinschaftsaufgaben. Es zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der einzelnen Ansätze auf und bewertet ihre Tragfähigkeit.
Das vierte Kapitel analysiert die Arbeit der KOMBO, insbesondere die Positionspapiere von Bund und Ländern sowie den finalen Vorschlag der KOMBO zu den Gemeinschaftsaufgaben.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob der KOMBO-Vorschlag der "große Wurf" zur Entflechtung ist oder ob er zu weiterer Verflechtung führt. Es analysiert die Gründe für den Kompromiss und das Scheitern der KOMBO.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bundesstaatsreform, Gemeinschaftsaufgaben, Mischfinanzierungen, Politikverflechtung, Entflechtung, KOMBO, Reformvorschläge, wissenschaftliche Ansätze, politische Vorschläge.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der Bundesstaatskommission (KOMBO)?
Das Hauptziel war die Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung und die Entflechtung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern.
Was sind Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91 GG?
Dabei handelt es sich um Aufgaben, die die Länder eigentlich allein wahrnehmen, bei denen der Bund aber aufgrund ihrer Bedeutung für die Gesamtheit mitwirkt und mitfinanziert.
Warum wird der deutsche Föderalismus als "schwerfällig" kritisiert?
Kritiker wie Fritz Scharpf bemängeln die hohe Politikverflechtung, die zu Intransparenz, Blockademöglichkeiten im Bundesrat und langen Entscheidungsprozessen führt.
Was bedeutet "Entflechtung" in diesem Kontext?
Entflechtung zielt darauf ab, klare Verantwortlichkeiten zu schaffen, indem Mischfinanzierungen abgebaut und Gesetzgebungskompetenzen eindeutiger zugeordnet werden.
Welche Rolle spielten Stiftungen bei der Reformdebatte?
Organisationen wie die Bertelsmann-Stiftung oder die Konrad-Adenauer-Stiftung lieferten wissenschaftliche Konzepte und Alternativvorschläge zur Politikentflechtung.
Ist die Reform durch die KOMBO gelungen?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob die Vorschläge tatsächlich zu einer Entflechtung führten oder ob der Kompromiss eher zu neuer "Verwirrung" und Verflechtung beitrug.
- Citar trabajo
- Sebastian Grasser (Autor), 2005, Die Reform der Gemeinschaftsaufgaben im Kontext der Arbeit der Bundesstaatskommission: von der Entflechtung zur Verwirrung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41704