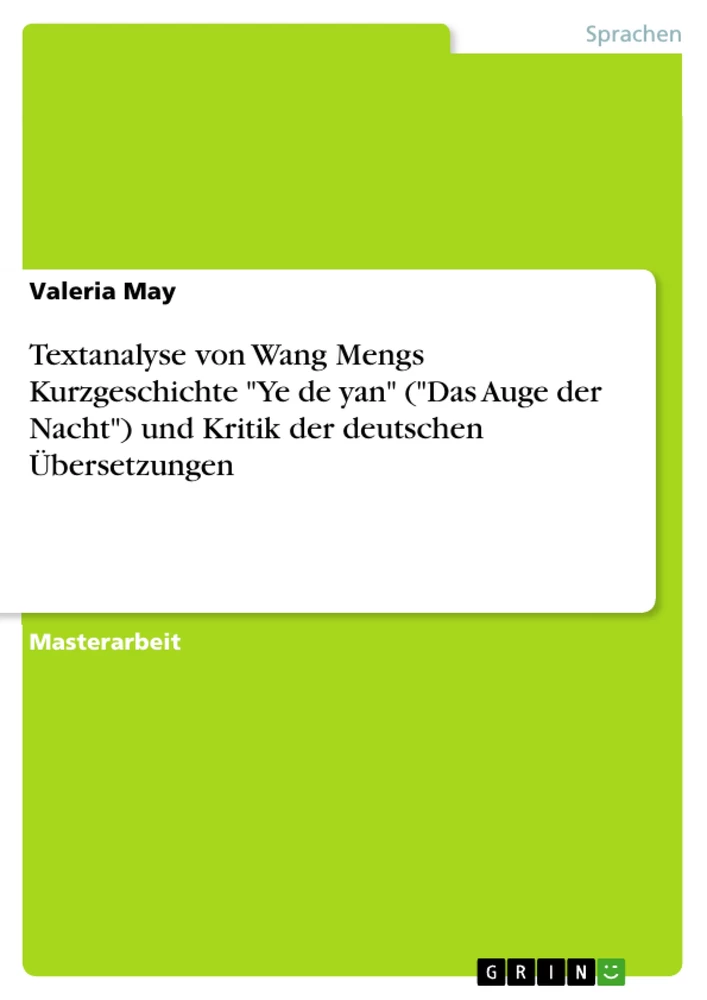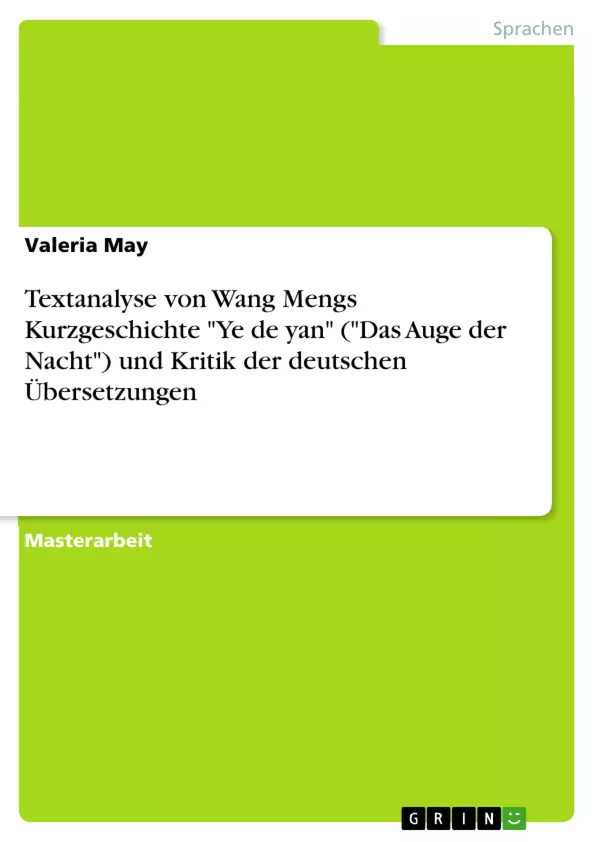Wer ist nicht schon über eine Übersetzung gestolpert, die nicht überzeugen konnte. Am Beispiel einer chinesischen Kurzgeschichte zeigt der Beitrag auf, dass dies elementar mit spezifischen Erzählstrukturen zusammenhängt, insbesondere mit ganzheitlichen textuellen Makrostrukturen. Ganz besonders deutlich wird dies bei einer Kurzgeschichte, die selbst ein Textschema nachzeichnet, das sich in Europa entwickelt hat, nämlich den Stream-of-consciousness. Wang Meng bedient sich somit eines Textschemas aus der westlichen Kultur. Vor dem Hintergrund der Textvorstellungen in der deutschen Kultur wird das Textschema durch die deutschen Übersetzer aber wieder als etwas Fremdes wahrgenommen, das verändert werden und der deutschen Kultur angepasst werden muss. Dies Obwohl der Stream of consciousness mit seiner literarischen Äußerungsform, zwar oft nicht leicht verständlich und gewöhnungsbedürftig ist, aber in Europa als bekannte stilistische Konvention angesehen werden kann und weitgehend akzeptiert ist. Daraus lässt sich ableiten, dass einerseits Makrostrukturen eines fremdsprachlichen Textes, zum Beispiel auch typische Wesenszüge bestimmter Textsorten, stärker wahrgenommen werden müssen, andererseits ist bei einem interkulturellen Perspektivenwechsel, insbesondere in Bezug auf kulturelle Äußerungen in China, die sich selbst auf Europa beziehen, im Zusammenhang mit Verfremdungsabsichten erhöhte Vorsicht geboten.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Inhalt und Form des Werkes „Ye de yan“
- 1.1. Entstehung und Wirkung der Kurzgeschichte
- 1.2. Thematik der Kurzgeschichte
- 1.3. Der „Stream of consciousness“ aus chinesischer Perspektive und die Intention des Autors Wang Meng
- 1.4. Zur Erzählsituation in modernistischen Werken
- 2. Erzähltechnische Perspektive in dem Werk „Ye de yan“
- 2.1. Erzählergeprägte Figurenrede zur Gestaltung des Innenlebens
- 2.2. Interferenz zwischen Erzählerstimme und Figurenstimme
- 2.2.1. Zu den Redeformen
- 2.2.2. Die Modellierung der gedanklichen Reflexionen der Figur
- 2.3. Die Simulation von unmittelbaren Reflexen der Figurenseele
- 2.4. Weitere Elemente des Entwurfs der Perspektivfigur
- 2.4.1. Außensicht - Innensicht
- 2.4.2. Das Blickfeld
- 2.4.3. Die Situierung der Figur
- 3. Zur Methodik der Übersetzungskritik
- 3.1. Zum Begriff „Übersetzen“
- 3.2. Aufgaben der Übersetzungskritik
- 3.3. Entscheidungsfindung des Übersetzers
- 3.4. Zu sinologischen Übersetzungskritiken
- 4. Bedingtheiten der Translationshandlung
- 4.1. Das funktionelle Verhältnis von Ausgangs- und Zieltext
- 4.2. Situationsfaktoren der Übersetzungen
- 4.2.1. Inhalt und sozio-kulturelle Faktoren
- 4.2.2. Medium und Textumfeld
- 4.3. Methodische Hinweise der Übersetzer
- 5. Die Übersetzungen von Wang Mengs Werk „Ye de yan“ („Das Auge der Nacht“)
- 5.1. Die Stellung des Gedankenberichts
- 5.2. Erlebte Rede bei Herrmann
- 5.3. Elemente des Stream-of-consciousness
- 5.3.1. Modifikation aneinandergereihter Wahrnehmungsnotate
- 5.3.2. Lautmalerei als Mittel des Stream-of-consciousness
- 5.4. Weitere perspektivische Strukturen
- 5.4.1. Außensicht und Innensicht
- 5.4.2. Das Blickfeld der Figur
- 5.4.3. Situierung der Figur
- 6. Beurteilung anhand eines Zieltextprofils
- 6.1. Implikationen des Ausgangstextes
- 6.2. Vermutungen über die Strategien der Übersetzerin
- 6.3. Psychologisierender Stil und Übersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übersetzung der Kurzgeschichte „Ye de yan“ (Das Auge der Nacht) von Wang Meng ins Deutsche. Ziel ist es, die Übertragung erzähltechnischer Elemente, insbesondere des „Stream of consciousness“, zu analysieren und die Qualität der existierenden Übersetzungen zu bewerten. Dabei wird auch die Methodik der Übersetzungskritik reflektiert.
- Analyse des „Stream of consciousness“ in Wang Mengs Kurzgeschichte
- Untersuchung der Erzählperspektive und -techniken im Originaltext
- Bewertung der deutschen Übersetzungen im Hinblick auf die Wiedergabe der erzählerischen Mittel
- Diskussion der Methodik der Übersetzungskritik
- Beurteilung der Einflussfaktoren auf den Übersetzungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anlass der Arbeit: die unterschiedliche Bewertung der Qualität moderner chinesischer Literatur in der deutschen Rezeption und die mögliche Rolle von Übersetzungsproblemen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Übertragung erzähltechnischer Elemente in den deutschen Übersetzungen von Wang Mengs „Ye de yan“ zu untersuchen und die Methodologie der Übersetzungskritik zu diskutieren.
1. Inhalt und Form des Werkes „Ye de yan“: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung, Wirkung und Thematik von Wang Mengs Kurzgeschichte. Es beleuchtet die chinesische Perspektive auf den „Stream of consciousness“ und die Intention des Autors, sowie die generelle Erzählsituation in modernistischen Werken. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Werkes im kulturellen Kontext seiner Entstehung und seiner literarischen Besonderheiten.
2. Erzähltechnische Perspektive in dem Werk „Ye de yan“: Hier wird die Erzähltechnik der Kurzgeschichte im Detail untersucht. Der Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung des Innenlebens der Figur durch erzählergeprägte Figurenrede und der Interferenz zwischen Erzähler- und Figurenstimme. Es werden verschiedene Techniken zur Simulation von unmittelbaren Reflexen der Figurenseele und weitere Elemente des Entwurfs der Perspektivfigur, wie Außensicht, Innensicht, Blickfeld und Situierung der Figur analysiert. Das Kapitel demonstriert die Komplexität der Erzählstruktur.
3. Zur Methodik der Übersetzungskritik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Theorie und Methodik der Übersetzungskritik. Es klärt den Begriff „Übersetzen“, definiert die Aufgaben der Übersetzungskritik und analysiert den Entscheidungsprozess des Übersetzers. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kritik sinologischer Übersetzungen, um die objektive Bewertung zu ermöglichen und die Nachvollziehbarkeit übersetzerischer Entscheidungen zu gewährleisten.
4. Bedingtheiten der Translationshandlung: Hier werden die Kommunikationsbedingungen und textexternen Faktoren des Übersetzungsprozesses untersucht. Die Analyse beinhaltet das funktionelle Verhältnis zwischen Ausgangs- und Zieltext, Situationsfaktoren wie Medium, Zeit, Ort und Zielrezipient, sowie methodische Hinweise der Übersetzer. Das Kapitel betont den Einfluss des Kontextes auf die Übersetzung.
5. Die Übersetzungen von Wang Mengs Werk „Ye de yan“ („Das Auge der Nacht“): Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen deutschen Übersetzungen von „Ye de yan“, mit Fokus auf die Darstellung des Gedankenberichts, die erlebte Rede, die Elemente des Stream-of-consciousness und weitere perspektivische Strukturen wie Außensicht, Innensicht, Blickfeld und Situierung der Figur. Der Vergleich der Übersetzungen soll deren Stärken und Schwächen aufzeigen.
Schlüsselwörter
Stream of consciousness, Wang Meng, Ye de yan, chinesische Literatur, deutsche Übersetzung, Übersetzungskritik, Erzählperspektive, Erzähltechnik, interkultureller Transfer, Literaturübersetzung.
Häufig gestellte Fragen zu „Ye de yan“ (Das Auge der Nacht) von Wang Meng
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die deutschen Übersetzungen der Kurzgeschichte „Ye de yan“ (Das Auge der Nacht) von Wang Meng. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Übertragung erzähltechnischer Elemente, insbesondere des „Stream of consciousness“, und der Bewertung der Übersetzungsqualität. Die Methodik der Übersetzungskritik wird ebenfalls reflektiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse des „Stream of consciousness“ in Wang Mengs Kurzgeschichte; Untersuchung der Erzählperspektive und -techniken im Originaltext; Bewertung der deutschen Übersetzungen hinsichtlich der Wiedergabe erzählerischer Mittel; Diskussion der Methodik der Übersetzungskritik; Beurteilung der Einflussfaktoren auf den Übersetzungsprozess.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Analyse von Inhalt und Form von „Ye de yan“, Untersuchung der erzähltechnischen Perspektive, Methodik der Übersetzungskritik, Bedingtheiten der Translationshandlung und Analyse der deutschen Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext. Jedes Kapitel konzentriert sich auf einen Aspekt der Übersetzung und deren Bewertung.
Was wird im Kapitel zur Erzählperspektive analysiert?
Das Kapitel zur Erzählperspektive analysiert detailliert die Erzähltechnik von „Ye de yan“. Es konzentriert sich auf die Gestaltung des Innenlebens der Figur durch erzählergeprägte Figurenrede, die Interferenz zwischen Erzähler- und Figurenstimme, Techniken zur Simulation unmittelbarer Reflexe der Figurenseele und weitere Elemente des Entwurfs der Perspektivfigur (Außensicht, Innensicht, Blickfeld, Situierung der Figur).
Wie wird die Methodik der Übersetzungskritik behandelt?
Das Kapitel zur Methodik der Übersetzungskritik beleuchtet die Theorie und Methode der Übersetzungskritik. Es klärt den Begriff „Übersetzen“, definiert die Aufgaben der Übersetzungskritik und analysiert den Entscheidungsprozess des Übersetzers. Ein besonderer Fokus liegt auf der Kritik sinologischer Übersetzungen.
Welche Faktoren beeinflussen den Übersetzungsprozess laut der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kommunikationsbedingungen und textexternen Faktoren des Übersetzungsprozesses. Dies beinhaltet das funktionelle Verhältnis zwischen Ausgangs- und Zieltext, Situationsfaktoren wie Medium, Zeit, Ort und Zielrezipient sowie methodische Hinweise der Übersetzer. Der Einfluss des Kontextes auf die Übersetzung wird hervorgehoben.
Wie werden die Übersetzungen von „Ye de yan“ analysiert?
Die Analyse der deutschen Übersetzungen von „Ye de yan“ konzentriert sich auf die Darstellung des Gedankenberichts, die erlebte Rede, die Elemente des Stream-of-consciousness und weitere perspektivische Strukturen (Außensicht, Innensicht, Blickfeld, Situierung der Figur). Ein Vergleich der Übersetzungen soll deren Stärken und Schwächen aufzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Stream of consciousness, Wang Meng, Ye de yan, chinesische Literatur, deutsche Übersetzung, Übersetzungskritik, Erzählperspektive, Erzähltechnik, interkultureller Transfer, Literaturübersetzung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Übertragung erzähltechnischer Elemente, insbesondere des „Stream of consciousness“, in den deutschen Übersetzungen von Wang Mengs „Ye de yan“ und die Bewertung der Qualität dieser Übersetzungen. Die Reflexion der Methodik der Übersetzungskritik ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
- Citation du texte
- Valeria May (Auteur), 2006, Textanalyse von Wang Mengs Kurzgeschichte "Ye de yan" ("Das Auge der Nacht") und Kritik der deutschen Übersetzungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417241