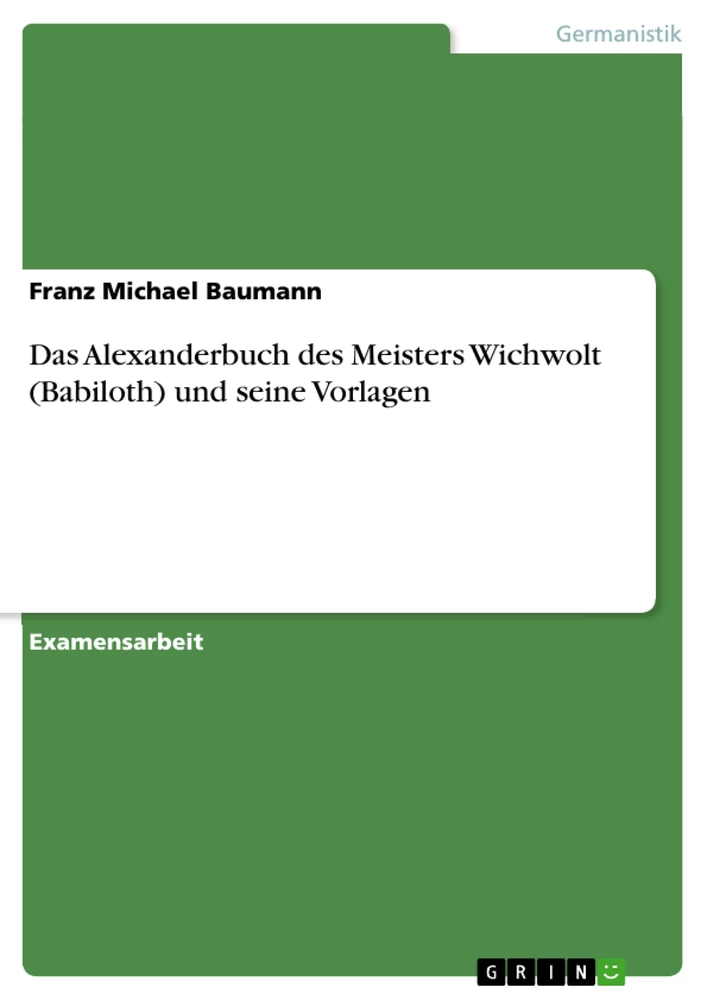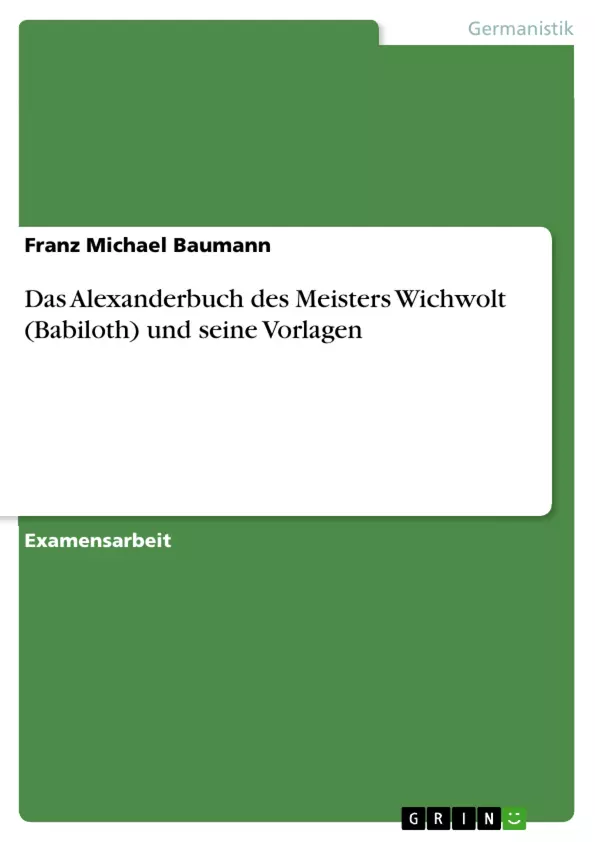Diese Arbeit untersucht, auf welchen Vorlagen das Alexanderbuch des Meisters Wichwolt (Babiloth) beruht, welche Sondersituation beim Lübecker Druck vorliegt und was dies aus rezeptionsästhetischer Sicht über die Bedürfnisse der Gesellschaft des 15. Jahrhunderts aussagt. Wichwolts Alexanderbuch wird untersucht. Es wird außerdem versucht Erkenntnisse zu gewinnen, die es ermöglichen, die literarischen Erwartungshaltungen des 15. Jahrhunderts durch die Analyse eines Einzelwerkes, also eines Teilaspektes, klarer festzustellen. Die Wünsche und Hoffnungen der damals lebenden Menschen bezüglich der Bewältigung ihrer Probleme und ihre Lösungswege werden betrachtet.
Der Forschungsstand zu Wichwolts Alexanderbuch ist zum Zeitpunkt dieser Ausarbeitung sehr lückenhaft. Der größte Teil der Untersuchungen zu Wichwolts Alexanderbuch stammt aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Verhältnis der verschiedenen Handschriften zueinander. Nicht einmal das Verhältnis des Textes zu seinen Vorlagen ist hinreichend untersucht, obwohl dies doch Voraussetzung für jede inhaltliche Beurteilung ist. Der einzige Forschungsbeitrag der letzten dreißig Jahre beschäftigt sich ausschließlich mit der Verfasserfrage und der Einordnung einer weiteren Handschrift. Inhaltliche Untersuchungen zu Wichwolts Alexanderbuch liegen bisher also nicht vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Forschungssituation
- Die Handschriften von WICHWOLTS Alexanderbuch, deren Sprache und die des Originals
- Stemma
- Das Verhältnis zu den Vorlagen
- Die Frage des Autors (,WICHWOLT“ oder „BABILOTH‘?)
- Das Verhältnis des Textes zu den Vorlagen
- Das Verhältnis zu J2 und J3
- Die,,lere\" des Aristoteles und ihre Vorlagen
- Das Verhältnis der „,lere“ zur Alexandreis WALTERS VON CHÂTILLON und zum Secretum Secretorum
- Zur Auswahl der Vergleichstexte
- Das Verhältnis der „lere“ zu ihren beiden Vorlagen
- Das Verhältnis zur Collatio Alexandri Magni cum Dindimo
- Inhaltliche Aspekte des Verhältnisses zu den Vorlagen
- Die Aussage des von WICHWOLT wiedergegebenen Textes von J2 und J3
- Die Figurenkonstellation
- Die,Ritter“ und Untertanen
- Die Fürsten
- Das Frauenbild
- Beschreibung der Volksführer und -führerinnen (Könige, Königinnen, Priester Jerusalems, etc.)
- Die durch das Figurenhandeln verdeutlichte Philosophie
- Die eigentliche Chronik
- Der Mardocheusbrief
- Der Briefwechsel zwischen Alexander und Dindimus
- Der äußere Ablauf der Erzählung
- Die Vorgeschichte des Lebens Alexanders und seine Jugend
- Seine Kriegszüge
- Die Erzählung über die Wunder Indiens
- Alexanders Tod
- Die Figurenkonstellation
- Die Veränderung der Aussage durch die Mischung von Rezension J2 und J…………………….
- Die Veränderung der Aussage durch die Übernahme der abweichenden Version der Collatio Alexandri Magni cum Dindimo
- Die Veränderung durch die Aristoteleslehre
- Die inhaltliche Tendenz der Übersetzung WALTERS
- Die inhaltliche Tendenz im Secretum Secretorum
- Die Aristoteleslehre im Zusammenhang der Historia de preliis.….……………………..\n
- Die Aussage des von WICHWOLT wiedergegebenen Textes von J2 und J3
- Die Charakteristika von WICHWOLTS Text in der literarischen Tradition
- Die mittelalterliche deutsche Alexanderliteratur vor WICHWOLT
- Das Alexanderlied des Pfaffen LAMPRECHT und seine Bearbeitungen
- Der Alexander RUDOLFS VON EMS
- Der Alexander ULRICHS VON ESCHENBACH
- SEIFRITS Alexander und der Wernigeroder Alexander
- Gesellschaftliche und literarische Tendenzen zur Zeit Wichwolts
- Das Werk WICHWOLTS in seinem historisch-literarischen Zusammenhang
- Die mittelalterliche deutsche Alexanderliteratur vor WICHWOLT
- Die Kölner Handschrift als Bearbeitung des Werkes WICHWOLTS
- Der Lübecker Druck
- Das Rezeptionsangebot Wichwolts für das Lübecker Lesepublikum um 1478
- Das Lesepublikum - die Ausstattung des Drucks
- Die Situation in Lübeck um 1478
- Das Rezeptionsangebot WICHWOLTS
- Inhaltliche Aspekte der abweichenden Textgestalt gegenüber WICHWOLT
- Die Kürzungen und geringfügigen Erweiterungen gegenüber WICHWOLT
- Die Einfügungen aus JOHANN HARTLIEBS Alexander
- Exkurs: JOHANN HARTLIEBS Alexander
- Das Rezeptionsangebot HARTLIEBS für das Lübecker Lesepublikum um 1478
- Die Einfügungen aus HARTLIEBS Alexander in den Text WichwolTS
- Zusammenfassung
- Die eingeschobene „lere“
- Die Bearbeitungstendenz des Lübecker Drucks im Zusammenhang mit seiner Vorlage
- Das Rezeptionsangebot Wichwolts für das Lübecker Lesepublikum um 1478
- Schlussbemerkung – Forschungsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Alexanderbuch des Meisters Wichwolt (Babiloth) und untersucht dessen Verhältnis zu seinen Vorlagen. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte des Werkes zu rekonstruieren und die literarischen und historischen Einflüsse auf Wichwolts Werk aufzuzeigen.
- Die verschiedenen Handschriften des Alexanderbuches und ihre Entstehungsgeschichte
- Das Verhältnis des Textes zu seinen Vorlagen, insbesondere zu den Werken Walters von Châtillon und des Secretum Secretorum
- Die Bedeutung der Aristoteleslehre in Wichwolts Werk
- Die Einordnung des Alexanderbuches in die mittelalterliche deutsche Alexanderliteratur
- Die Rezeption des Alexanderbuches in der frühen Druckzeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Arbeit und stellt die Forschungsfrage dar. Sie erläutert den historischen und literarischen Hintergrund des Alexanderbuches und zeigt die Relevanz des Themas auf.
- Die Forschungssituation: Dieses Kapitel beleuchtet die Forschung zum Alexanderbuch des Meisters Wichwolt. Es analysiert die verschiedenen Handschriften, das Verhältnis zu den Vorlagen und stellt die Frage nach dem Autor des Werkes.
- Das Verhältnis des Textes zu den Vorlagen: Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis des Alexanderbuches zu den wichtigsten Vorlagen, insbesondere der Alexandreis Walters von Châtillon, dem Secretum Secretorum und der Collatio Alexandri Magni cum Dindimo. Es untersucht die Übernahme und Veränderung von Motiven und Inhalten aus den Vorlagen.
- Inhaltliche Aspekte des Verhältnisses zu den Vorlagen: Dieses Kapitel betrachtet die inhaltlichen Besonderheiten des Alexanderbuches und analysiert, wie sich die Übernahme von Inhalten aus den Vorlagen auf die Aussage des Textes auswirkt. Es untersucht die Figurenkonstellation, die Philosophie und den äußeren Ablauf der Erzählung.
- Die Charakteristika von WICHWOLTS Text in der literarischen Tradition: Dieses Kapitel setzt das Alexanderbuch in den Kontext der mittelalterlichen deutschen Alexanderliteratur und untersucht seine Besonderheiten im Vergleich zu anderen Werken dieser Gattung. Es analysiert die Entwicklung des Alexanderromans im Mittelalter und die spezifischen Merkmale des Alexanderbuches Wichwolts.
- Die Kölner Handschrift als Bearbeitung des Werkes WICHWOLTS: Dieses Kapitel befasst sich mit einer speziellen Bearbeitung des Alexanderbuches in einer Kölner Handschrift und untersucht ihre Besonderheiten und ihren Entstehungszusammenhang.
- Der Lübecker Druck: Dieses Kapitel behandelt den ersten Druck des Alexanderbuches in Lübeck im Jahr 1478. Es analysiert das Rezeptionsangebot des Werkes für das Lübecker Publikum und untersucht die Veränderungen, die der Drucktext im Vergleich zur Vorlage aufweist.
Schlüsselwörter
Alexanderroman, Mittelalter, deutsche Literatur, Handschriften, Vorlagen, Walters von Châtillon, Secretum Secretorum, Collatio Alexandri Magni cum Dindimo, Aristoteleslehre, Rezeption, Druck, Lübeck, Wichwolt, Babiloth.
Häufig gestellte Fragen
Auf welchen Vorlagen basiert das Alexanderbuch von Meister Wichwolt?
Es basiert unter anderem auf der "Alexandreis" von Walter von Châtillon, dem "Secretum Secretorum" und der "Collatio Alexandri Magni cum Dindimo".
Was ist das Besondere am Lübecker Druck von 1478?
Der Druck weist eine abweichende Textgestalt auf, die Kürzungen sowie Einfügungen aus Johann Hartliebs Alexanderroman enthält.
Welche Rolle spielt die "Aristoteleslehre" im Werk?
Sie dient als pädagogisches Element, das moralische Anweisungen für Fürsten und die Führung von Untertanen innerhalb der Erzählung vermittelt.
Wichwolt oder Babiloth – wer war der eigentliche Autor?
Die Arbeit untersucht die lückenhafte Forschungssituation zur Verfasserfrage und die Zuordnung des Werkes zu diesen Namen.
Was sagt das Werk über die Gesellschaft des 15. Jahrhunderts aus?
Durch die Analyse der literarischen Erwartungshaltungen werden Rückschlüsse auf die Wünsche und Probleme der Menschen jener Zeit gezogen.
- Quote paper
- Franz Michael Baumann (Author), 1989, Das Alexanderbuch des Meisters Wichwolt (Babiloth) und seine Vorlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417278