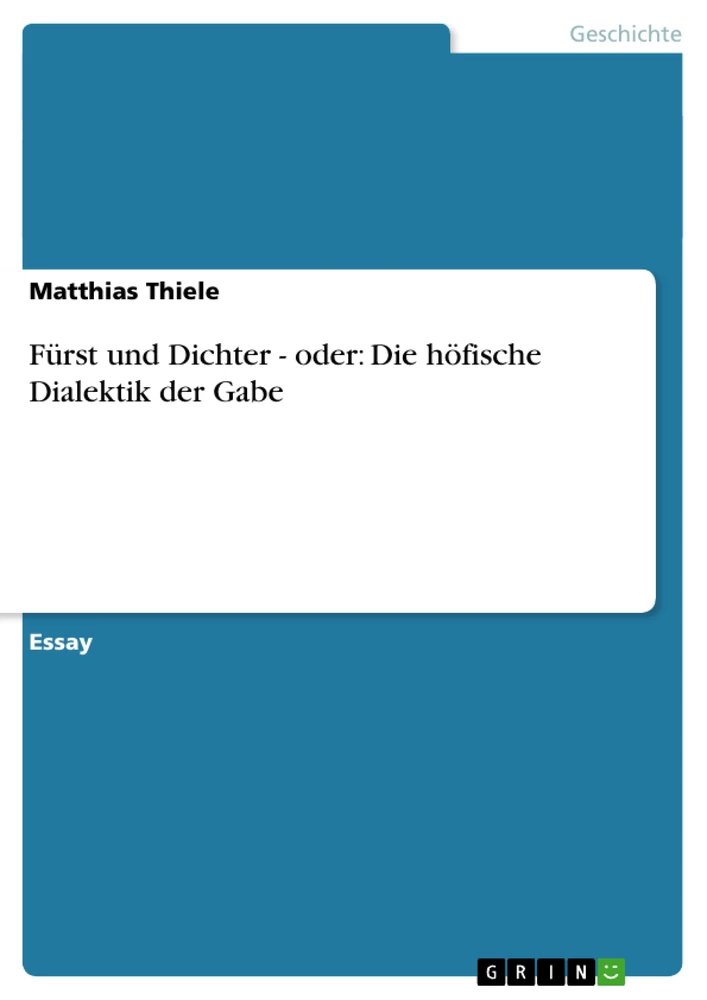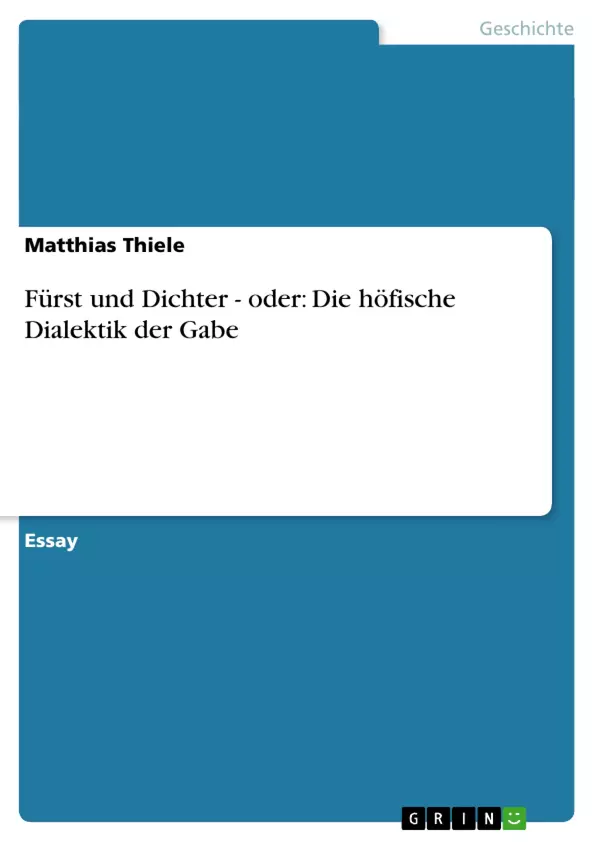„Die Räume sind düster und trist. Der Blick geht auf die Hinterhöfe und einen verwilderten Garten“, beginnt die Süddeutsche Zeitung am 25. März 1969 ihre Seite-3-Reportage. Den Posten des Bundeskanzlers hat damals noch die CDU für sich gepachtet; aber eine neue Zeit scheint heraufzuziehen. Es ist die Zeit der Rudi Dutschkes und der Axel Springers. „Sicher in die 70er Jahre“, plakatiert die CDU – „Wir schaffen das moderne Deutschland“, verspricht die SPD. Wirtschaftswunder gegen Aufbruch, Tradition gegen „Mehr Demokratie wagen“, das sind die Fronten im Wahlkampf.
Im düsteren, tristen Raum mit dem Blick auf die Hinterhöfe und einen verwilderten Garten sitzt Günter Grass - im Büro der Sozialdemokratischen Wählerinitiative mitten im Bonner Zentrum. Mit den Professoren Kurt Sontheimer und Eberhard Jäckel, mit dem Schriftsteller Siegfried Lenz, dem Thomas-Mann-Sohn Golo, der Filmdiva Romy Schneider - mit Künstlern und Intellektuellen hat er die „Sozialdemokratische Wählerinitiative“ geschaffen. Mit den Dichtern und Denkern vereint soll Willy Brandt Deutschland in die Zukunft führen: Der Pakt zwischen Macht und Muse wird geschmiedet – ein Pakt mit langer Tradition.
Inhaltsverzeichnis
- Fürst und Dichter – oder: Die höfische Dialektik der Gabe
- „Qualis artifex pereo“ – „Welch' Künster stirbt mit mir“
- Walthers Umgang mit dem Thüringer Hof
- Die Struktur der höfischen Gesellschaft
- Marcel Mauss' Begriff der „Gabe“
- Die Freigiebigkeit des Fürsten
- Walthers Kritik an den Schreihälsen
- Der Keie und die „ungerichtete Freigiebigkeit“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Fürsten und Dichtern im Mittelalter, insbesondere mit der Rolle des Minnesängers Walther von der Vogelweide am Thüringer Hof. Es wird untersucht, wie die höfische Gesellschaft strukturiert war, welche sozialen Mechanismen das Geben und Nehmen von Gaben prägten und wie die Freigiebigkeit des Fürsten die Kommunikation am Hof beeinflusste.
- Die Rolle des Dichters am Fürstenhof
- Die Dialektik der Gabe im höfischen Kontext
- Die Bedeutung der Freigiebigkeit des Fürsten
- Die Herausforderungen der Kommunikation am Hof
- Die Verbindung zwischen Macht und Muse
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Text beginnt mit einem Blick auf die politische und gesellschaftliche Situation Deutschlands in den 1960er Jahren, um den historischen Kontext für die spätere Analyse der Beziehung zwischen Fürsten und Dichtern im Mittelalter zu schaffen. Es wird die Gründung der „Sozialdemokratischen Wählerinitiative“ durch Günter Grass und andere Künstler und Intellektuelle vorgestellt.
- Im zweiten Kapitel wird der Mythos von Walther von der Vogelweide als vertrauter Ratgeber von Königen und Fürsten beleuchtet. Die wissenschaftliche Diskussion über die tatsächliche Beziehung zwischen Walther und dem Thüringer Hof wird vorgestellt.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit Walthers Kritik an den Umgangsformen am Thüringer Hof, die er in seinen Gedichten „Philippston“ und „Atzeton“ thematisiert. Er beklagt die lautstarke und respektlose Atmosphäre, die die Kommunikation am Hof erschwert.
- Im vierten Kapitel wird die Frage nach der Struktur der höfischen Gesellschaft und ihrer Steuerung behandelt. Der Text geht auf die personelle Zusammensetzung des Hofes und die Rolle der Gäste ein. Es wird deutlich, dass es nur begrenzte Quellen über die Zusammensetzung des Hofes gibt.
- Das fünfte Kapitel führt den Begriff der „Gabe“ von Marcel Mauss ein und zeigt, wie dieses Konzept die Dynamik des Gebens und Nehmens an mittelalterlichen Höfen erklären kann. Die drei Verpflichtungen des Gebens – Geben, Annehmen, Erwidern – werden erläutert.
- Im sechsten Kapitel wird die Rolle der Freigiebigkeit des Fürsten im höfischen System analysiert. Die Freigiebigkeit des Fürsten ist eine Form der Gnade, die für den Begünstigten nicht verfügbar ist. Es wird argumentiert, dass die Freigiebigkeit einen Überschuss produziert und nicht durch ökonomische Gesetze geregelt wird.
- Das siebte Kapitel analysiert Walthers Kritik an den „Schreihälsen“ am Hof, die durch die Freigiebigkeit des Fürsten angezogen werden. Diese Personen stören die Kommunikation am Hof, weil sie die Aufmerksamkeit des Fürsten auf sich ziehen und Walthers Gegengaben untergehen lassen.
- Im achten Kapitel wird die Figur des Keie aus der Artus-Sage als Beispiel für eine Art von Kontrolle über die Freigiebigkeit des Fürsten vorgestellt. Der Keie ist ein Spötter, der die Aufschneider und Blender am Hof verspottet und so den Zugang zum Herrscher reguliert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes umfassen die Beziehung zwischen Fürst und Dichter, die höfische Gesellschaft im Mittelalter, die Dialektik der Gabe, die Freigiebigkeit des Fürsten, die Kommunikation am Hof, die Kritik am höfischen Umfeld und die Rolle des Dichters als Vermittler zwischen Macht und Muse. Der Text verbindet historische Analyse mit soziologischen Theorien und verwendet Werke von Walther von der Vogelweide, Wolfgang von Eschenbach und Marcel Mauss, um die komplexen Dynamiken des höfischen Lebens zu beleuchten.
- Citation du texte
- Matthias Thiele (Auteur), 2005, Fürst und Dichter - oder: Die höfische Dialektik der Gabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41728