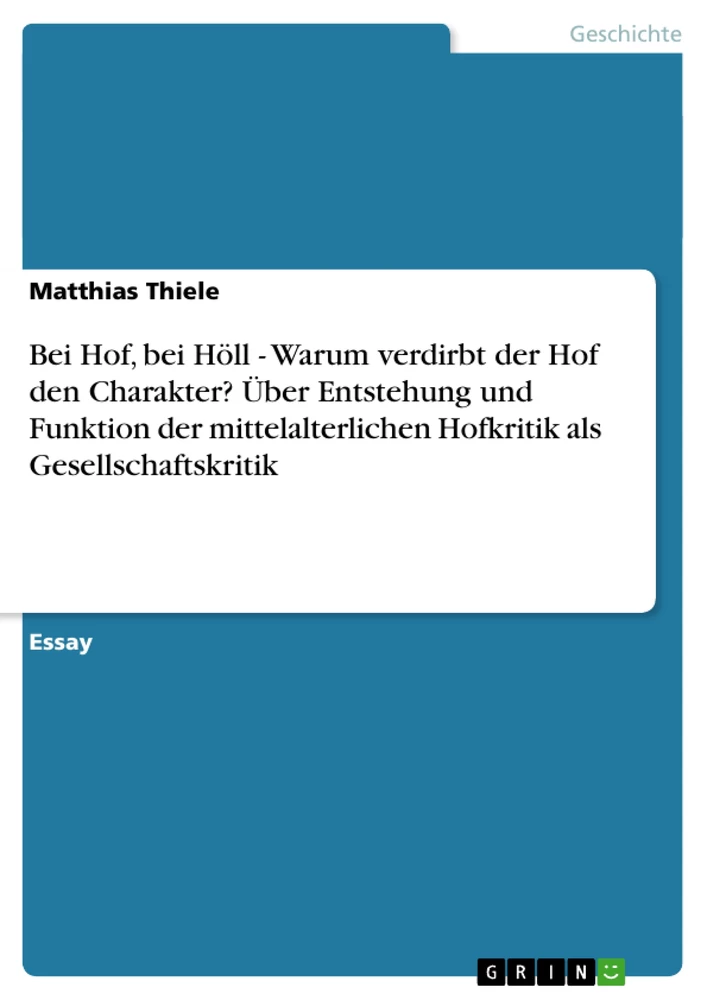„Kaiserlich“ wurde Enea Silvio Piccolomini (1404-1464) offenbar nicht empfangen, als er 1442 seinen Dienst am Hofe Friedrichs III. antrat: „Glaub auch nur nicht, dass man Dir silberne oder gläserne Becher vorsetzt; bei jenen fürchtet man, dass er gestohlen, bei diesen, dass er zerbrochen wird. Du musst aus einem Holzbecher trinken, welcher schwarz, alt, stinkend ist, an dessen Grund Weinstein fest geworden ist und in den die Herren sonst zu pissen pflegen“, schrieb der große italienische Humanist 1444 an seinen Freund Johannes von Eich. „De curialium miseriis“ – „Über das Elend der Hofleute“ – heißt sein Traktat. Der aus Siena stammende Geistliche geht auch im weiteren Verlauf hart ins Gericht mit seinen höfischen Glaubensbrüdern nördlich der Alpen: Die „Witzereißer, Schmähsüchtigen und Brüller“ hätten das Sagen bei Hofe - Frauen trieben es jeweils mit dem Höfling, der gerade den größten Einfluss habe. Das Fleisch stinke; der Käse sei „lebendig, voller Würmer und Löcher“. Und schlafen müsse man oft auf Brettern, auf nacktem Stein oder in Sturm und Hagel und bei der Kälte: „Dein Schlafgesell hat Ausschlag und kratzt sich die ganze Nacht, ein anderer hustet, ein anderer bedrängt dich mit seinem übelriechendem Atem. Bisweilen liegt auch ein Aussätziger bei dir. Und da schnarcht der eine, der andere furzt, ein dritter wirft die Schuhe herum. Die Besoffenen kommen schlafen, erzählen, schwätzen, stoßen auf, balgen sich, werfen einander um und stehen wieder auf, um zu pissen.“
Piccolominis Text wurde zu einem wahren Bestseller des ausgehenden Mittelalters: etwa 80 Abschriften, zwei deutsche Übersetzungen und 15 Drucke zwischen 1470 und 1500 kann die Forschung belegen. Mit „Über das Elend der Hofleute“ ist damit ein vorläufiger Höhepunkt in der Reihe hofkritischer Schriften erreicht. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich im höfischen Umfeld der Mächtigen aus moralischen Ratschlägen und Beobachtungen eine eigene Literaturgattung gebildet: Die Hofkritik. Ihre Anfänge liegen in der Antike.
Inhaltsverzeichnis
- „Bei Hof, bei Höll“ – Warum verdirbt der Hof den Charakter?
- Über Entstehung und Funktion der mittelalterlichen Hofkritik als Gesellschaftskritik
- Der Fall Piccolomini
- Die Anfänge der Hofkritik in der Antike
- Die mittelalterliche Hofkritik: Moralische Ratschläge und Beobachtungen
- Die Weiterentwicklung der Hofkritik im 12. Jahrhundert
- Die Kritik an den höfischen Sitten
- Die Erweiterung der Hofkritik auf die gesamte Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entstehung und Funktion der mittelalterlichen Hofkritik als Gesellschaftskritik. Sie beleuchtet, wie die Kritik am Hofleben im Laufe der Jahrhunderte von moralischen Ratschlägen zu einer eigenen Literaturgattung heranwuchs, die sich mit den Verfehlungen der Mächtigen auseinandersetzte und ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Normen und Werte ihrer Zeit war.
- Die Entwicklung der Hofkritik von der Antike bis in die Frühe Neuzeit
- Die Rolle der geistlichen Hofkritiker und ihre Kritik an den moralischen Verfehlungen der Hofleute
- Die Entwicklung der volkstümlichen Hofkritik und ihre Verbindung zu Heldensagen und Ritterromanen
- Die Ausformung der Hofkritik als literarische Gattung mit ihren typischen Motiven und Themen
- Die Auswirkungen der Hofkritik auf die gesellschaftliche Ordnung und die Wahrnehmung des Hoflebens
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den Fall Enea Silvio Piccolomini und seine Kritik am Hofleben im 15. Jahrhundert. Es stellt die Entstehung der Hofkritik als eigenständige Literaturgattung im Kontext der höfischen Sitten und Moralvorstellungen des Mittelalters dar.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit den Anfängen der Hofkritik in der Antike, insbesondere mit den Werken von Lucanus und Juvenal. Es werden die Unterschiede zwischen der antiken und der mittelalterlichen Hofkritik hinsichtlich ihrer Zielrichtung und ihrer moralischen Grundlagen erörtert.
- Das dritte Kapitel schildert die Entwicklung der Hofkritik im Mittelalter, insbesondere im 12. Jahrhundert. Es werden die Schriften von Ordericus Vitalis, Wilhelm von Malmesbury, Johannes von Salisburry und Petrus von Blois vorgestellt, die sich mit der Kritik an den höfischen Sitten und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft auseinandersetzen.
- Das vierte Kapitel beleuchtet die Erweiterung der Hofkritik auf die gesamte Gesellschaft, die über die Kritik an einzelnen Verhaltensweisen hinausgeht und die Legitimität des politischen, kulturellen und sozialen Wandels in Frage stellt.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Entwicklung der volkstümlichen Hofkritik, die in der Sprache des Volkes Kritik an den höfischen Sitten übt und moralische Ideale in Form von Heldensagen und Ritterromanen vorträgt.
- Das sechste Kapitel befasst sich mit der Ausformung der Hofkritik als literarische Gattung, die durch ihre typischen Motive und Themen charakterisiert ist. Es werden die Werke von Alain Chartier und Piccolomini im Kontext dieser Entwicklung betrachtet.
Schlüsselwörter
Hofkritik, Gesellschaftskritik, Mittelalter, Antike, Moral, Sitten, Literatur, Geistliche, Volkstümliche Hofkritik, Heldensagen, Ritterromane, Lucanus, Juvenal, Piccolomini, Ordericus Vitalis, Wilhelm von Malmesbury, Johannes von Salisburry, Petrus von Blois, Alain Chartier.
- Citar trabajo
- Matthias Thiele (Autor), 2005, Bei Hof, bei Höll - Warum verdirbt der Hof den Charakter? Über Entstehung und Funktion der mittelalterlichen Hofkritik als Gesellschaftskritik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41730