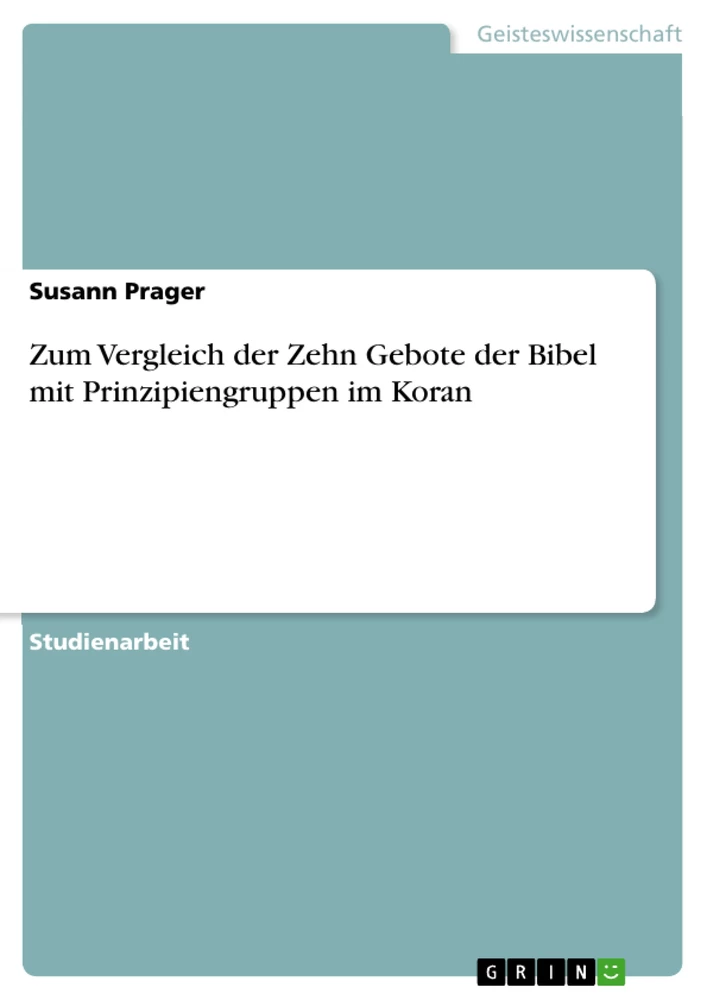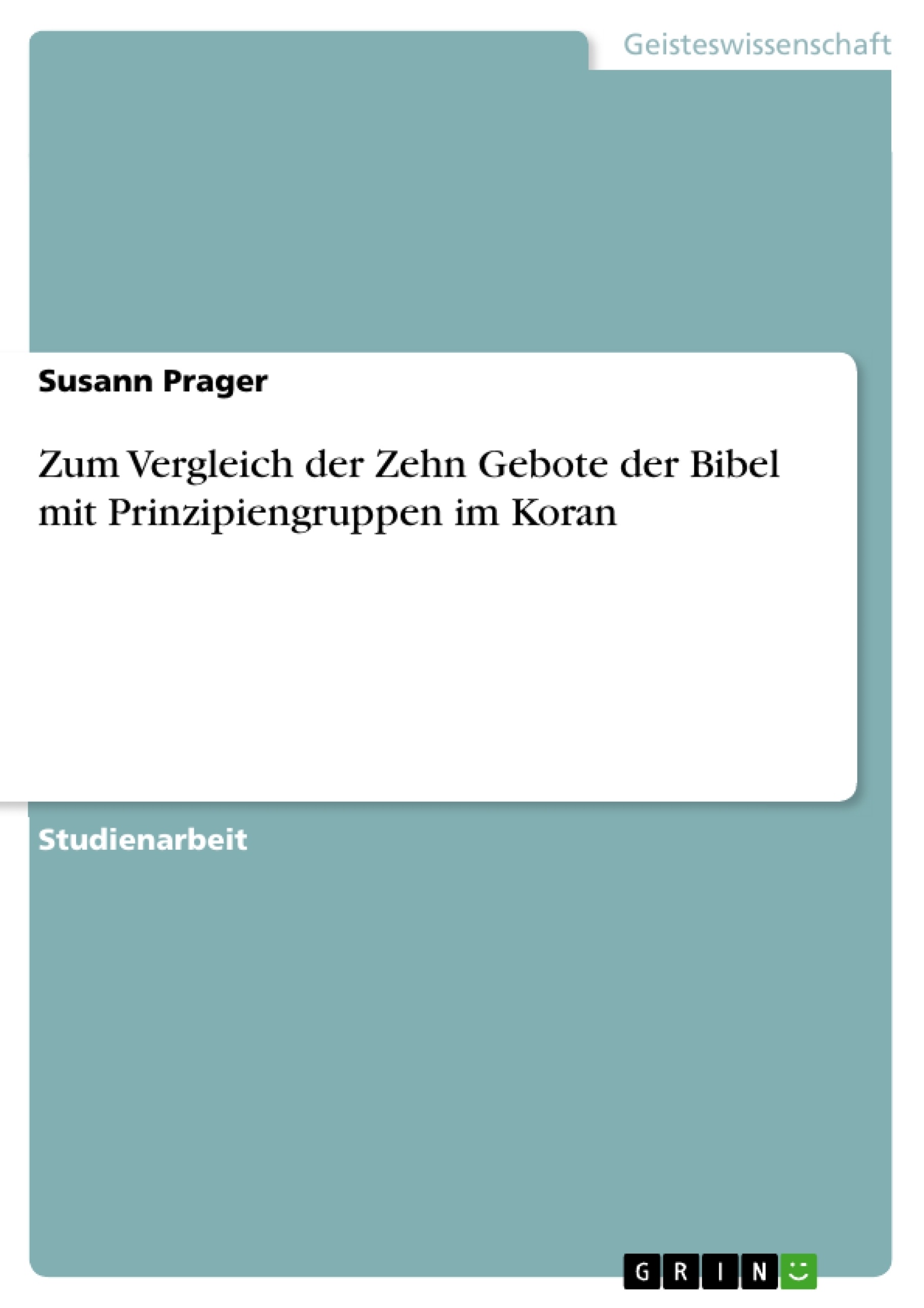Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, inwieweit sich die Gebote in der Bibel auch im Koran finden lassen. Denn auch im Koran finden sich Anordnungen in Form von Reihen oder Prinzipiengruppen, die bereits in ihrer komprimierten Form an den Dekalog erinnern. In der Untersuchung wird insofern herausgearbeitet, ob sich inhaltliche Entsprechungen im Koran zeigen und inwiefern solche Anordnungen aber als dem Islam entsprechende Glaubensessenz modifiziert/verwirklicht erscheinen. Somit zielt das Fazit der Arbeit auf die Frage, ob sich die im Koran vorgefundenen Gebote auch als Kern deren Glaubens ausmachen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fremdgötterverbot
- Bilderverbot
- Namensmissbrauchsverbot
- Sabbatgebot
- Gebot der Elternehrung
- Tötungsverbot
- Ehebruchsverbot
- Diebstahlsverbot
- Verleumdungsverbot
- Begehrensverbot
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit sich die Gebote des Dekalogs in der Bibel auch im Koran wiederfinden lassen. Der Fokus liegt auf der vergleichenden Analyse von Geboten und Prinzipien in beiden Religionen. Dabei wird untersucht, ob sich inhaltliche Entsprechungen im Koran zeigen und inwieweit diese im Islam als Glaubensessenz modifiziert oder verwirklicht erscheinen. Die Arbeit zielt auf die Klärung der Frage ab, ob sich die im Koran vorgefundenen Gebote ebenfalls als Kern des islamischen Glaubens verstehen lassen.
- Vergleich der Zehn Gebote mit Prinzipien im Koran
- Analyse der inhaltlichen Entsprechungen und Unterschiede
- Untersuchung der Bedeutung der Gebote in beiden Religionen
- Bewertung der Reihung der Gebote als Markstein des jeweiligen Glaubens
- Herausarbeitung der spezifischen theologischen Perspektiven im Judentum, Christentum und Islam
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Dekalog als zentrale Zusammenfassung der Gebote im Judentum und Christentum vor und erläutert dessen Bedeutung in der Geschichte beider Religionen. Sie führt den Vergleich mit dem Koran ein und legt die Ziele der Arbeit dar.
- Fremdgötterverbot: Das Kapitel analysiert das Fremdgötterverbot im Dekalog, beleuchtet dessen Entwicklung im Judentum und untersucht die Bedeutung der exklusiven Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk. Anschließend wird das entsprechende Gebot im Koran vorgestellt und der Vergleich zwischen den beiden Religionen hinsichtlich des Monotheismus und der Einzigkeit Gottes gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der Zehn Gebote der Bibel mit den Prinzipien im Koran. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Dekalog, Fremdgötterverbot, Monotheismus, Islam, Judentum, Christentum, Gottesverehrung, Einzigkeit Gottes, Religionsgeschichte, Ethik, Moral, Glaubensgrundsätze, Prinzipien.
Häufig gestellte Fragen
Finden sich die Zehn Gebote der Bibel auch im Koran wieder?
Ja, die Arbeit zeigt, dass viele Prinzipien des Dekalogs (z.B. Elternverehrung, Tötungsverbot) in ähnlicher Form als Prinzipiengruppen im Koran enthalten sind.
Wie wird das Fremdgötterverbot im Koran interpretiert?
Im Koran wird dies durch den strengen Monotheismus (Tauhīd) und die absolute Einzigkeit Gottes ausgedrückt, analog zum ersten Gebot der Bibel.
Gibt es ein Sabbatgebot im Islam?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Freitag im Islam eine vergleichbare Rolle zum Sabbat einnimmt oder ob es hier wesentliche theologische Unterschiede gibt.
Sind die Gebote im Koran als "Glaubensessenz" zu sehen?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob diese komprimierten Anordnungen im Koran tatsächlich den Kern des islamischen Glaubens bilden.
Welche ethischen Entsprechungen gibt es beim Diebstahls- und Tötungsverbot?
Beide Schriften verurteilen Diebstahl und Mord als schwere Vergehen gegen die göttliche und gesellschaftliche Ordnung.
- Quote paper
- Susann Prager (Author), 2014, Zum Vergleich der Zehn Gebote der Bibel mit Prinzipiengruppen im Koran, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417440