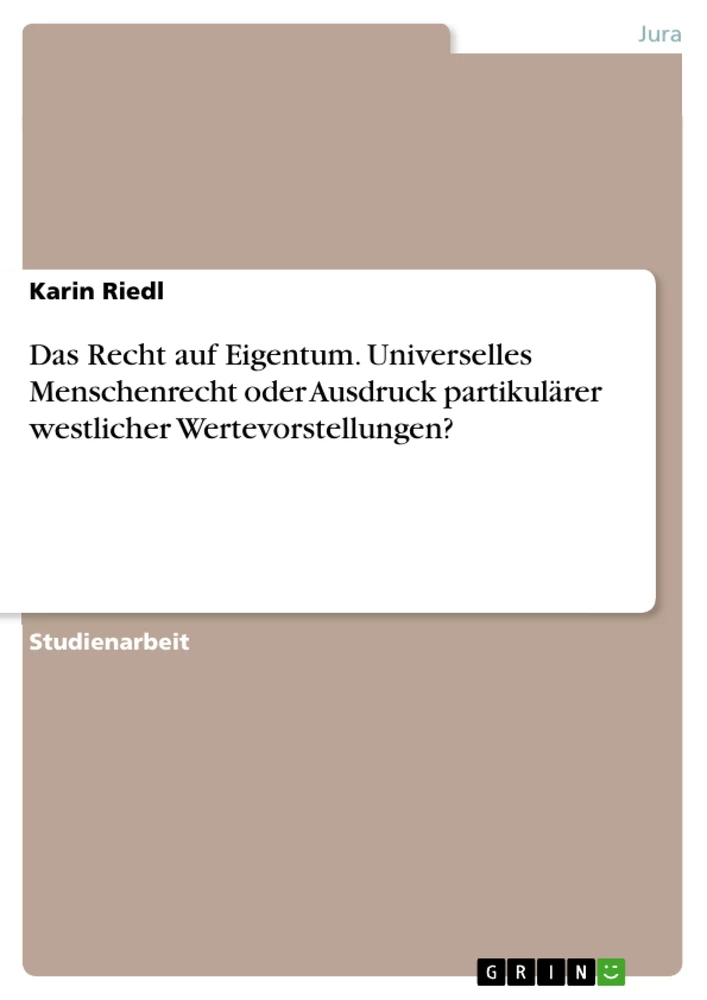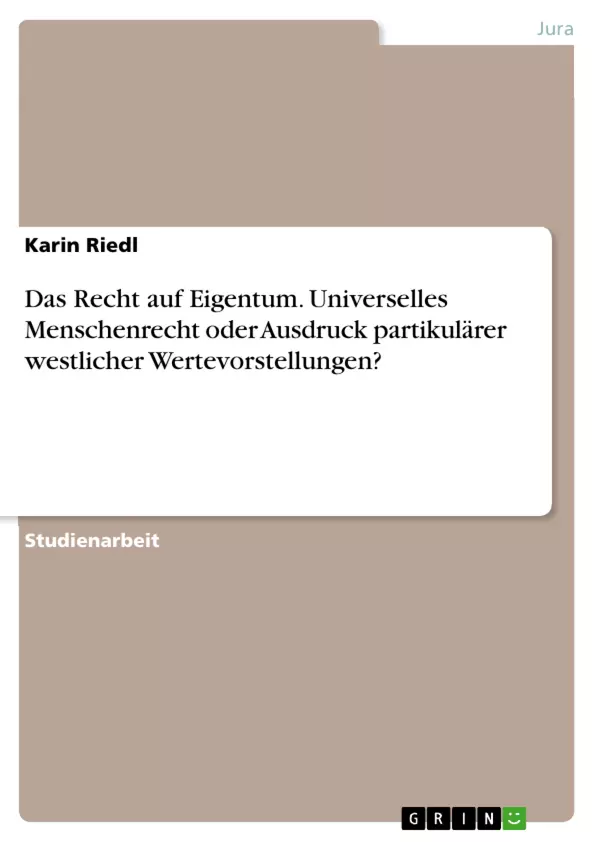Obwohl die Institution des Eigentums vermutlich in allen Gesellschaften und zu allen Zeiten vorkam, so kann doch anhand der europäischen Philosophiegeschichte wie auch durch ethnographischen Beispiele gezeigt werden, dass der Begriff des Eigentums nicht statisch und naturgegeben ist, sondern sich durch Praxis und Normen bzw. Gesetzgebung ständig verändert hat. Von besonderer Bedeutung ist hierbei das Kollektiveigentum, das in vielen nicht-westlichen Gesellschaften gängig war und ist und das Postulat der Universalität des Rechts auf individuelles Privateigentum in Zweifel zieht. Auch in theoretischer Hinsicht wurden die Vor- und Nachteile des Privateigentums gegeneinander abgewogen. Diese Zusammenhänge sollen im ersten Teil der vorliegenden Arbeit dargestellt werden. Anschließend wird erläutert, durch welche internationalen Verträge das Recht auf Eigentum geschützt wird, wie internationale Gerichtshöfe in ihrer Rechtsprechung mit diesem Recht umgehen und welche staatlichen Pflichten sich aus dem Eigentumsrecht ableiten.
Um schließlich abwägen zu können, ob das Recht auf Eigentum ein universelles Menschenrecht oder Ausdruck partikulärer westlicher Wertevorstellungen ist, wird zunächst der Ansatz des peruanischen Ökonomen Hernando de Soto dargestellt, der das Recht auf Privateigentum als grundlegend für die Armutsbekämpfung und damit als eines der wichtigsten Menschenrechte betrachtet. Nach einer Erläuterung der Kritikpunkte an diesem Ansatz und den der Schwierigkeiten bei seiner Umsetzung sollen der positive Bezug des Eigentumsrechtes zu anderen Menschenrechten und der eventuelle Konflikt dieses Rechtes mit anderen Menschenrechten erörtert werden.
Schließlich wird in der Schlussbetrachtung versucht, die Frage zu beantworten, ob das Recht auf Eigentum tatsächlich den ihm beigemessenen Universalitätsanspruch haben kann, oder ob es Teil eines historisch gewachsenen, kulturell bedingten Wertesystems ist.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Eigentum in der philosophischen Theoriegeschichte
- 1. Definition und Systematik
- 2. Argumente für Privateigentum
- 3. Argumente gegen Privateigentum
- C. Völkerrechtlicher Schutz des Menschenrechts auf Eigentum
- 1. Anfänge
- 2. Internationale Verträge
- 3. Regionale Verträge und nationale Verfassungen
- 4. Staatliche Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht
- D. Argumentative Begründung des Menschenrechtscharakters des Eigentumsrechts
- 1. Der Ansatz von Hernando de Soto
- 2. Bezug zu anderen Menschenrechten
- E. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob das Recht auf Eigentum ein universelles Menschenrecht darstellt oder ob es Ausdruck partikulärer westlicher Wertevorstellungen ist. Hierzu wird die historische Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der philosophischen Theoriegeschichte analysiert und der völkerrechtliche Schutz des Eigentumsrechts beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch den Ansatz von Hernando de Soto und dessen Bedeutung für die Armutsbekämpfung.
- Historische Entwicklung des Eigentumsbegriffs
- Völkerrechtlicher Schutz des Eigentumsrechts
- Der Ansatz von Hernando de Soto und seine Relevanz
- Bezug des Eigentumsrechts zu anderen Menschenrechten
- Universalität versus partikuläre Wertevorstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung definiert das Recht auf Eigentum gemäß der Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte als umfassendes Recht, Wertgegenstände zu erwerben, zu besitzen und zu handeln. Sie hebt die historische und kulturelle Variabilität des Eigentumsbegriffs hervor, insbesondere im Vergleich zwischen individuellem Privateigentum und kollektivem Eigentum in nicht-westlichen Gesellschaften. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau, der die philosophische Theoriegeschichte des Eigentums, den völkerrechtlichen Schutz und die Argumentation für bzw. gegen den universalen Charakter des Eigentumsrechts umfasst, um schließlich die eingangs gestellte Frage zu beantworten.
B. Eigentum in der philosophischen Theoriegeschichte: Dieses Kapitel befasst sich mit der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Eigentum seit der Antike. Es definiert Eigentum als ein Bündel von Rechten und Pflichten, untersucht verschiedene legitime Entstehungsgründe (Okkupation, Arbeit, Verrechtlichung) und beleuchtet unterschiedliche philosophische Positionen zum Privateigentum. Aristoteles, Hobbes, Locke, Kant und Rousseau werden als Beispiele herangezogen, um die Bandbreite der Argumente für und gegen Privateigentum zu verdeutlichen, von der instrumentellen Sichtweise als Voraussetzung für ein gutes Leben bis hin zur Abhängigkeit vom Gemeinwohl.
C. Völkerrechtlicher Schutz des Menschenrechts auf Eigentum: Dieses Kapitel beschreibt den völkerrechtlichen Schutz des Eigentumsrechts. Es analysiert die historischen Anfänge, relevante internationale Verträge, regionale Übereinkommen und nationale Verfassungen. Der Fokus liegt auf den staatlichen Verpflichtungen, die sich aus dem Eigentumsrecht ableiten, und wie diese Verpflichtungen im Kontext von Enteignungen und der Wahrung des Gemeinwohls auszulegen sind. Konkrete Beispiele aus der Rechtsprechung internationaler Gerichtshöfe werden analysiert, um den Umfang des Schutzes und die Herausforderungen bei der Umsetzung zu verdeutlichen.
D. Argumentative Begründung des Menschenrechtscharakters des Eigentumsrechts: Dieses Kapitel erörtert die Argumentation für den Menschenrechtscharakter des Eigentumsrechts, vor allem unter Bezugnahme auf den Ansatz von Hernando de Soto. De Sotos These, wonach das Recht auf Privateigentum essentiell für Armutsbekämpfung ist, wird im Detail dargestellt und kritisch hinterfragt. Das Kapitel analysiert den positiven Bezug des Eigentumsrechts zu anderen Menschenrechten, sowie mögliche Konflikte mit anderen Menschenrechten, um die Komplexität der Thematik zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Eigentumsrecht, Menschenrecht, Privateigentum, Kollektiveigentum, Philosophiegeschichte, Völkerrecht, Internationale Verträge, Hernando de Soto, Armutsbekämpfung, Universalität, Westliche Wertevorstellungen, Gemeinwohl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Eigentumsrecht als Menschenrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob das Recht auf Eigentum ein universelles Menschenrecht darstellt oder ob es Ausdruck partikulärer westlicher Wertevorstellungen ist. Sie analysiert die historische Entwicklung des Eigentumsbegriffs, den völkerrechtlichen Schutz des Eigentumsrechts und den Ansatz von Hernando de Soto zur Armutsbekämpfung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der philosophischen Theoriegeschichte (Aristoteles, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau), den völkerrechtlichen Schutz des Eigentumsrechts (internationale und regionale Verträge, nationale Verfassungen), die Argumentation für und gegen den universalen Charakter des Eigentumsrechts, den Ansatz von Hernando de Soto und dessen Bedeutung für die Armutsbekämpfung, sowie den Bezug des Eigentumsrechts zu anderen Menschenrechten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Eigentum in der philosophischen Theoriegeschichte, zum völkerrechtlichen Schutz des Eigentumsrechts, zur argumentativen Begründung des Menschenrechtscharakters des Eigentumsrechts und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und liefert eine detaillierte Analyse.
Was versteht die Arbeit unter "Recht auf Eigentum"?
Das Recht auf Eigentum wird gemäß der Rechtsprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte als umfassendes Recht definiert, Wertgegenstände zu erwerben, zu besitzen und zu handeln. Die Arbeit berücksichtigt jedoch auch die historische und kulturelle Variabilität des Eigentumsbegriffs, insbesondere den Unterschied zwischen individuellem Privateigentum und kollektivem Eigentum in nicht-westlichen Gesellschaften.
Welche philosophischen Positionen zum Privateigentum werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene philosophische Positionen zum Privateigentum, indem sie die Argumente von Aristoteles, Hobbes, Locke, Kant und Rousseau analysiert. Es werden sowohl instrumentelle Sichtweisen (Eigentum als Voraussetzung für ein gutes Leben) als auch solche betrachtet, die die Abhängigkeit des Privateigentums vom Gemeinwohl betonen.
Wie wird der völkerrechtliche Schutz des Eigentumsrechts dargestellt?
Das Kapitel zum völkerrechtlichen Schutz analysiert historische Anfänge, relevante internationale Verträge, regionale Übereinkommen und nationale Verfassungen. Es konzentriert sich auf staatliche Verpflichtungen im Kontext von Enteignungen und der Wahrung des Gemeinwohls und analysiert konkrete Beispiele aus der Rechtsprechung internationaler Gerichtshöfe.
Welche Rolle spielt Hernando de Soto in der Arbeit?
Die Arbeit stellt De Sotos These dar, wonach das Recht auf Privateigentum essentiell für die Armutsbekämpfung ist. Diese These wird detailliert dargestellt und kritisch hinterfragt. Der Bezug zu anderen Menschenrechten und mögliche Konflikte werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die eingangs gestellte Frage nach dem universellen Charakter des Eigentumsrechts. Der genaue Inhalt der Schlussfolgerung ist aus dem vorliegenden Textfragment nicht vollständig ersichtlich.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Eigentumsrecht, Menschenrecht, Privateigentum, Kollektiveigentum, Philosophiegeschichte, Völkerrecht, Internationale Verträge, Hernando de Soto, Armutsbekämpfung, Universalität, Westliche Wertevorstellungen, Gemeinwohl.
- Citar trabajo
- Karin Riedl (Autor), 2012, Das Recht auf Eigentum. Universelles Menschenrecht oder Ausdruck partikulärer westlicher Wertevorstellungen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417806