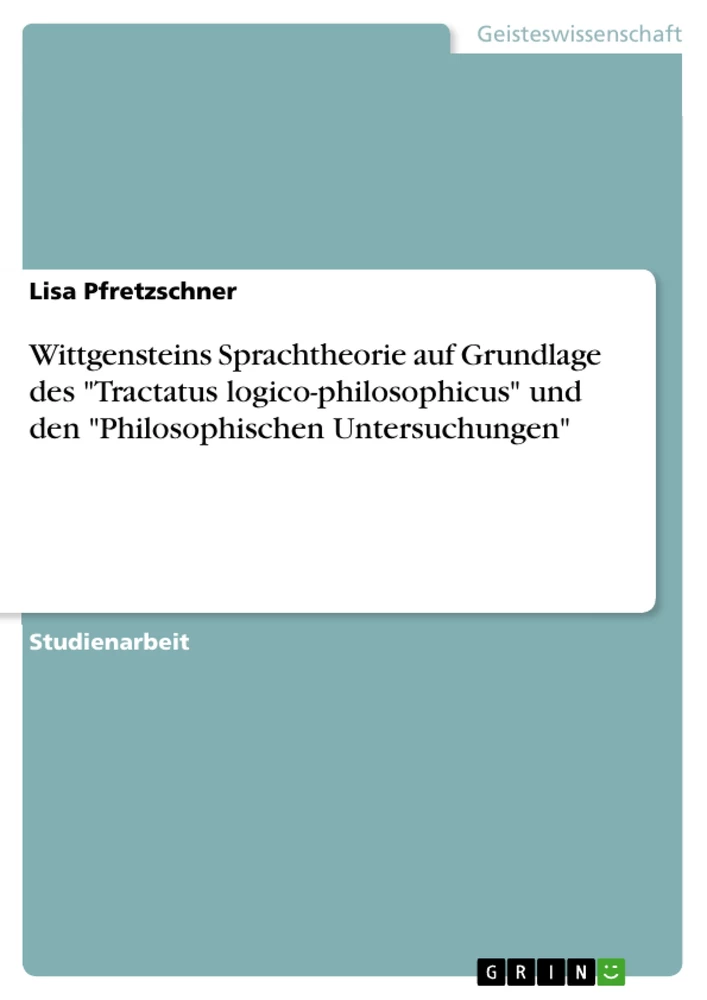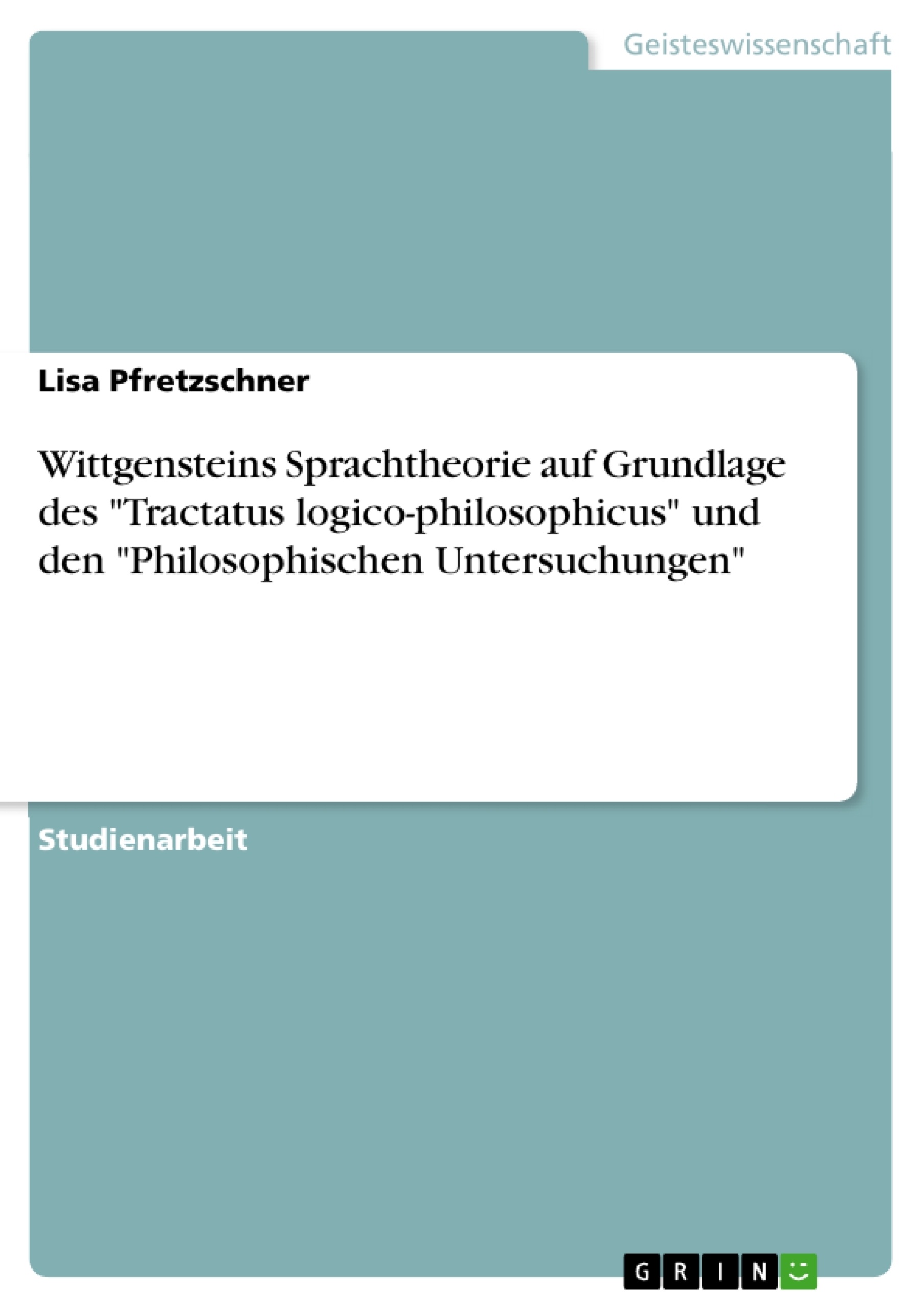Das Seminar fand im Rahmen des Themengebiets der Sprachphilosophie statt. Auf der Suche nach einem passenden Thema, stieß ich auf den Philosophen Ludwig Wittgenstein, der mit seinen Gedanken zur Sprache die Welt der Sprachphilosophie nachhaltig prägte.
In dieser Arbeit werde ich daher zunächst versuchen, die Grundgedanken der Sprachphilosophie sehr allgemein zusammenzufassen, um einen Überblick darüber zu geben, was unter diesem philosophischen Themengebiet zu verstehen ist. Anschließend möchte ich den Philosophen Ludwig Wittgenstein kurz vorstellen und dabei auf seine beiden Werke, den Tractatus logico-philosophicus und die Philosophischen Untersuchungen, eingehen.
Im Anschluss daran erfolgt ein Teil, indem ich auf das erst genannte Werk Wittgensteins eingehe und dieses in angemessener Länge vorstellen werde. Im Anschluss gehe ich auf seine Philosophischen Untersuchungen ein, die den späten Wittgenstein repräsentieren. Weiterhin folgt ein Teil, den ich Sprachspiele nenne, da er ein zentraler Begriff seines späteren Wirkens ist. Seine „Sprachspiele“ werden am ausführlichsten in den Philosophischen Untersuchungen erläutert. Im Schlussteil der Arbeit werde ich mein Fazit ziehen. Außerdem gehe ich auf Kritik und Widersprüchlichkeiten, insbesondere im Tractatus, ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Sprachphilosophie
- 2.2 Ludwig Wittgenstein
- 2.2.1 Tractatus logico-philosophicus (1921)
- 2.2.2 Philosophische Untersuchungen (1953)
- 2.2.2.1 Sprachspiele
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ludwig Wittgensteins Sprachtheorie, indem sie seine beiden Hauptwerke, den Tractatus logico-philosophicus und die Philosophischen Untersuchungen, analysiert. Ziel ist es, die Entwicklung seiner Gedanken und die zentralen Aspekte seiner Philosophie darzustellen. Die Arbeit bietet einen Überblick über die Sprachphilosophie im Allgemeinen und konzentriert sich anschließend auf Wittgensteins Beitrag zu diesem Gebiet.
- Entwicklung der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart
- Wittgensteins frühe Sprachtheorie im Tractatus logico-philosophicus
- Wittgensteins späte Sprachtheorie in den Philosophischen Untersuchungen
- Das Konzept der "Sprachspiele"
- Kritik und Widersprüche in Wittgensteins Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Fokus auf Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der von einer allgemeinen Einführung in die Sprachphilosophie über die Vorstellung Wittgensteins und seiner beiden Hauptwerke zu einer detaillierten Analyse ausgewählter Aspekte führt, und schließt mit einem Ausblick auf den Schlussteil.
2. Hauptteil: Dieser Abschnitt beginnt mit einer umfassenden Darstellung der Sprachphilosophie als Disziplin, beleuchtet verschiedene Ansätze und deren historische Entwicklung. Es werden zentrale Fragen der Sprachphilosophie, wie das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit, Sprache und Denken, und der Einfluss von Philosophen wie Herder und Humboldt, diskutiert. Die Bedeutung der analytischen Sprachphilosophie und ihre verschiedenen Strömungen werden erläutert, mit besonderer Berücksichtigung der idealsprachlichen und normalsprachlichen Richtungen. Die Ausführungen liefern eine fundierte Grundlage für das Verständnis von Wittgensteins Werk im weiteren Verlauf der Arbeit. Der Hauptteil legt sodann den Fokus auf Ludwig Wittgenstein und seine beiden Hauptwerke: den Tractatus logico-philosophicus und die Philosophischen Untersuchungen. Dabei wird die Entwicklung seiner Gedanken und der Wandel seiner sprachphilosophischen Position deutlich herausgearbeitet. Die Erklärung der „Sprachspiele“ als zentralen Begriff der späten Wittgenstein'schen Philosophie wird besonders ausführlich behandelt, und deren Bedeutung für sein Gesamtwerk verdeutlicht. Der Abschnitt stellt somit eine detaillierte Auseinandersetzung mit Wittgensteins Sprachtheorie dar, die seine Entwicklung und die zentralen Aspekte seiner Philosophie herausarbeitet und in den Kontext der allgemeinen Sprachphilosophie einordnet.
Schlüsselwörter
Sprachphilosophie, Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Philosophische Untersuchungen, Sprachspiele, Analytische Philosophie, Sprache und Wirklichkeit, Sprache und Denken, Bedeutung, Bedeutsamkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie. Sie beinhaltet eine Einleitung, einen Hauptteil mit Analyse seiner Hauptwerke (Tractatus logico-philosophicus und Philosophische Untersuchungen), und einen Schluss. Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Gedanken und zentralen Aspekten seiner Philosophie, eingebettet in einen Überblick über die allgemeine Sprachphilosophie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart, Wittgensteins frühe und späte Sprachtheorie, das Konzept der „Sprachspiele“, Kritik und Widersprüche in seinem Werk, sowie das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit/Denken. Sie analysiert verschiedene Ansätze innerhalb der Sprachphilosophie und diskutiert den Einfluss von Philosophen wie Herder und Humboldt.
Welche Hauptwerke von Wittgenstein werden analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert Wittgensteins zwei Hauptwerke: den Tractatus logico-philosophicus (1921) und die Philosophischen Untersuchungen (1953). Der Fokus liegt auf der Entwicklung seiner Positionen zwischen diesen beiden Werken.
Was sind „Sprachspiele“ im Kontext von Wittgenstein?
Der Begriff „Sprachspiele“ ist ein zentraler Aspekt von Wittgensteins später Philosophie (Philosophische Untersuchungen). Die Arbeit erklärt dieses Konzept ausführlich und verdeutlicht dessen Bedeutung für sein Gesamtwerk.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Wittgensteins Sprachtheorie darzustellen und zu analysieren, seine Entwicklung aufzuzeigen und die zentralen Aspekte seiner Philosophie herauszuarbeiten. Sie bietet einen Überblick über die Sprachphilosophie im Allgemeinen und ordnet Wittgensteins Beitrag in diesen Kontext ein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterabschnitten zur Sprachphilosophie im Allgemeinen und zu Wittgensteins Werk, und einen Schluss. Der Hauptteil beinhaltet eine detaillierte Analyse des Tractatus und der Philosophischen Untersuchungen, mit besonderer Betonung der „Sprachspiele“.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sprachphilosophie, Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Philosophische Untersuchungen, Sprachspiele, Analytische Philosophie, Sprache und Wirklichkeit, Sprache und Denken, Bedeutung, Bedeutsamkeit.
- Citar trabajo
- Lisa Pfretzschner (Autor), 2016, Wittgensteins Sprachtheorie auf Grundlage des "Tractatus logico-philosophicus" und den "Philosophischen Untersuchungen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417924