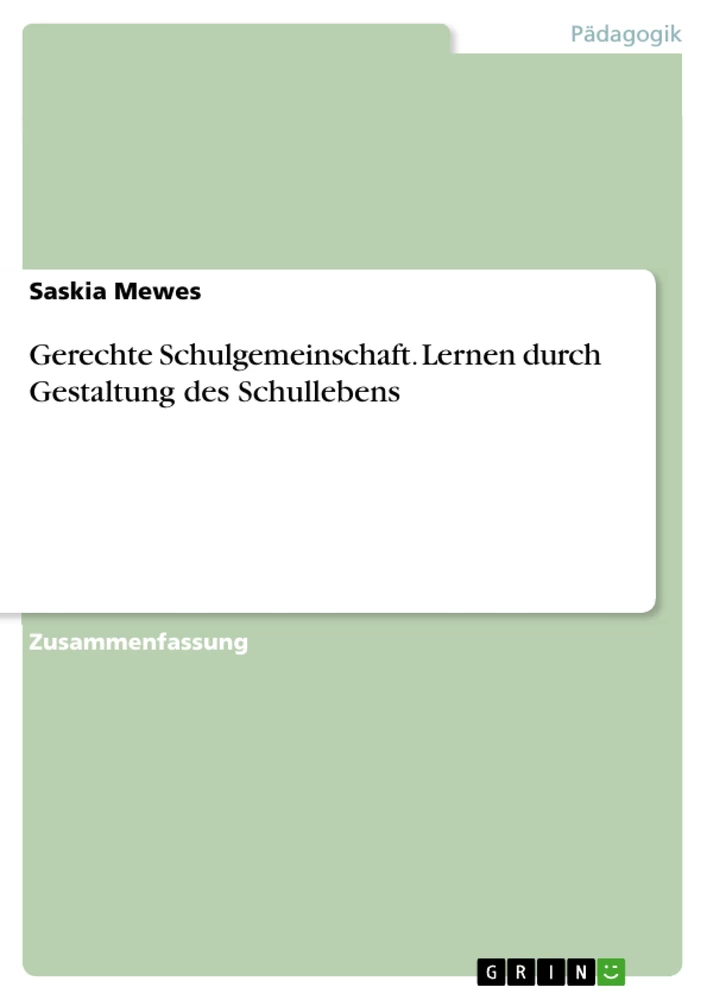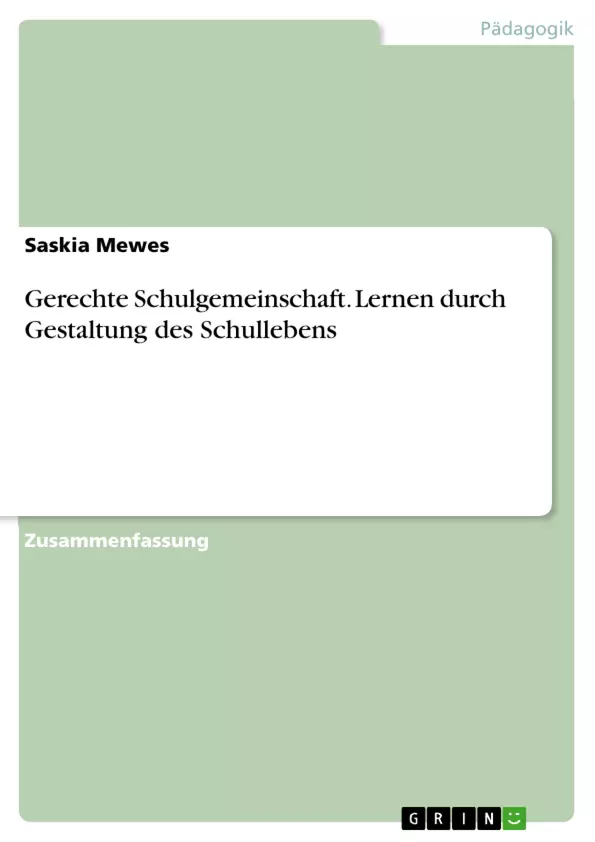Diese Zusammenfassung beschäftigt sich mit dem Modell der gerechten Schulgemeinschaft. Kernpunkt dieses Modells ist die Gemeinschaftsversammlung die alle 2-3 Wochen abgehalten wird. Diese besteht aus Lehrern und Schülern und wird von jeweils zwei Lehrkräften und Schülern geleitet.
Der Hintergrund der Versammlung ist die Erwartung an die Schule neben den intellektuellen Fähigkeiten auch einen moralischen, sozial engagierten, empathiefähigen und diskursgewohnten jungen Menschen heran zu erziehen. Außerdem dient es der Identifikation der Schüler und Lehrpersonen mit der Schule.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Konzept
- Skizze dieses Models
- Idee des Konzeptes
- Prinzipien der Gestaltung der Gerechten Schulgemeinschaft Fallbeispiel: Ein Schüler zerkratzt Tische
- Entwicklung als Ziel der Erziehung
- ,,Abfälle des Lebens\" als Eigenerfahrungen
- Demokratisierung als soziales Prinzip und als Lernangebot
- Rollenübernahme praktizieren
- Geteilte Normen entwickeln
- Eine Welt möglicher sozialer Selbstwirksamkeit schaffen
- Das Verhältnis von Urteil und Handeln verbessern
- \"Zumutung\" praktizieren
- Nochmal zusammengefasst!
- Die Struktur der Gerechten Schulgemeinschaft
- Die Begleitung des Lehrerkollegiums
- Endergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Konzept der „Gerechten Schulgemeinschaft“ strebt danach, die Schule zu einem Lebensraum zu gestalten, in dem Schülerinnen und Schüler durch aktive Teilnahme und Mitbestimmung demokratisches Verhalten, prosoziales Handeln und moralische Urteilsfähigkeit entwickeln.
- Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz
- Förderung prosozialen Verhaltens und moralischen Urteils
- Gemeinschaftsbildung durch aktive Beteiligung und Mitbestimmung
- Schaffung einer Lernumgebung, die soziales Verstehen und Selbstwirksamkeit fördert
- Verantwortung und Mitverantwortung im Schulleben
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Problemstellung erläutert, die das Konzept der „Gerechten Schulgemeinschaft“ ins Leben gerufen hat. Die Schule soll neben der Vermittlung von Wissen auch zur Entwicklung sozial engagierter und moralisch verantwortlicher Menschen beitragen. Das Konzept der „Gerechten Schulgemeinschaft“ basiert auf der Theorie Kohlbergs und dem konstruktivistisch-strukturgenetischen Ansatz von Piaget.
Kapitel 2 beleuchtet die Grundzüge des Modells. Der Kernpunkt ist die Gemeinschaftsversammlung, in der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gemeinsam über wichtige Themen diskutieren und Entscheidungen treffen. Ein Beispiel aus der Johann-Gutenberg-Schule in Langfeld verdeutlicht, wie die Versammlungen die Schüler zur Auseinandersetzung mit moralischen Fragen und zur Entwicklung demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse anleiten.
Kapitel 3 erläutert die Prinzipien der Gestaltung der „Gerechten Schulgemeinschaft“ anhand eines konkreten Fallbeispiels: die Beschädigung von Tischen. Die Kapitel beleuchtet, wie die Schüler durch die Auseinandersetzung mit dem Problem, die aktive Teilnahme an der Gemeinschaftsversammlung und die Entwicklung gemeinsamer Lösungen wichtige Kompetenzen für den Umgang mit sozialen Konflikten und Herausforderungen entwickeln.
Schlüsselwörter
Gerechte Schulgemeinschaft, Gemeinschaftsversammlung, Demokratisierung, soziales Verstehen, prosoziales Verhalten, moralische Urteilsfähigkeit, Mitbestimmung, Verantwortung, Selbstwirksamkeit, Schulgemeinschaft, demokratisches Handeln.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der „Gerechten Schulgemeinschaft“?
Es ist ein Modell zur Gestaltung des Schullebens, bei dem Schüler durch aktive Mitbestimmung demokratisches Verhalten, prosoziales Handeln und moralische Urteilsfähigkeit lernen.
Was ist das Herzstück dieses Modells?
Das zentrale Element ist die Gemeinschaftsversammlung, die alle 2-3 Wochen stattfindet und in der Lehrer und Schüler gemeinsam über Schulbelange diskutieren und entscheiden.
Auf welchen Theorien basiert die Gerechte Schulgemeinschaft?
Das Konzept stützt sich auf die Moralentwicklungstheorie von Lawrence Kohlberg sowie den konstruktivistischen Ansatz von Jean Piaget.
Wie wird mit Konflikten, wie z.B. Sachbeschädigung, umgegangen?
Konflikte werden als Lernchancen genutzt. In der Gemeinschaftsversammlung werden Lösungen erarbeitet, die geteilte Normen fördern und die soziale Selbstwirksamkeit der Schüler stärken.
Welche Ziele verfolgt die Schule neben der Wissensvermittlung?
Die Schule soll moralische, sozial engagierte, empathiefähige und diskursgewohnte junge Menschen heranziehen, die sich mit ihrer Schule identifizieren.
- Quote paper
- Saskia Mewes (Author), 2017, Gerechte Schulgemeinschaft. Lernen durch Gestaltung des Schullebens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418202