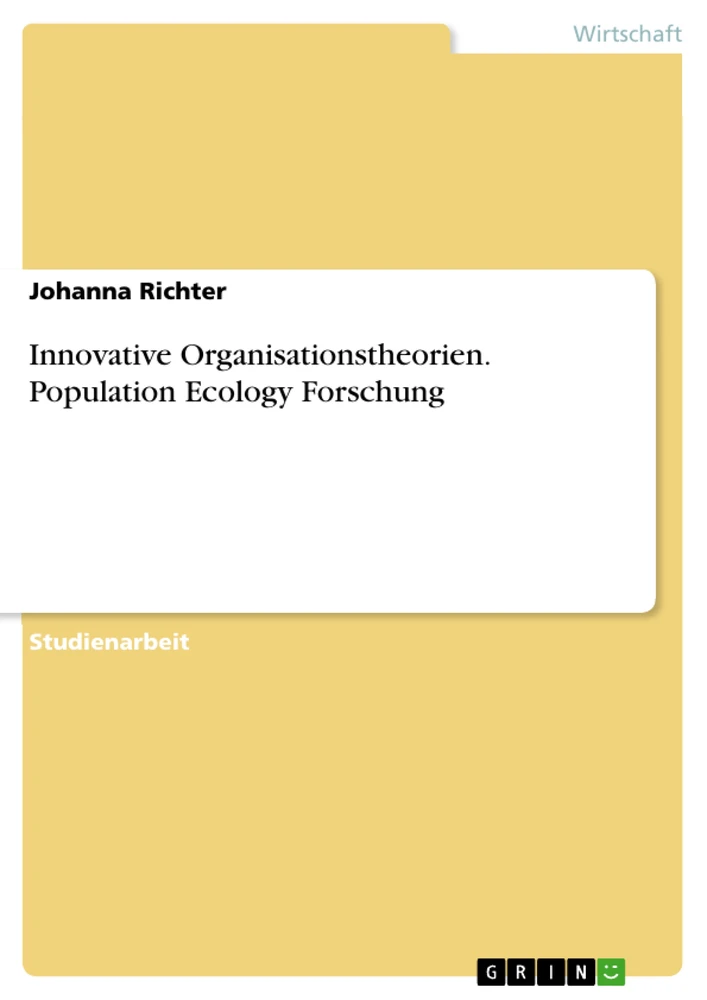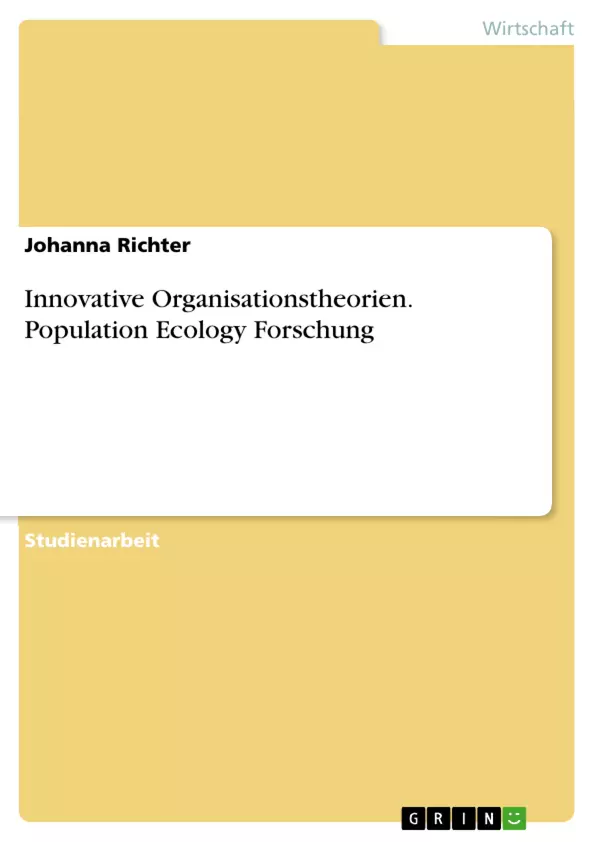In diesem Assignment soll die Population EcologyTheorie nach Hannan/ Freeman und in der Weiterentwicklung nach Aldrich/ Pfeffer erläutert werden, um auf Basis dieser den Prozess von Organisationsentwicklungen zu verstehen. Hierzu wird im ersten Schritt diese Theorie in den Theorienpluralismus der Organisationssoziologie zeitlich und thematisch eingeordnet.
Danach sollen im Kapitel 3 die wichtigsten Wirkungszusammenhänge der Population, Variation, Selektion, Retention sowie der strukturellen Trägheit erklärt werden. Schließlich erfolgt eine kritische Würdigung der Population Ecolgoy-Theorie und ein Fazit in Kapitel 4. Im Rahmen dieser theoretischen Ausarbeitung wird ein Blick auf die Rolle der Manager bei Organisationsentwicklungen geworfen. Schließlich werden Faktoren und Fähigkeiten genannt, welche die Überlebensfähigkeit von Organisationen erhöhen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Einordnung der Population Ecology-Theorie in die Organisationstheorien
- Wirkungszusammenhänge nach Hannan/ Freeman und weiterentwickelt nach Aldrich/ Pfeffer
- Populationen
- Variation, Selektion, Retention
- Strukturelle Trägheit
- Kritische Würdigung und Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Assignment zielt darauf ab, die Population Ecology-Theorie nach Hannan/Freeman und in der Weiterentwicklung nach Aldrich/ Pfeffer zu erläutern, um auf Basis dieser den Prozess von Organisationsentwicklungen zu verstehen. Es wird die Theorie in den Theorienpluralismus der Organisationssoziologie eingeordnet und die wichtigsten Wirkungszusammenhänge der Population, Variation, Selektion, Retention sowie der strukturellen Trägheit beleuchtet. Abschließend erfolgt eine kritische Würdigung der Theorie und ein Fazit.
- Einordnung der Population Ecology-Theorie in den Theorienpluralismus der Organisationssoziologie
- Erklärung der wichtigsten Wirkungszusammenhänge der Population, Variation, Selektion, Retention und strukturelle Trägheit
- Analyse der Rolle der Manager im Kontext der Population Ecology-Theorie
- Identifizierung von Faktoren und Fähigkeiten, die die Überlebensfähigkeit von Organisationen erhöhen
- Kritische Würdigung der Population Ecology-Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass Organisationen ständig mit Unsicherheit, Dynamik und Ressourcenknappheit konfrontiert sind. Die Population Ecology-Theorie wird als Ansatz zur Untersuchung der Organisationsentwicklung vorgestellt und mit der Darwin'schen Evolutionstheorie verglichen. Es wird die Frage aufgeworfen, welche Faktoren den Erfolg von Organisationen im evolutionären Selektionsprozess beeinflussen.
Einordnung der Population Ecology-Theorie in die Organisationstheorien
Dieses Kapitel ordnet die Population Ecology-Theorie in den Theorienpluralismus der Organisationssoziologie ein. Die Organisationssoziologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Gestaltung von Organisationen und untersucht Regelhaftigkeiten in organisationalen Prozessen. Der Population Ecology-Ansatz wird als „Offenes System" im Rahmen der Typologien nach Scott eingeordnet und mit der synthetischen Evolutionstheorie der Biologie in Verbindung gebracht. Es wird hervorgehoben, dass der Ansatz die dominante Anpassungsperspektive in der Organisationsforschung ablehnt und stattdessen eine Betrachtung von Populationen von Organisationen fordert. Die Kernaussage des Population Ecology-Ansatzes ist, dass Organisationen soziale Gebilde sind, die eher auf Unveränderlichkeit als auf Veränderlichkeit beruhen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen des Textes sind: Population Ecology-Theorie, Organisationssoziologie, Theorienpluralismus, Offenes System, Darwin'sche Evolutionstheorie, Populationen, Variation, Selektion, Retention, Strukturelle Trägheit, Managerrolle, Überlebensfähigkeit, Umweltbedingungen.
- Quote paper
- Johanna Richter (Author), 2016, Innovative Organisationstheorien. Population Ecology Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418329