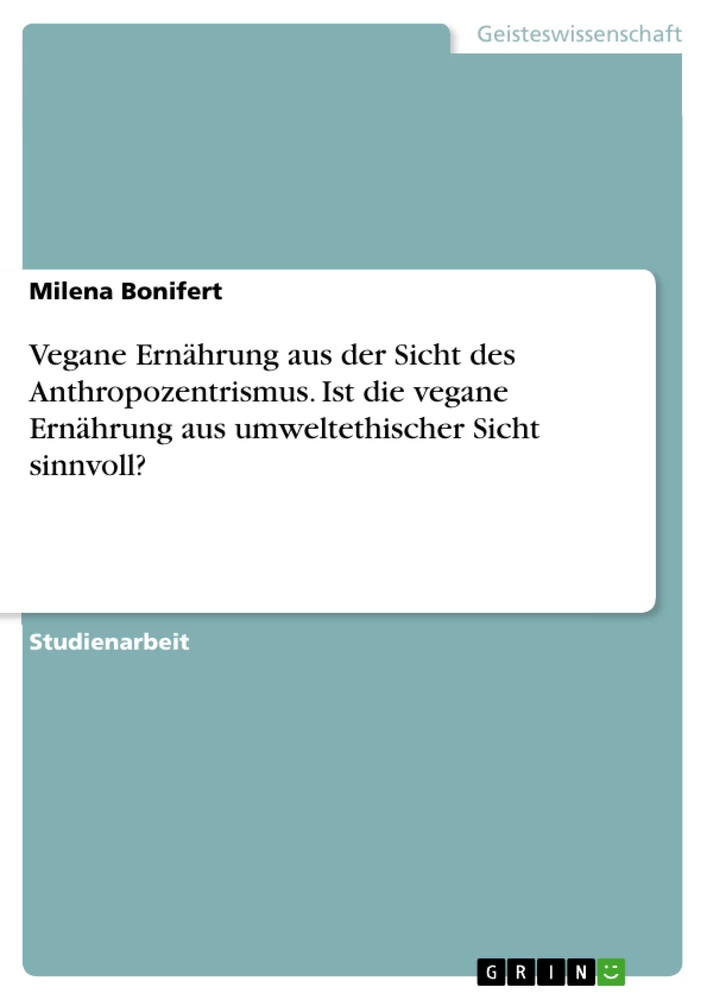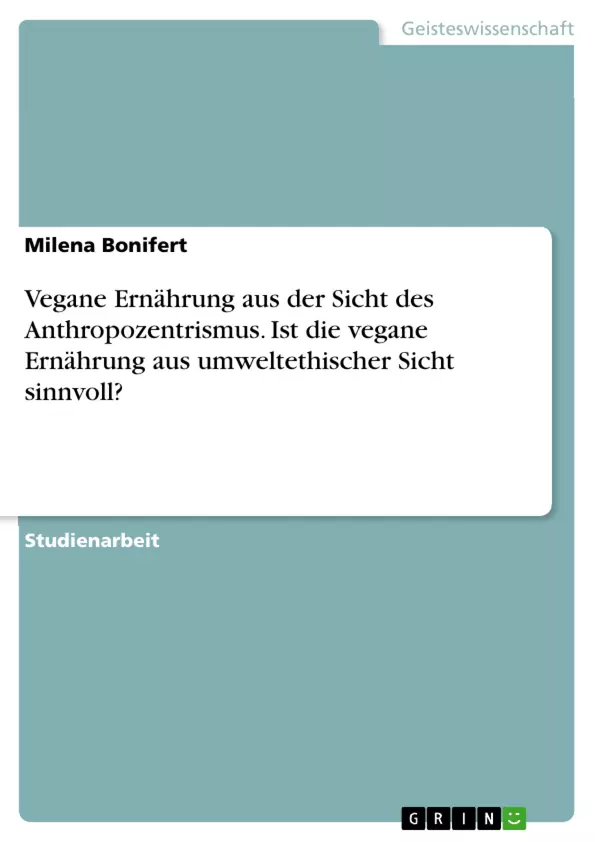In der vorliegenden Arbeit wird die Frage gestellt, inwiefern die vegane Ernährung aus umweltethischer Sicht möglicherweise zu bevorzugen ist und was gegen diese Ernährungsart sprechen könnte. Der Schwerpunkt wird dabei auf anthropozentrischen Argumenten liegen – also solchen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Lange Zeit hat die Frage, wie der Mensch sich seiner nicht-menschlichen Umwelt gegenüber moralisch verhalten soll, keine große Rolle gespielt. Der Mensch wurde zumeist als einziges moralisch relevantes Objekt angesehen und deswegen beschäftigen sich Ethiken oftmals nur mit der Frage, wie er sich gegenüber anderen Menschen verhalten soll.
In Zeiten von globaler Erwärmung, vermehrt vorkommenden Naturkatastrophen und schrumpfender Artenvielfalt wird allerdings die Frage, wie wir unsere Umwelt behandeln sollten, drängend. Neuere Strömungen der Ethik fordern, den Kreis der moralisch relevanten Objekte zu erweitern – je nach Theorie um Tiere, Pflanzen oder ganze Ökosysteme. Die Menschheit steht vor der großen Aufgabe, Wege zu finden, die Umwelt vor der Zerstörung zu bewahren – und sei es nur, um die eigene Existenz nicht zu gefährden. Denn die natürlichen Ressourcen, von denen die Menschheit abhängig ist, werden knapper und die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen, die die Lebensräume der Menschen bedrohen, wird durch den Klimawandel erhöht.
Immer mehr Menschen erkennen, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zum Schutz und auch zur Zerstörung der Umwelt leistet, und viele möchten ein bewussteres Leben führen. Für die meisten stellt die die Ernährung einen maßgeblichen Bestandteil dieses bewussteren Lebensstils dar. Eine Ernährungsform, die immer mehr Zuspruch gewinnt, ist die vegane Ernährung. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass viele negative Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit, wie ernährungsbedingte Zivilisationskrankheiten, Massentierhaltung, Welthunger, aber eben auch die globale Erwärmung mit übermäßigem Fleischkonsum in Verbindung gebracht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Veganismus
- 2.1. Die Begriffe vegetarisch und vegan
- 2.1.1. Mögliche Veganertypen nach Englert
- 2.2 Verbreitung
- 3. Anthropozentrismus versus Physiozentrismus
- 4. Anthropozentrische Argumente für vegane Ernährung
- 4.1 Das basic-needs-Argument
- 4.2 Das Heimat-Argument
- 4.3 Das Argument der Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen
- 4.4 Das pädagogische Argument
- 5. Probleme und Gegenargumente
- 5.1 Probleme des basic-needs-Arguments
- 5.2 Das Problem des Heimat-Arguments
- 5.3 Probleme des Arguments der Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen
- 5.4. Probleme des pädagogischen Arguments
- 6. Schlussbemerkungen und Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die vegane Ernährung aus umweltethischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung anthropozentrischer Argumente. Sie beleuchtet die Gründe für die zunehmende Beliebtheit veganer Ernährung, die verschiedenen Typen von Veganern, sowie die Argumente, die für und gegen diese Ernährungsform sprechen. Die Arbeit zielt darauf ab, die ethischen und praktischen Aspekte der veganen Ernährung aus anthropozentrischer Perspektive zu analysieren.
- Die ethische Bedeutung der veganen Ernährung im Kontext des Anthropozentrismus
- Die anthropozentrischen Argumente für und gegen vegane Ernährung
- Die Verbreitung veganer Ernährung und ihre Beweggründe
- Die verschiedenen Typen von Veganern
- Die ethischen und praktischen Herausforderungen der veganen Ernährung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des menschlichen Verhältnisses zur nicht-menschlichen Umwelt ein und zeigt die Relevanz der Frage nach einer ethischen Behandlung der Umwelt auf. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen übermäßigem Fleischkonsum und negativen Entwicklungen wie Klimawandel und ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten und erläutert die Bedeutung der veganen Ernährung in diesem Kontext.
Kapitel 2 definiert die Begriffe "vegetarisch" und "vegan" und beschreibt die verschiedenen Typen von Veganern, wie beispielsweise konsequente Veganer, Pudding-Veganer und Fruganer. Es werden auch die Verbreitung von Vegetariern und Veganern in Deutschland sowie die Gründe für den Trend zur fleischlosen Ernährung diskutiert.
Kapitel 4 untersucht anthropozentrische Argumente für vegane Ernährung, wie das "basic-needs"-Argument, das Heimat-Argument, das Argument der Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen und das pädagogische Argument. Es werden die ethischen Begründungen für eine pflanzliche Ernährung aus anthropozentrischer Perspektive beleuchtet.
Kapitel 5 widmet sich den Problemen und Gegenargumenten gegen vegane Ernährung im Kontext des Anthropozentrismus. Es analysiert die Herausforderungen der veganen Ernährung mit Blick auf die grundlegenden Bedürfnisse wie Nahrung, Gesundheit und Obdach sowie die Probleme des Heimat-Arguments und des Arguments der Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen. Ebenfalls werden die Herausforderungen des pädagogischen Arguments im Zusammenhang mit veganer Ernährung untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Umweltethik, Anthropozentrismus, Veganismus, Ernährung, Fleischkonsum, ethische Argumentation, Nachhaltigkeit, tierische Produkte, pflanzliche Ernährung, Massentierhaltung, Klimawandel und Zivilisationskrankheiten. Sie untersucht die ethischen und praktischen Implikationen der veganen Ernährung aus anthropozentrischer Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Ist vegane Ernährung aus umweltethischer Sicht sinnvoll?
Die Arbeit bejaht dies unter anderem mit Verweis auf die Reduktion von Treibhausgasen, den geringeren Ressourcenverbrauch und die Bekämpfung des Welthungers durch pflanzliche Ernährung.
Was bedeutet Anthropozentrismus in der Ernährungsethik?
Anthropozentrismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Vegane Ernährung wird hier damit begründet, dass sie die Lebensgrundlagen der heutigen und zukünftigen Menschheit schützt.
Welche anthropozentrischen Argumente sprechen für Veganismus?
Genannt werden das Basic-Needs-Argument (Welternährung), das Heimat-Argument (Schutz des Lebensraums), die Pflicht gegenüber zukünftigen Generationen und pädagogische Gründe.
Was sind typische Gegenargumente gegen eine vegane Lebensweise?
Kritikpunkte betreffen oft die praktische Umsetzbarkeit, mögliche Nährstoffmängel oder kulturelle Traditionen, die eng mit dem Fleischkonsum verknüpft sind.
Welche Veganertypen unterscheidet die Literatur?
Es wird zwischen konsequenten Veganern, sogenannten „Pudding-Veganern“ (ungesunde vegane Ernährung) und Fruganern unterschieden.
- Quote paper
- Milena Bonifert (Author), 2018, Vegane Ernährung aus der Sicht des Anthropozentrismus. Ist die vegane Ernährung aus umweltethischer Sicht sinnvoll?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418482