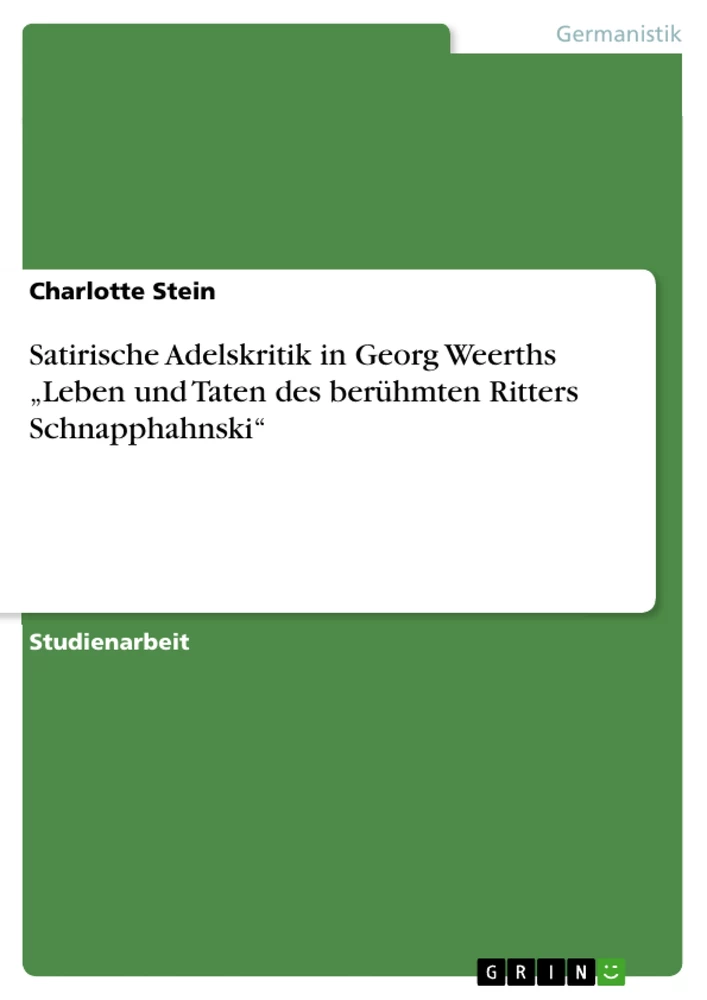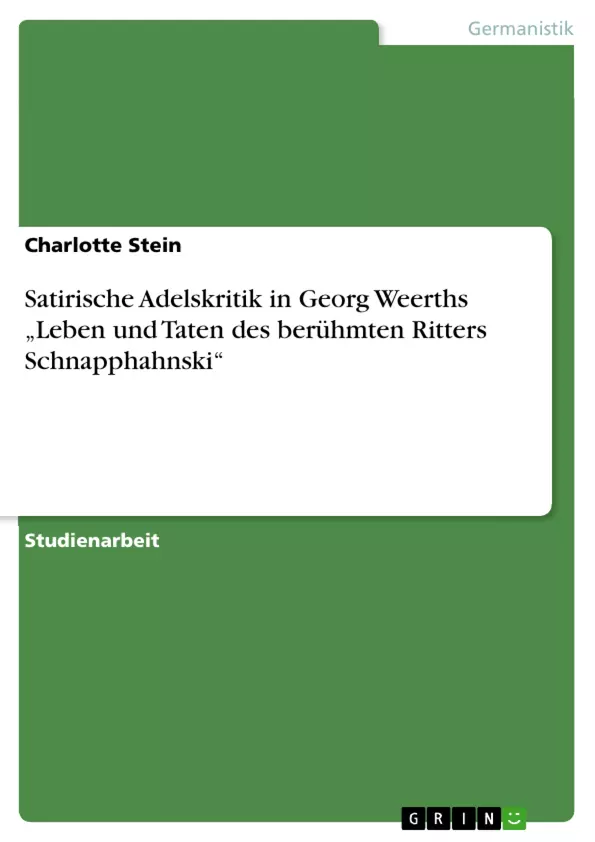Als Georg Weerth in den Jahren 1848 und 1849 seinen Feuilletonroman „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ schrieb und in der Neuen Rheinischen Zeitung veröffentlichte, befand sich die politische, ökonomische und gesellschaftliche Struktur in den deutschen Teilstaaten im Umbruch. Reformwille und Restaurationsbestrebungen standen sich gegenüber und machten Schriftstellern und Journalisten das Leben schwer. Umso bedeutender ist die Konsequenz, mit der Weerth den Adel in seinem Roman kritisierte. Ziel dieser Arbeit ist es, die satirische Adelskritik im Roman „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ herauszuarbeiten und zu analysieren. Hierfür würden sich eine Vielzahl an Ansatzpunkten anbieten, strotz das Werk doch vor analysewürdigen Vergleichen, Metaphern, Wortspielen, scheinbar funktionslosen Details, Exkursen, Intertextualität, Erzählerperspektive und Perspektivwechsel. Eine detaillierte Interpretation des gesamten Werkes ist daher an dieser Stelle nicht möglich, da sie den gebotenen Rahmen sprengen würde. Daher wird die Analyse der Adelskritik in sechs Faktoren zerteilt und untersucht. Das sich auch bei diesem Verfahren analysierte Textstellen wiederholen, ist der Vielschichtigkeit des Romans geschuldet. An diesen Stellen wurde daher auf eine erneute ausführliche Wiedergabe der Textstellen verzichtet. Die Analyse des Feuilletonromans ohne Kontextualisierung des Autors, der politischen und literaturgeschichtlichen Ereignisse und der Publikation des Romans wäre unvollständig und nicht tragbar. Daher werden einleitend der Autor und der historische und literaturgeschichtliche Kontext ausgeführt. Der Fokus liegt dabei auf Faktoren, die Georg Weerth zum politischen Satiriker gemacht haben und denen, die für Entstehung, Einordnung und Publikation des Romans wichtig sind. Da die Interpretation auf dem Einsatz von Satire und Ironie basiert, werden die hierfür notwendigen theoretischen Grundlagen im vierten Kapitel kurz eingeführt. Der dürftigen Forschung zum Roman ist geschuldet, dass die Literaturbasis dieser Arbeit auch Titel von politischen, journalistischen und literarischen Weggefährten Weerths und Abhandlungen über angrenzende Themengebiete umfasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Autor
- Rezeption, Forschung und Überlieferung
- Historischer und literaturgeschichtlicher Kontext
- Gesellschaftliche Umbrüche
- Der Adel in der Mitte des 19. Jahrhunderts
- Staatliche Zensur
- Satire und Ironie
- „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ als Bestandteil des Feuilletons der Neuen Rheinischen Zeitung
- Publikation des Romans
- Der Schnapphahnski-Roman als Adelssatire
- Ironie in Romanstruktur, Titel und Personal
- Kritik an der Verortung des Adels an der Spitze der ständischen Gesellschaft
- Kritik am nichtarbeitenden Adel
- Adliges Selbstverständnis
- Eigene Rechtswelt des Adels
- Explizite politische Kritik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Analyse der satirischen Kritik am Adel im Roman „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ von Georg Weerth. Die Arbeit untersucht, wie Weerth die gesellschaftliche, politische und ökonomische Position des Adels im Kontext der politischen und sozialen Umbrüche des Vormärz durch die Verwendung von Satire und Ironie kritisiert.
- Der Roman als satirische Darstellung des Adels und seiner Privilegien
- Weerths literarische Strategie, die Ironie als Mittel der Kritik einzusetzen
- Der Einfluss des historischen und literaturgeschichtlichen Kontextes auf Weerths Werk
- Die Rolle des Romans im Kontext der politischen und sozialen Veränderungen des Vormärz
- Die Bedeutung des Romans für das Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen und literaturgeschichtlichen Kontext von Georg Weerths Roman „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ dar und beleuchtet die politische und soziale Situation des Vormärz. Sie führt den Leser in die Thematik der Adelskritik im Roman ein und erläutert den Ansatz der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Autor Georg Weerth, seiner Biografie, seinen literarischen Anfängen und seiner Politisierung. Es beleuchtet den Einfluss von Weerths Erfahrungen auf sein Schreiben und die Entwicklung seiner kritischen Haltung.
Das dritte Kapitel behandelt den historischen und literaturgeschichtlichen Kontext des Romans. Es analysiert die gesellschaftlichen Umbrüche des Vormärz, die Rolle des Adels in der Gesellschaft und die staatliche Zensur, die den Literaten des Vormärz entgegenstand.
Das vierte Kapitel führt in die theoretischen Grundlagen von Satire und Ironie ein. Es erläutert die Funktionsweise dieser literarischen Mittel und ihre Bedeutung für Weerths Kritik am Adel.
Das fünfte Kapitel beschreibt die Veröffentlichung des Romans „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ in der Neuen Rheinischen Zeitung. Es beleuchtet die Rolle des Romans im Kontext des politischen Kampfes des Vormärz und die Bedeutung des Feuilletons als Plattform für politische Kritik.
Das sechste Kapitel analysiert den Roman „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“ als Adelssatire. Es untersucht die Ironie in Romanstruktur, Titel und Personal, die Kritik an der Verortung des Adels an der Spitze der ständischen Gesellschaft, die Kritik am nichtarbeitenden Adel, das adlige Selbstverständnis, die eigene Rechtswelt des Adels und die explizite politische Kritik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Georg Weerth, Vormärz, Adelskritik, Satire, Ironie, "Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski", Neue Rheinische Zeitung, Feuilleton, gesellschaftliche Umbrüche, ständische Gesellschaft, Privilegien, politische Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Georg Weerth?
Georg Weerth war ein politischer Satiriker und Journalist des Vormärz, der eng mit der Neuen Rheinischen Zeitung verbunden war.
Worum geht es in "Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski"?
Der Feuilletonroman ist eine scharfe Satire auf den Adel, die dessen Privilegien, Nichtstun und Standesdünkel im 19. Jahrhundert kritisiert.
Warum nutzte Weerth Satire und Ironie als literarisches Mittel?
Satire ermöglichte es ihm, politische Kritik an der ständischen Gesellschaft zu üben und gleichzeitig die staatliche Zensur des Vormärz zu umgehen.
Welche Rolle spielte der Adel im 19. Jahrhundert laut Weerth?
Weerth kritisierte den Adel als eine nichtarbeitende Klasse, die trotz gesellschaftlicher Umbrüche an ihren veralteten Vorrechten und einer eigenen Rechtswelt festhielt.
Was war der historische Kontext des Romans?
Der Roman entstand während der Revolution 1848/49, einer Zeit des Umbruchs zwischen Reformwillen und Restaurationsbestrebungen in den deutschen Staaten.
- Citar trabajo
- Charlotte Stein (Autor), 2017, Satirische Adelskritik in Georg Weerths „Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418724