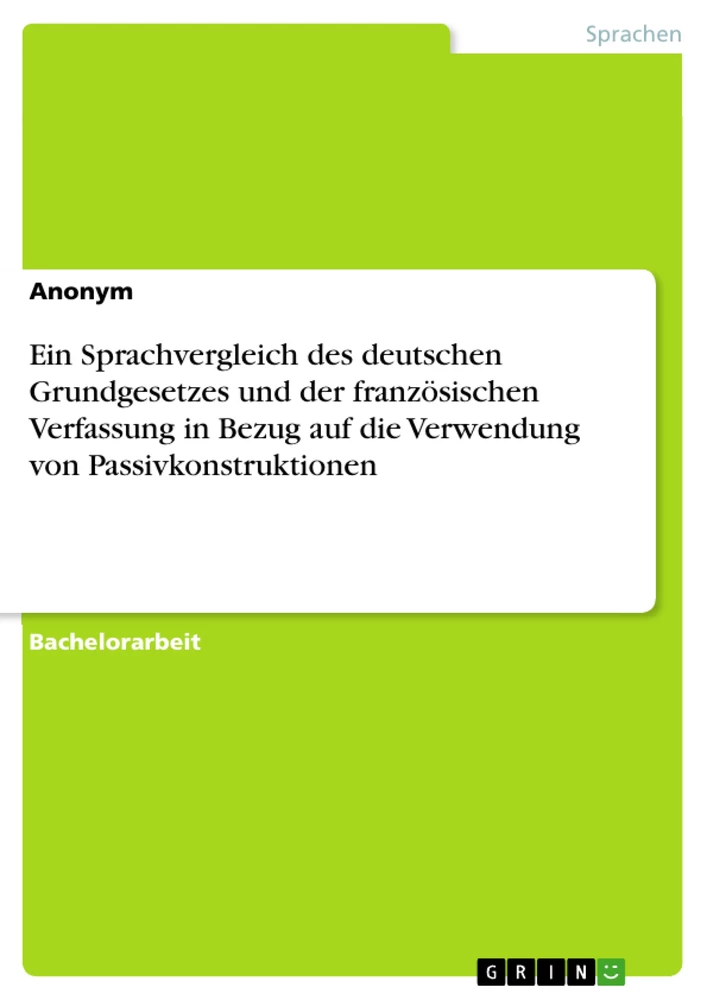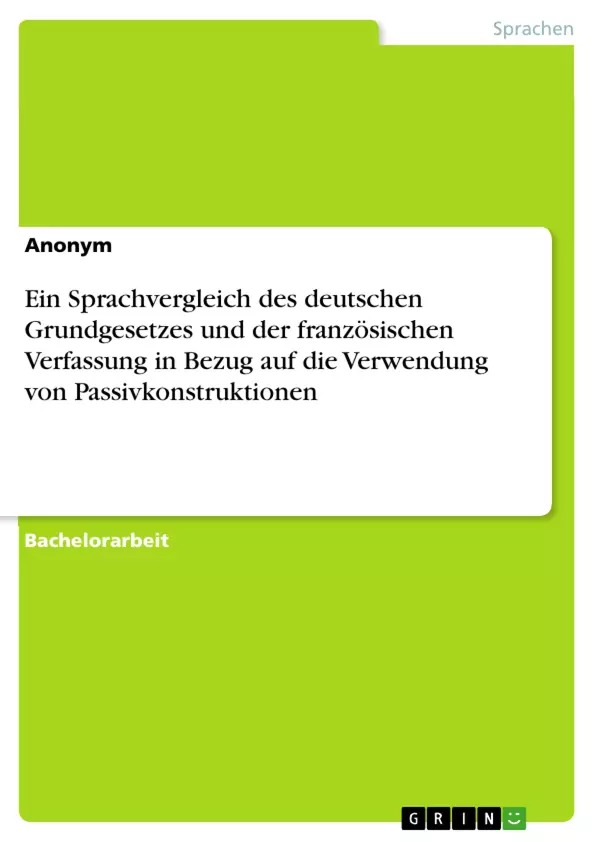Wer sich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schon einmal durchgelesen hat, dem müsste eines sicherlich aufgefallen sein: Es befinden sich dort sehr viele passivische Konstruktionen. Doch wieso ist das so? Wieso werden Passivkonstruktionen im deutschen Grundgesetz Aktivkonstruktionen in vielen Fällen vorgezogen? Und was genau macht Passivkonstruktionen eigentlich aus? Wird das Passiv nur im Deutschen so häufig verwendet oder ist die häufige Verwendung des Passivs auch in der französischen Verfassung vorzufinden?
Um auf all diese Fragen eine Antwort finden zu können, wird in der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit zunächst das Passiv in der deutschen Sprache beleuchtet. Es werden die verschiedenen Arten des Passivs und deren Funktionen erläutert. Im Anschluss folgt eine Darstellung des sprachlichen Phänomens des Passivs in der französischen Sprache.
Darauf folgen zunächst einige juristische Hintergrundinformationen zum deutschen Grundgesetz und schließlich eine Analyse dessen, und zwar im Hinblick auf die Passivfrequenz. Da es Ziel dieser Arbeit ist, das deutsche Grundgesetz mit der französischen Verfassung zu vergleichen, wird dann die französische Verfassung ebenfalls im Hinblick auf die Verwendung des Passivs analysiert. Auch hier werden zunächst einige Hintergrundinformationen zur Rolle der französischen Verfassung dargestellt. In einer abschließenden Gegenüberstellung der Analyseergebnisse findet schließlich der Sprachvergleich des deutschen Grundgesetzes und der französischen Verfassung in Bezug auf die Verwendung von Passivkonstruktionen statt.
Abschließend werden in einem Fazit die Ergebnisse des Sprachvergleichs zusammenfassend dargestellt.
Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, die Verwendung des Passivs im deutschen Grundgesetz und in der französischen Verfassung zu analysieren und herauszufinden, ob es vielleicht Unterschiede bezüglich der Passivverwendung in den beiden Sprachen Deutsch und Französisch gibt. Wird in der einen Sprache das Passiv möglicherweise häufiger verwendet? Oder finden sich in beiden Sprachen in etwa gleich viele Passivkonstruktionen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Passiv im Deutschen
- 2.1 Standardpassiv
- 2.1.1 Vorgangspassiv
- 2.1.2 Zustandspassiv
- 2.1.3 Rezipientenpassiv
- 2.2 Passiversatzformen
- 2.3 Funktionen des Passivs
- 2.1 Standardpassiv
- 3. Passiv im Französischen
- 3.1 Standardpassiv
- 3.2 Passiversatzformen
- 3.3 Funktionen des Passivs
- 4. Passiv im deutschen Grundgesetz
- 4.1 Das deutsche Grundgesetz
- 4.2 Passivfrequenz
- 5. Passiv in der französischen Verfassung
- 5.1 Die französische Verfassung
- 5.2 Passivfrequenz
- 6. Sprachvergleich
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Verwendung von Passivkonstruktionen im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Ziel ist der Vergleich der Passivfrequenz in beiden Texten und die Analyse möglicher Unterschiede in der Verwendung des Passivs zwischen Deutsch und Französisch. Die Arbeit konzentriert sich auf die Häufigkeit des Passivs, nicht auf einen Vergleich mit Aktivkonstruktionen.
- Analyse des Passivs im Deutschen und Französischen
- Untersuchung der Passivfrequenz im deutschen Grundgesetz
- Untersuchung der Passivfrequenz in der französischen Verfassung
- Sprachvergleich der Passivverwendung in beiden Verfassungen
- Identifizierung möglicher sprachlicher Unterschiede bezüglich der Passivpräferenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Häufigkeit und den Gründen für die Verwendung von Passivkonstruktionen im deutschen Grundgesetz im Vergleich zur französischen Verfassung. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und erklärt den Fokus auf das Passiv ohne detaillierten Vergleich mit dem Aktiv. Die Arbeit beschränkt sich auf häufig vorkommende Passivkonstruktionen aufgrund des begrenzten Umfangs.
2. Passiv im Deutschen: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in das deutsche Passiv. Es erläutert den Begriff „Genus verbi“, unterscheidet zwischen Aktiv und Passiv, beschreibt verschiedene Passivformen (Vorgangs-, Zustandspassiv etc.) und deren Funktionen. Es wird der Unterschied zwischen syntaktischem Subjekt und Agens beleuchtet, und die Möglichkeit, das Agens im Passiv durch Präpositionen wie „von“ oder „durch“ auszudrücken, wird erklärt. Der Begriff „Passiv“ wird weit gefasst und umfasst auch Passiversatzformen.
3. Passiv im Französischen: Ähnlich wie Kapitel 2, aber bezogen auf das Französische. Dieses Kapitel beschreibt das französische Passiv, seine verschiedenen Formen und Funktionen, im Vergleich zum deutschen Passiv. Es beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bildung und Verwendung des Passivs zwischen beiden Sprachen, um den späteren Vergleich zu ermöglichen.
4. Passiv im deutschen Grundgesetz: Dieses Kapitel liefert juristische Hintergrundinformationen zum deutschen Grundgesetz und analysiert die Frequenz des Passivs darin. Es untersucht, wie oft Passivkonstruktionen verwendet werden und welche Rolle sie im juristischen Kontext spielen. Die Ergebnisse dieser Analyse werden später im Vergleich mit der französischen Verfassung verwendet.
5. Passiv in der französischen Verfassung: Analog zu Kapitel 4, aber mit Fokus auf die französische Verfassung. Dieses Kapitel bietet Hintergrundinformationen zur französischen Verfassung und analysiert die Häufigkeit von Passivkonstruktionen in diesem Text. Die Analyse deckt die Verwendung und Funktion des Passivs im französischen Verfassungstext ab, um den späteren Vergleich mit dem deutschen Grundgesetz vorzubereiten.
6. Sprachvergleich: Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der vorherigen Analysen gegenüber. Es vergleicht die Passivfrequenz im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung und analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Verwendung des Passivs in beiden Sprachen und Texttypen. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit.
Schlüsselwörter
Passiv, Aktiv, Genus verbi, Grundgesetz, französische Verfassung, Sprachvergleich, Passivfrequenz, Deutsch, Französisch, Rechtslinguistik, Juristische Sprache.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Passiv im Deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Verwendung des Passivs im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Passivfrequenz in beiden Texten und der Analyse möglicher Unterschiede in der Verwendung des Passivs zwischen Deutsch und Französisch. Ein detaillierter Vergleich mit Aktivkonstruktionen findet nicht statt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Passiv im Deutschen, Passiv im Französischen, Passiv im deutschen Grundgesetz, Passiv in der französischen Verfassung, Sprachvergleich und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Passivverwendung, beginnend mit einer Einführung in das Passiv in beiden Sprachen, gefolgt von der Analyse der Passivfrequenz in den jeweiligen Verfassungen und schliesslich einem Vergleich der Ergebnisse.
Wie wird das Passiv in der Arbeit definiert?
Der Begriff „Passiv“ wird weit gefasst und umfasst neben den Standardpassivformen auch Passiversatzformen. Die Arbeit berücksichtigt verschiedene Arten des Passivs (z.B. Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Rezipientenpassiv im Deutschen).
Welche Aspekte des Passivs werden im Detail untersucht?
Die Arbeit analysiert die Häufigkeit des Passivs (Passivfrequenz) im deutschen Grundgesetz und in der französischen Verfassung. Sie untersucht auch die Funktionen des Passivs in beiden Sprachen und Texttypen und vergleicht die Ergebnisse, um mögliche sprachliche Unterschiede in der Passivpräferenz aufzuzeigen.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Passivverwendung im Deutschen und Französischen, speziell im Kontext des deutschen Grundgesetzes und der französischen Verfassung.
Welche Textsorten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert juristische Texte: das deutsche Grundgesetz und die französische Verfassung.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine quantitative Methode, indem sie die Frequenz von Passivkonstruktionen in den beiden Verfassungen zählt und vergleicht. Qualitative Aspekte der Passivverwendung werden ebenfalls berücksichtigt, um die Ergebnisse zu interpretieren.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse des Sprachvergleichs zusammen und diskutiert mögliche Erklärungen für die beobachteten Unterschiede in der Passivfrequenz und -verwendung zwischen dem deutschen und dem französischen Verfassungstext. Der begrenzte Umfang der Arbeit wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Passiv, Aktiv, Genus verbi, Grundgesetz, französische Verfassung, Sprachvergleich, Passivfrequenz, Deutsch, Französisch, Rechtslinguistik, Juristische Sprache.
Wo finde ich die detaillierte Analyse des Passivs in den einzelnen Sprachen?
Kapitel 2 beschreibt detailliert das Passiv im Deutschen, während Kapitel 3 das Passiv im Französischen behandelt. Diese Kapitel erläutern die verschiedenen Passivformen und deren Funktionen in den jeweiligen Sprachen.
Welche Rolle spielt das Agens im Passiv?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Agens (Handelnden) im Passiv und die Möglichkeit, es durch Präpositionen wie "von" oder "durch" auszudrücken (im Deutschen).
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Ein Sprachvergleich des deutschen Grundgesetzes und der französischen Verfassung in Bezug auf die Verwendung von Passivkonstruktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418742