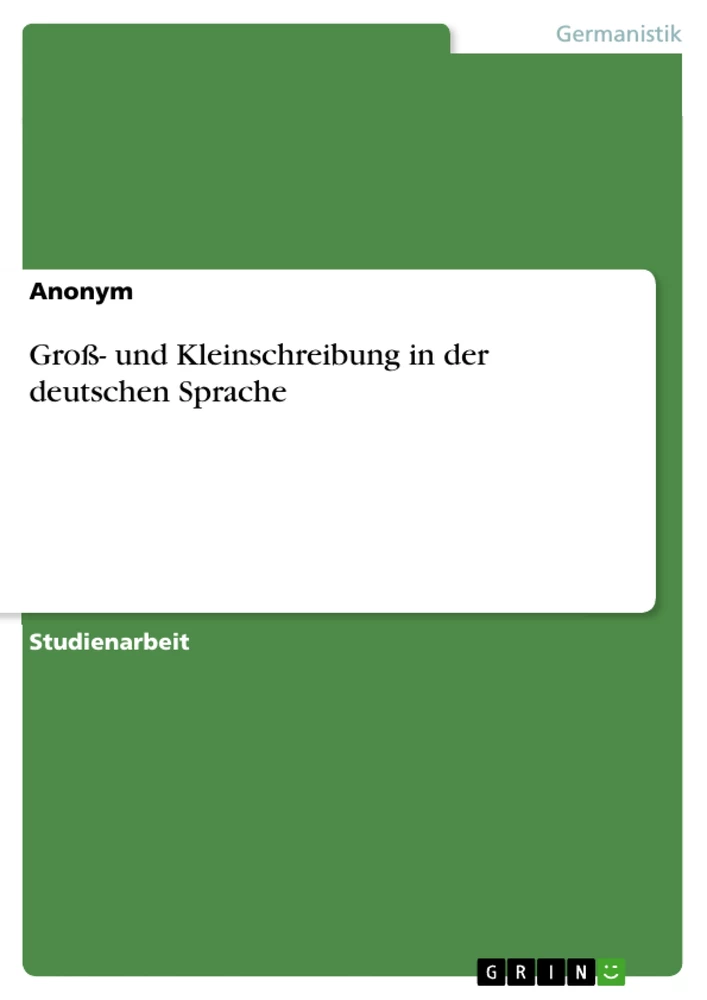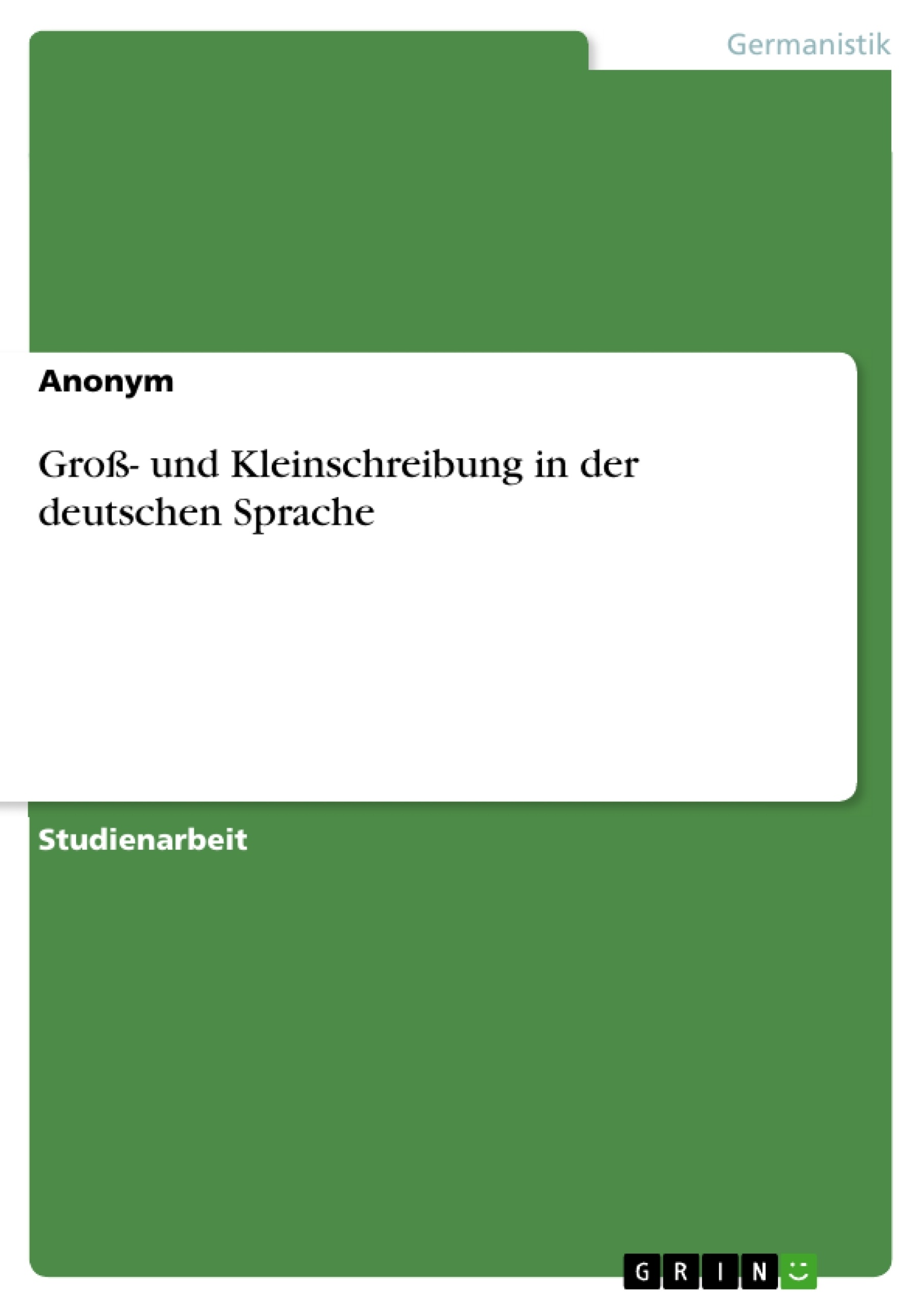Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema: „Groß-und Kleinschreibung in der deutschen Sprache“. Orthographie ist ein aktuelles Thema, da sie immer wieder medial thematisiert wird . Außerdem ist sie ein wichtiger Bestandteil der schulischen Lehrpläne. Daher ist es relevant, dieses Gebiet zu vertiefen.
Diese Arbeit gibt werde als Erstes eine kurze Definition zur Orthographie, da die Groß-und Kleinschreibung ein Teilgebiet dieser darstellt. Als Zweites werden zwei Grammatiken betrachtet. Dieser Teil wird zugleich den Schwerpunkt dieser Arbeit bilden. Hierbei werden zwei Werke als Grundlage genommen und diese hinsichtlich der Groß-und Kleinschreibung dargestellt. Zusätzlich werden noch zwei andere Grammatiken herangezogen, um Kontraste zu verdeutlichen. Zuletzt werden diese Werke in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Orthographie
- Groß- und Kleinschreibung in ausgewählten Werken
- Groß- und Kleinschreibung im Duden/Eisenberg
- Groß- und Kleinschreibung bei Fuhrhop
- Groß- und Kleinschreibung bei anderen Autoren
- Fehlerbereiche der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Groß- und Kleinschreibung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene grammatikalische Ansätze und vergleicht die Darstellung dieses Themas in unterschiedlichen Grammatiken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung typischer Fehler von Schülern im Umgang mit Groß- und Kleinschreibung.
- Definition und Einordnung der Orthographie
- Vergleichende Analyse der Groß- und Kleinschreibung in verschiedenen Grammatiken (Duden/Eisenberg, Fuhrhop, Heller)
- Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Regeln
- Analyse typischer Schülerfehler im Bereich der Groß- und Kleinschreibung
- Zusammenfassende Bewertung der behandelten Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Groß- und Kleinschreibung ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext von Medienberichterstattung, schulischen Lehrplänen und den Schwierigkeiten von Schülern im Umgang mit diesen Regeln. Die Autorin begründet ihre Arbeit mit ihrer Erfahrung in der Nachhilfe und dem Wunsch, ihr eigenes Wissen aufzufrischen.
Definition: Orthographie: Dieses Kapitel liefert eine prägnante Definition von Orthographie als Lehre der systematischen und einheitlichen Verschriftung von Sprache. Es wird auf die historische Entwicklung der Rechtschreibregeln in Deutschland eingegangen und die Willkürlichkeit von Orthographienormierungen hervorgehoben. Die Bedeutung der Einheitlichkeit und Systematik, erstmals durch die Rechtschreibe-Konferenzen etabliert, wird betont, sowie die Entwicklung des Duden-Wörterbuchs als ein Beispiel für die Normierung der deutschen Sprache.
Groß- und Kleinschreibung in ausgewählten Werken: Dieser Abschnitt vergleicht die Darstellung der Groß- und Kleinschreibung in verschiedenen Grammatiken. Der Duden/Eisenberg wird als Ausgangspunkt genommen und seine knappe, in vier Unterpunkte gegliederte Erklärung vorgestellt. Im Kontrast dazu wird Eisenbergs detailliertere Darstellung im „Grundriss der deutschen Grammatik“ analysiert, die tiefer in die historische Entwicklung und die Problematik der Substantivgroßschreibung eingeht. Die Autorin hebt die Unterschiede in der Ausführlichkeit und der didaktischen Herangehensweise hervor.
Groß- und Kleinschreibung bei Fuhrhop: Dieses Kapitel behandelt Fuhrhops Darstellung der Groß- und Kleinschreibung, die in ihrer Ausführlichkeit mit Eisenbergs „Grundriss“ vergleichbar ist. Fuhrhops Ansatz wird näher beleuchtet, insbesondere ihre Unterscheidung zwischen lexikalisch-morphologischen und syntaktischen Eigenschaften von Substantiven und ihre Argumentation für die Substantivgroßschreibung im Deutschen, welche auf historische Entwicklung, Lesbarkeitsverbesserung und die Erkennung von Nominalgruppen zielt.
Groß- und Kleinschreibung bei anderen Autoren (Heller): Der Abschnitt vergleicht die Ansätze von Eisenberg und Fuhrhop mit dem Werk Hellers. Hellers Herangehensweise an die Thematik wird kurz skizziert, wobei der Fokus auf seiner Strukturierung in Unterpunkte und die Einbeziehung von Beispielen gelegt wird. Ein Vergleich mit den zuvor besprochenen Ansätzen bleibt hier implizit.
Schlüsselwörter
Orthographie, Groß- und Kleinschreibung, deutsche Grammatik, Duden, Eisenberg, Fuhrhop, Heller, Substantivgroßschreibung, Eigennamen, Schülerfehler, Rechtschreibung, Normierung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Groß- und Kleinschreibung im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen. Sie vergleicht verschiedene grammatikalische Ansätze und deren Darstellung in unterschiedlichen Grammatiken (Duden/Eisenberg, Fuhrhop, Heller). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse typischer Schülerfehler in diesem Bereich.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung der Groß- und Kleinschreibung im Duden/Eisenberg, bei Fuhrhop und bei Heller. Der Fokus liegt auf den Unterschieden in der Ausführlichkeit, der didaktischen Herangehensweise und der Argumentation für die Substantivgroßschreibung.
Wie wird der Duden/Eisenberg in der Arbeit behandelt?
Der Duden/Eisenberg dient als Ausgangspunkt des Vergleichs. Seine knappe, vier Punkte umfassende Erklärung wird vorgestellt und mit den detaillierteren Darstellungen anderer Autoren kontrastiert.
Wie wird Fuhrhops Ansatz dargestellt?
Fuhrhops Ansatz wird ausführlich behandelt, insbesondere ihre Unterscheidung zwischen lexikalisch-morphologischen und syntaktischen Eigenschaften von Substantiven und ihre Argumentation für die Substantivgroßschreibung basierend auf historischer Entwicklung, Lesbarkeit und der Erkennung von Nominalgruppen.
Wie wird Hellers Ansatz behandelt?
Hellers Herangehensweise wird kurz skizziert, mit Fokus auf Strukturierung und Beispielen. Ein Vergleich mit Eisenberg und Fuhrhop bleibt implizit.
Welche Schülerfehler werden analysiert?
Die Arbeit identifiziert und analysiert typische Fehler von Schülern im Umgang mit der Groß- und Kleinschreibung, ohne jedoch konkrete Fehlerbeispiele im Detail zu nennen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Orthographie, ein Kapitel zum Vergleich der Groß- und Kleinschreibung in ausgewählten Werken (Duden/Eisenberg, Fuhrhop, Heller), ein Kapitel zu Schülerfehlern und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Orthographie, Groß- und Kleinschreibung, deutsche Grammatik, Duden, Eisenberg, Fuhrhop, Heller, Substantivgroßschreibung, Eigennamen, Schülerfehler, Rechtschreibung, Normierung.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Ansätze zur Groß- und Kleinschreibung im Deutschen zu vergleichen und die typischen Fehler von Schülern in diesem Bereich zu identifizieren. Die Autorin begründet ihre Arbeit mit ihrer Erfahrung in der Nachhilfe und dem Wunsch, ihr eigenes Wissen aufzufrischen.
Wie wird die Definition von Orthographie behandelt?
Das Kapitel zur Definition von Orthographie liefert eine prägnante Definition und beleuchtet die historische Entwicklung der Rechtschreibregeln in Deutschland, die Willkürlichkeit von Normierungen und die Bedeutung von Einheitlichkeit und Systematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Groß- und Kleinschreibung in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418758