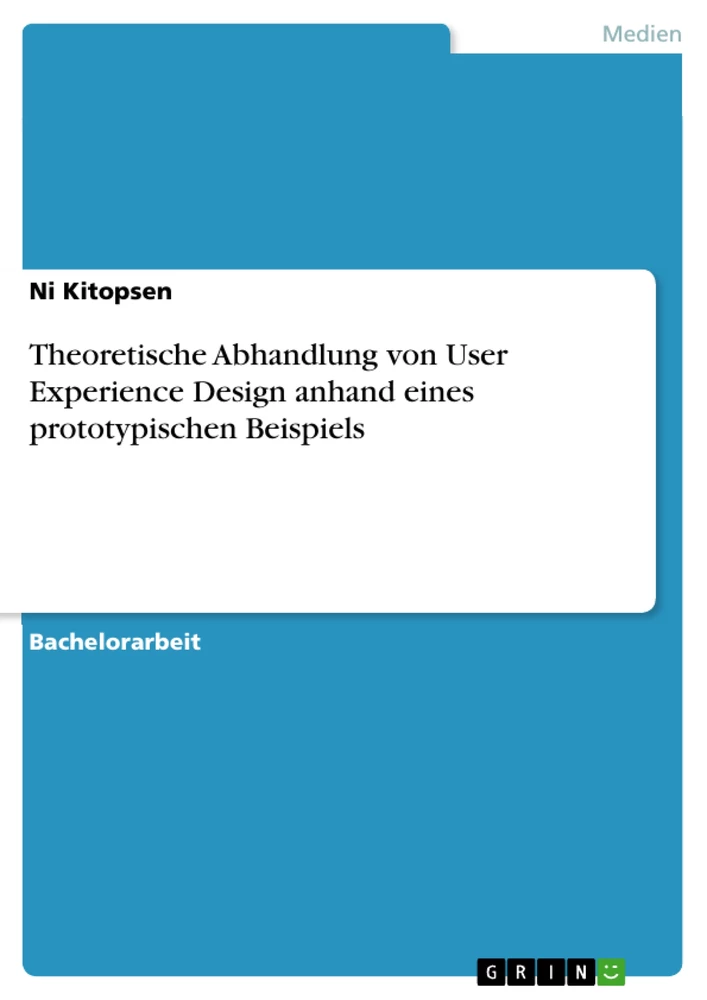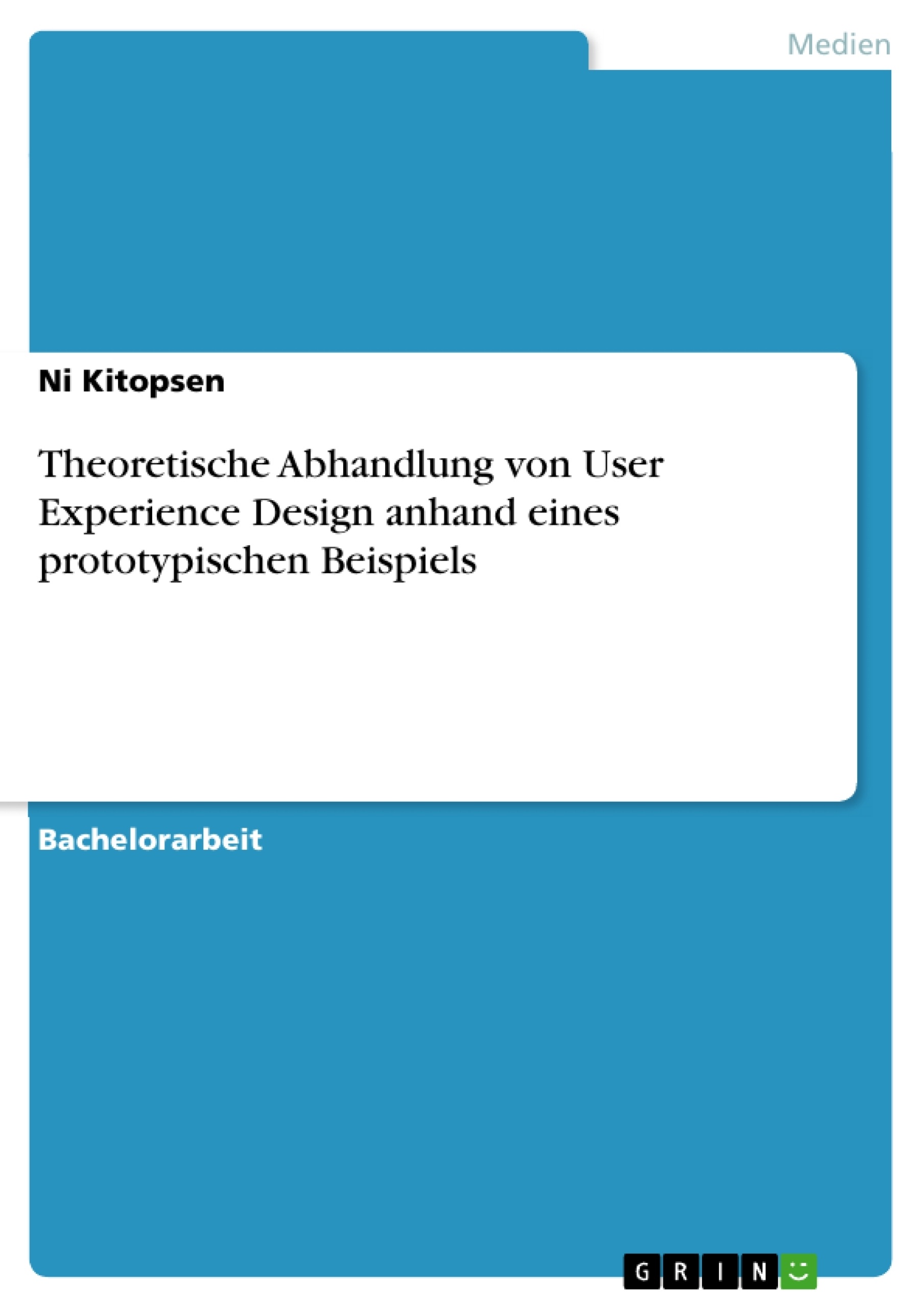Das Design von Produkten war stets ein relevanter Aspekt in der Produktgestaltung. In der heutigen Zeit, aufgrund geringer qualitativer Differenzen zu Konkurrenzprodukten, gewinnt der Aspekt des Designs mehr und mehr an Bedeutung und kann so für die Kaufentscheidung ausschlaggebend sein. Diesbezüglich stellt sich die Frage, weshalb das Design einen so hohen Stellenwert hat und ob geeignete Richtlinien für die Entwicklung eines Produktdesigns existieren, welches dem Endnutzer eine User Experience ermöglicht.
Um diese Frage zu beantworten, wird in dieser Bachelorarbeit zunächst auf verschiedene Konzepte des User Experience Designs eingegangen und miteinander verglichen. Das Evaluationsergebnis einer prototypischen Mobile‐App, die ebenfalls in dieser Arbeit vorgestellt wird, soll zeigen, dass diese Konzepte als Richtlinie für eine erfolgreiche Produktentwicklung unzureichend sind. Infolgedessen setzt sich die Ausarbeitung zudem mit der Gestaltpsychologie auseinander, um die Evaluationsergebnisse aus gestaltpsychologischer Sicht begründen zu können und eine mögliche Richtlinie für das Erstellen einer User Experience zu ermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 2. User Experience Design
- 2.2 User Experience Design nach Hassenzahl
- 2.2.1 Wesen von Experience
- 2.2.2 Wesen von Experience in Bezug zur Produkterstellung
- 2.2.2.1 Erlebnisse sind selbstbestimmend
- 2.2.2.2 Erlebnisse machen fröhlicher
- 2.2.2.3 Erlebnisse motivieren
- 2.2.3 Types of Experiences
- 2.2.4 Wesen des User Experience Design
- 2.2.5 Arbeitsmodell zur Entstehung des Eindrucks der Attraktivität beim Benutzer und der möglichen Konsequenzen des Attraktivitätseindrucks
- 2.3 Andersons User Experience Hierarchy of Needs Modell
- 2.4 Fogg Behavior Modell
- 2.4.1 Motivation
- 2.4.1.2 Fähigkeit (ability)
- 2.4.1.3 Auslöser (trigger)
- 2.5 Stellungnahme zu den Konzepten
- 3. Goods-2-Go: Prototyp einer mobilen Anwendung
- 3.1 Definition Goods-2-Go
- 3.2 System von Goods-2-Go
- 3.3 Evaluation
- 3.3.1 Definition AttrakDiff
- 3.3.2 Evaluationsergebnisse
- 3.3.2.1 Profil der Wortpaare
- 3.3.2.2 Diagramm der Mittelwerte
- 3.3.2.3 Stellungnahme zu den Ergebnissen
- 3.3.3 Ergebnisüberblick
- 3.3.3.1 Beurteilung der pragmatischen Qualität
- 3.3.3.2 Beurteilung der hedonischen Qualität (Identität)
- 3.3.3.3 Beurteilung der hedonischen Qualität (Stimulation)
- 3.3.3-4 Beurteilung der Attraktivität
- 3.3.3.5 Fazit
- Untersuchung verschiedener Konzepte des User Experience Designs
- Bewertung der Konzepte anhand der AttrakDiff-Methode
- Analyse der Ergebnisse aus gestaltpsychologischer Perspektive
- Erstellung einer möglichen Richtlinie für das Erstellen einer User Experience
- Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem User Experience Design und untersucht, wie verschiedene Konzepte zur Entwicklung einer erfolgreichen User Experience beitragen können. Die Arbeit analysiert die Konzepte von Hassenzahl, Andersons User Experience Hierarchy of Needs Modell und dem Fogg Behavior Modell und setzt sie im Kontext einer prototypischen Mobile-App, Goods-2-Go, in Beziehung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung dieser Arbeit motiviert die Beschäftigung mit dem Thema User Experience Design und legt den Fokus auf die Relevanz des Designs in der heutigen Zeit.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit verschiedenen Konzepten des User Experience Designs. Es werden die Modelle von Hassenzahl, Andersons User Experience Hierarchy of Needs Modell und das Fogg Behavior Modell vorgestellt und ihre Eigenschaften und Funktionsweisen erläutert.
Kapitel 3 stellt den Prototyp einer mobilen Anwendung, Goods-2-Go, vor und beschreibt seine Funktionsweise und die durchgeführte Evaluation mithilfe der AttrakDiff-Methode.
Schlüsselwörter
User Experience Design, AttrakDiff, Fogg Behavior Modell, Andersons User Experience Hierarchy of Needs Modell, Mobile App, Goods-2-Go, Gestaltpsychologie
- Citation du texte
- Ni Kitopsen (Auteur), 2013, Theoretische Abhandlung von User Experience Design anhand eines prototypischen Beispiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419034