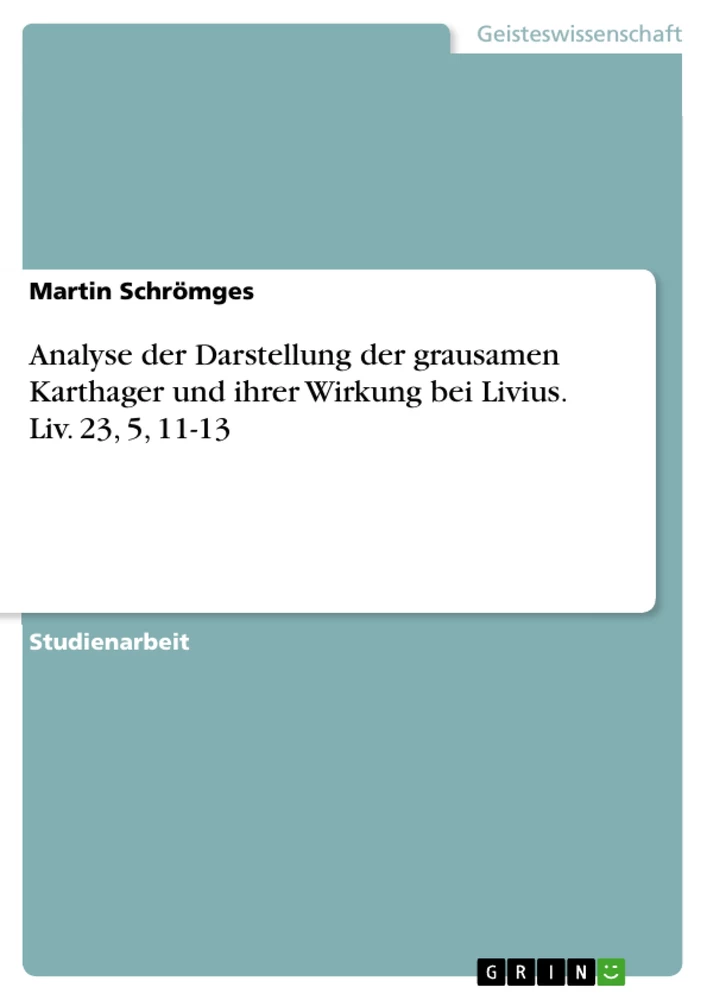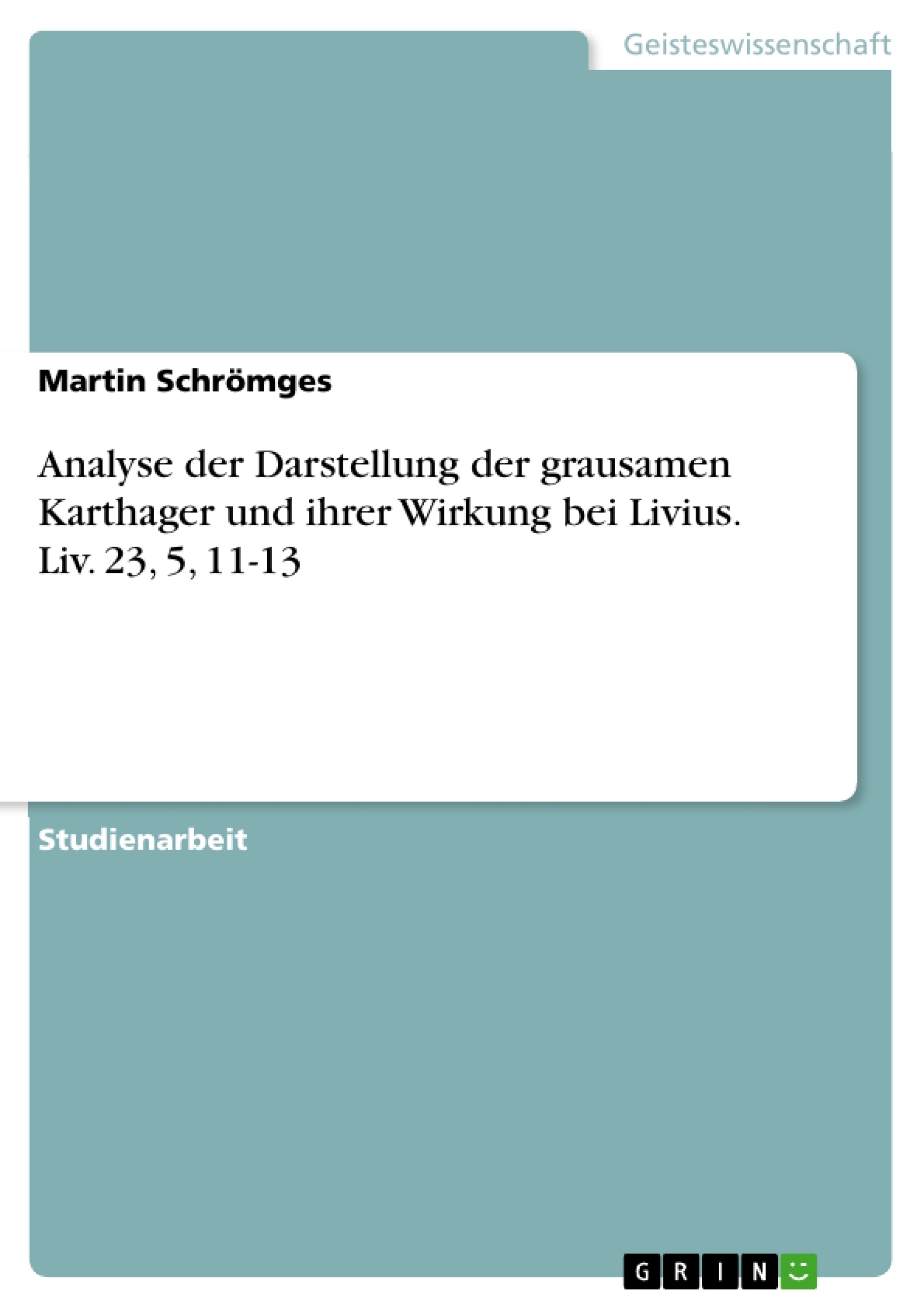Die dritte Dekade des Werkes behandelt die Geschehnisse des zweiten punischen Krieges. Die ausgewählte Textstelle 23, 5, 11–13 lässt sich historisch wie folgt einordnen: wir befinden uns in der zweiten Hälfte bzw. am Ende des Jahres 216. Das vorangegangene Buch endet damit, dass das röm. Heer eine schwere Niederlage in der Schlacht bei Cannae verkraften muss. Dazu kommt die Rückkehr des Konsuls Gaius Terentius Varro nach Rom, der, obwohl Livius ihm die Verantwortung für die Geschehnisse bei Cannae ankreidet, dankbar begrüßt wird. Dadurch, dass Hannibal sich der für die Getreideversorgung wichtigen Gegend um Kampanien bemächtigt hat und kurz davor war die Stadt Capua unter seine Herrschaft zu bringen, hat Rom wichtige Bundesgenossen verloren. Varro hat schließlich eine Gesandtschaft aus Capua empfangen, vor der er eine Rede hält, um die Bundesgenossen dazu zubringen Rom weiterhin im Kampf gegen Hannibal zu unterstützen (Liv 23, 5, 4–15).
Interessant ist es nun, die angegebene Textstelle in Bezug auf ihre Wirkung der grausamen Darstellung der Punier innerhalb der Rede Varro´s und der Atmosphäre, die sie erzeugt, zu analysieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Übersetzung der Textstelle 23, 5, 11–13
- Analyse und Interpretation
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse befasst sich mit einer ausgewählten Textstelle aus Titus Livius’ „Ab urbe condita“, der dritten Dekade des Werkes. Im Fokus steht die Analyse und Interpretation einer Rede des römischen Konsuls Gaius Terentius Varro, die er an eine Gesandtschaft aus Capua hält. Die Rede soll die Kampaner dazu bewegen, Rom im Kampf gegen Hannibal zu unterstützen.
- Analyse der rhetorischen Mittel in Varro’s Rede
- Darstellung der Karthager in der Antike
- Untersuchung der historischen Hintergründe der Rede
- Vergleich mit anderen Quellen der Antike
- Bewertung der Glaubwürdigkeit der Rede
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Werk „Ab urbe condita“ von Titus Livius vor und ordnet die ausgewählte Textstelle 23, 5, 11-13 in den historischen Kontext des zweiten punischen Krieges ein. Die Einleitung beleuchtet die Situation nach der Niederlage der Römer in der Schlacht bei Cannae und die Rolle des Konsuls Gaius Terentius Varro.
Hauptteil
Übersetzung der Textstelle 23, 5, 11–13
Dieser Abschnitt präsentiert eine Übersetzung der ausgewählten Textstelle, die Varro’s Rede vor der Gesandtschaft aus Capua wiedergibt.
Analyse und Interpretation
Die Analyse und Interpretation der Textstelle beleuchtet Varro’s Rhetorik, die Darstellung der Karthager und die politische Situation zu dieser Zeit. Insbesondere wird untersucht, wie Varro die Karthager als barbarisch und grausam darstellt, um die Kampaner auf die Seite Roms zu ziehen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter der Analyse sind: Titus Livius, „Ab urbe condita“, zweiter punischer Krieg, Gaius Terentius Varro, Hannibal, Karthager, Capua, Rhetorik, Propaganda, historische Quellen, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kontext von Livius 23, 5, 11-13?
Die Textstelle spielt im Jahr 216 v. Chr., kurz nach der verheerenden römischen Niederlage gegen Hannibal in der Schlacht bei Cannae während des Zweiten Punischen Krieges.
Warum hielt Konsul Varro eine Rede vor der Gesandtschaft aus Capua?
Varro versuchte, die Bundesgenossen in Capua davon zu überzeugen, Rom trotz der militärischen Rückschläge weiterhin im Kampf gegen die Karthager zu unterstützen.
Wie stellt Livius die Karthager in diesem Abschnitt dar?
Die Karthager werden als grausam und barbarisch charakterisiert, was als rhetorisches Mittel der Propaganda dient, um Abscheu zu erzeugen und die Loyalität der Bundesgenossen zu sichern.
Welche Rolle spielt die Rhetorik in Varros Rede?
Varro nutzt emotionale Appelle und die Dämonisierung des Gegners, um von seiner eigenen Mitverantwortung an der Niederlage bei Cannae abzulenken und politischen Druck auf Capua auszuüben.
Ist die Darstellung bei Livius als historisch objektiv anzusehen?
Nein, Livius’ Werk ist stark von einer römisch-zentrierten Sichtweise geprägt und verfolgt oft moralische und patriotische Ziele, was bei der Interpretation berücksichtigt werden muss.
- Citation du texte
- Martin Schrömges (Auteur), 2016, Analyse der Darstellung der grausamen Karthager und ihrer Wirkung bei Livius. Liv. 23, 5, 11-13, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419280