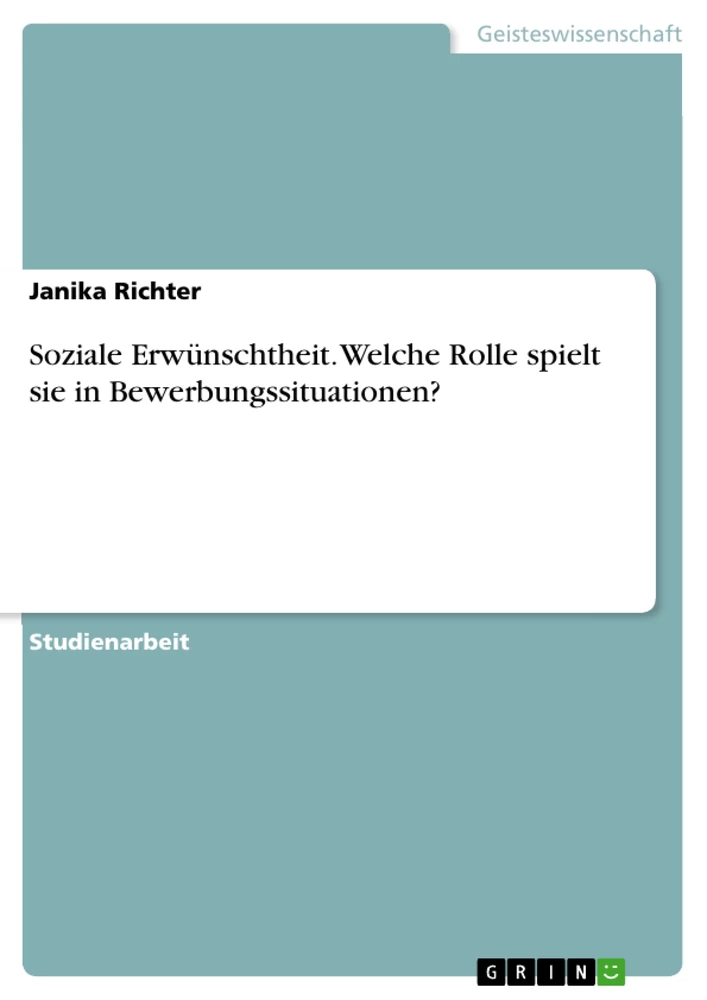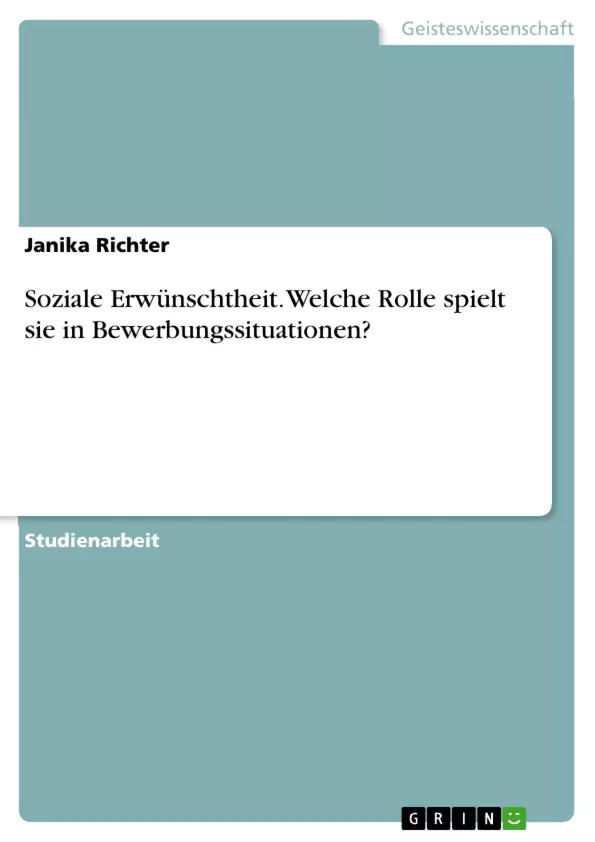Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „soziale Erwünschtheit“, genauer mit der Frage, welche Rolle diese in Bewerbungssituationen spielt. Wichtig ist dabei vorallem auch das Konstrukt der Selbstwirksamkeit, welches als Oberbegriff gesehen werden kann. Soziale Erwünschtheit ist eine antwortverzerrende Verhaltensweise, die in diagnostischen Verfahren zu einem Messfehler und daher nur zu geringer Validität in den Ergebnissen führt. Dabei stellt sie keine Verhaltensweise in Ausnahmesituationen dar, sondern ist ein Produkt unsers täglichen sozialen Lebens.
Menschen wägen bei wichtigen Entscheidungen für den künftigen Lebensweg die Kosten und Nutzen gegeneinander ab, sofern für die betroffene Person viel auf dem Spiel steht. Trotz jahrzehntelanger Forschung ist es bis heute nicht gelungen, das Konstrukt der sozialen Erwünschtheit messbar zu machen, um die Validität von Testverfahren zu erhöhen. Für Personalauswahlentscheidungen stellt sich die Frage, ob sozial erwünschtes Verhalten Auswirkungen auf die Personalentscheidungen hat und wenn ja, in welcher Weise. Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurden in der vorliegenden Arbeit ein diagnostisches Szenario zweier Bewerbungsinterviews dargestellt und mögliche Limitationen der Diagnostik aufgegriffen. Vergleichend hat sich gezeigt, dass ein gewisses Maß an sozial erwünschtem Verhalten von Personen verlangt wird.
Sofern ebendies jedoch überhand gewinnt, wirkt sich das Verhalten negativ auf die Entscheidung aus. Mögliche Vor- und Nachteile von sozial erwünschtem Verhalten werden am Ende der Seminararbeit diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einleitung
- Themenauswahl und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Forschungsstand und Geschichte
- Theoretische Grundlagen
- Definition und Funktionsweise zentraler Begriffe
- Selbstdarstellung
- Soziale Erwünschtheit
- Systematische Messfehler
- Gütekriterien
- Möglichkeiten zur Verringerung von sozial erwünschten Antworten
- Beschreibung des diagnostischen Szenarios
- Ableitung der diagnostischen Fragestellung und Zielsetzung
- Diagnostisches Verfahren
- Vorstellung des diagnostischen Verfahrens
- Durchführung der Diagnostik
- Ergebnisse
- Mögliche Ableitungen und Interpretationen aus den Ergebnissen
- Limitationen der Diagnostik
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Bewerbungsinterview mit Person A
- Bewerbungsinterview mit Person B
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der sozialen Erwünschtheit in Bewerbungssituationen. Sie befasst sich mit dem Einfluss dieses Konstrukts auf die Validität von Diagnostikverfahren in der Personalauswahl. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von sozial erwünschtem Verhalten in Bewerbungsinterviews aufzuzeigen und die Herausforderungen bei der Erfassung und Kontrolle dieses Phänomens zu diskutieren.
- Die Definition und Funktionsweise von sozialer Erwünschtheit in Bewerbungssituationen
- Die Bedeutung des Konstrukts der Selbstdarstellung in diesem Zusammenhang
- Möglichkeiten zur Verringerung von sozial erwünschtem Verhalten in der Diagnostik
- Die Auswirkungen von sozial erwünschtem Verhalten auf die Validität von Personalauswahlverfahren
- Limitationen der Diagnostik im Bereich der Personalauswahl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der sozialen Erwünschtheit in Bewerbungssituationen ein und erläutert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Sie gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand und die Geschichte des Themas. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen. Es werden zentrale Begriffe wie Selbstdarstellung, soziale Erwünschtheit, systematische Messfehler und Gütekriterien definiert und erläutert. Außerdem werden Möglichkeiten zur Verringerung von sozial erwünschtem Verhalten vorgestellt. Das dritte Kapitel stellt das diagnostische Verfahren vor, welches in der Arbeit verwendet wird, und beschreibt dessen Durchführung. Das vierte Kapitel analysiert die Ergebnisse der durchgeführten Diagnostik und diskutiert mögliche Ableitungen und Interpretationen. Auch die Limitationen der Diagnostik werden in diesem Kapitel behandelt. Abschließend wird im fünften Kapitel eine kritische Auseinandersetzung mit der durchgeführten Diagnostik vorgenommen.
Schlüsselwörter
Soziale Erwünschtheit, Selbstdarstellung, Bewerbungssituation, Diagnostikverfahren, Personalauswahl, Validität, Messfehler, Gütekriterien, Limitationen, Diagnostischer Prozess.
- Quote paper
- Janika Richter (Author), 2018, Soziale Erwünschtheit. Welche Rolle spielt sie in Bewerbungssituationen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419696