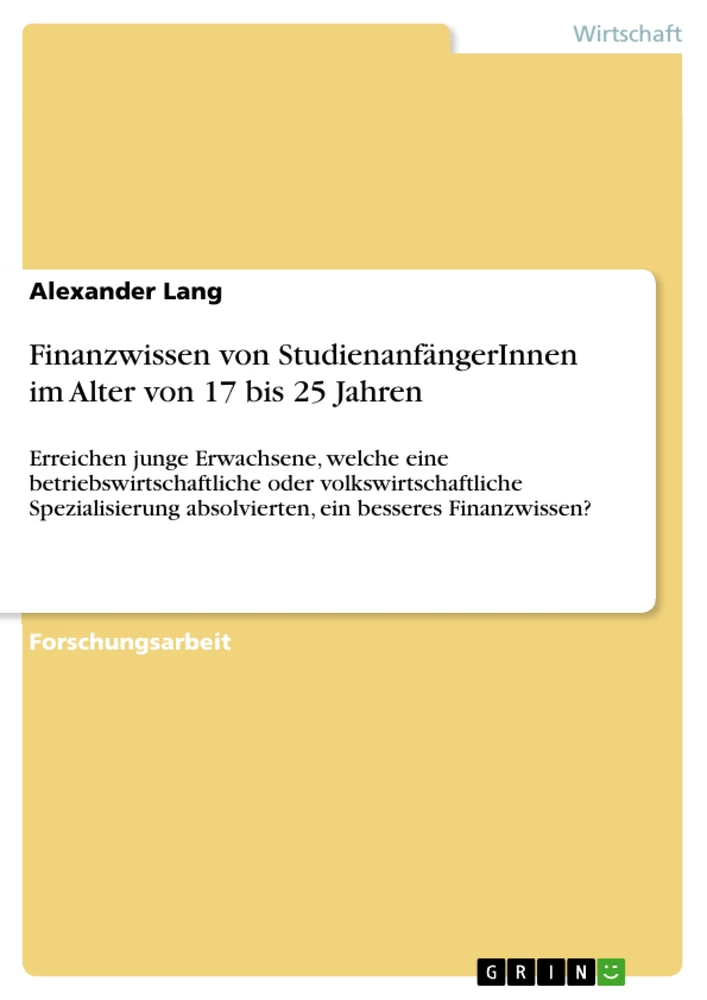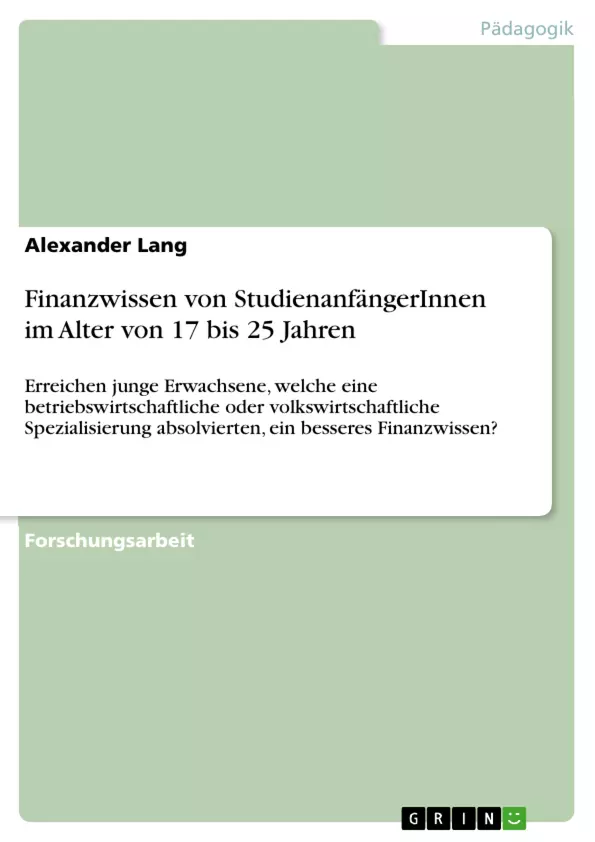Während der letzten Jahre wurde der Finanzbildung junger Erwachsener wachsende Aufmerksamkeit geschenkt. Aufgrund von staatlichen Einsparungen für Sozialausgaben in Deutschland wurde von jungen Erwachsenen erwartet, dass sie sich verantwortungsvoller um ihre eigene Rente bemühen. Da allerdings die verfügbaren finanziellen Produkte immer komplexer werden, fühlen sie sich bei Finanzentscheidungen sehr unsicher. Der Beitrag der Schulen zu diesem Thema bleibt unklar.
Verschiedene Studien zum Einsatz von Didaktik zu grundlegender finanzieller Bildung in der Sekundarschule zeigen unterschiedliche Ergebnisse bzw. sind nicht übereinstimmend. Tang/Peter (2015) zeigen, dass zusätzlich zu formaler Bildung auch die familiäre Bildung sowie die persönlichen Erfahrungen außerhalb der Schule möglicherweise zur Bildung von Finanzwissen beitragen.
In der Literatur wird in Deutschland oft das Bildungssystem von Forschern dahingehend kritisiert, dass finanzielle Themen nicht ausreichend behandelt werden und den Schülern nicht genügend Lernmöglichkeiten in diesem Gebiet geboten werden.
In dieser Studie werden StudienanfängerInnen, im Alter von 17 bis 25 Jahren, verschiedener Studienrichtungen höherer Bildung in Deutschland untersucht, da sie in dieser Lebensphase gewöhnlicherweise viele wichtige finanzielle Entscheidungen treffen müssen und das oft zum ersten Mal in ihrem Leben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptioneller Rahmen
- Analyse des lehrplanmäßigen Inhalts und Hypothesen
- Schlüsselwörter für die sechs Inhaltsbereiche
- Identifikation der Standards der CEE in den Lehrplänen
- Test-Instrument, Stichprobe und empirische Ergebnisse
- Test-Instrument
- Stichprobe
- Ergebnisse
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie analysiert die finanzielle Bildung von jungen Erwachsenen in Deutschland, indem sie den Einfluss von Berufsbildung, Wirtschaftsunterricht in der Sekundarschule und sozioökonomischen Faktoren untersucht.
- Der Einfluss von Berufsbildung und Sekundarschulunterricht auf das Finanzwissen junger Erwachsener
- Die Bedeutung der Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren bei der Analyse des Finanzwissens
- Die Analyse des Lehrplans in Bezug auf finanzielle Themen in verschiedenen Schulformen
- Die Verwendung eines validierten Tests zur Messung des Finanzwissens (TFL-G)
- Die empirische Untersuchung der Hypothese, dass bestimmte Schulformen und Berufsausbildungen zu einem höheren Finanzwissen führen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Finanzbildung für junge Erwachsene in Deutschland dar und beleuchtet die kontroversen Ergebnisse zu diesem Thema in der Literatur.
- Konzeptioneller Rahmen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Finanzbildung und grenzt ihn von anderen Komponenten der Finanzkompetenz ab. Es wird erläutert, wie das Finanzwissen in dieser Studie operationalisiert und gemessen wird.
- Analyse des lehrplanmäßigen Inhalts und Hypothesen: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Analyse der Lehrpläne verschiedener Schulformen in Deutschland. Die Ergebnisse der Lehrplananalyse führen zur Formulierung von drei Hypothesen, die im weiteren Verlauf der Studie empirisch überprüft werden.
- Test-Instrument, Stichprobe und empirische Ergebnisse: Dieses Kapitel stellt das eingesetzte Testinstrument (TFL-G) vor und beschreibt die Stichprobe der Studie. Die Ergebnisse der Analyse werden dargestellt, wobei die drei Indikatoren (Schultyp, betriebswirtschaftliche/volkswirtschaftliche Spezialisierung und Lehre) in Relation zum Finanzwissen gesetzt werden.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Finanzbildung, Finanzwissen, Berufsbildung, Sekundarschulunterricht, sozioökonomische Faktoren, Lehrplananalyse, TFL-G, empirische Untersuchung und Hypothesentestung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Einflusses von Bildungsinstitutionen und sozioökonomischen Merkmalen auf das Finanzwissen junger Erwachsener in Deutschland.
- Citation du texte
- Alexander Lang (Auteur), 2018, Finanzwissen von StudienanfängerInnen im Alter von 17 bis 25 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419841