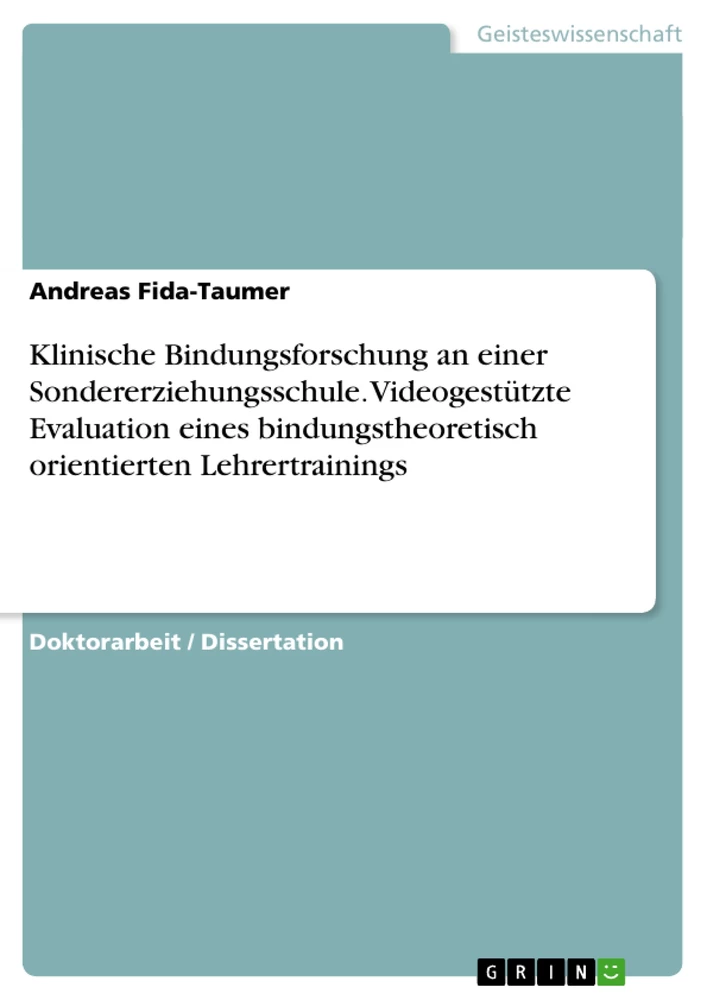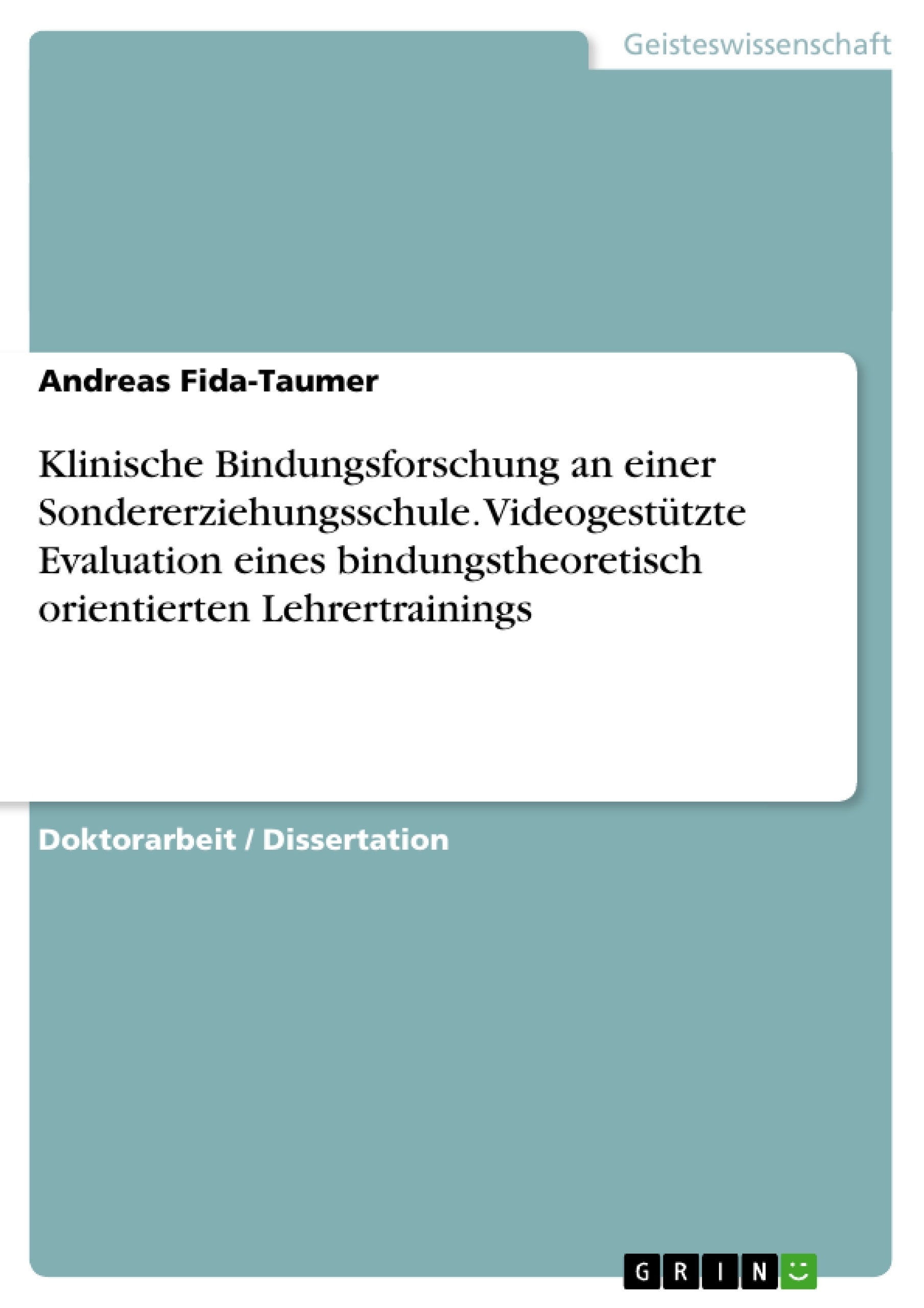Auf dem Hintergrund der klinischen Bindungstheorie und -forschung wurden die Lehrer und Schüler einer Sondererziehungsschule für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche in Wien untersucht. In einer Querschnittstudie wurden die Bindungsrepräsentationen von 37 Schülern und 15 Lehrern mit dem Separation-Anxiety-Test in der Version von Jakobsen und Ziegenhain und dem Adult-Attachment-Projective nach George und West erhoben, die Ausprägungen der Verhaltensauffälligkeiten der Schüler mit der Teacher’s Report Form erfasst und das Ausmaß der Prävalenz von Vernachlässigungs-, Missbrauchs-, Misshandlungs- und Trennungserfahrungen der Kinder und Jugendlichen in einem halbstandardisierten Interview mit den Lehrern erfragt. Die Ergebnisse zeigen, dass der überwiegende Teil dieser Schüler (70%) als hochunsicher desorganisiert und nur 5% der Schüler als sicher gebunden eingestuft wurden. Die Prävalenzerhebung ergab, dass 85% der Schüler belastende Verlust- und Trennungserfahrungen erlitten und im Vergleich zu deutschen Erziehungshilfeschulen zwar weniger traumatische Erfahrungen gemacht haben, aber dennoch als psychosozial belastende Umstände einzustufen sind. In einer dreimonatigen Längsschnittstudie wurde ein bindungstheoretisch orientiertes Lehrertrainingsprogramm nach Julius evaluiert, welches für die pädagogische Arbeit mit verhaltensauffälligen Schülern entwickelt wurde und die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern in den Vordergrund stellt. Dieses Lehrertraining bestand aus theoretischen Informationsblöcken, Fallbesprechungen von Schülern und videounterstützten Feinfühligkeitstrainings. Die Einflüsse des Trainingsprogramms auf das Verhalten der Lehrer und Schüler wurden durch ein einzelfallanalytisches Multiple-Baseline-Design mit vier hochunsicher desorganisiert gebundenen Schülern überprüft. Mit Beginn des Lehrertrainings änderten sich die Ausprägungen bei den beobachteten Schülern in relevanten pädagogischen Bereichen wie im Störverhalten oder im Nähe und Hilfesuch-Verhalten. Bei den Lehrern konnte eine deutliche und stetige Abnahme von unfeinfühligem, abwertendem Lehrerverhalten im Laufe des Lehrertrainings festgestellt werden (www.fida-taumer.at).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A THEORETISCHER TEIL
- A.1 Einführung in die Bindungstheorie
- A.1.1 Bindung
- A.1.2 Entwicklung des Bindungsverhaltenssystems
- A.1.3 Bindungsmuster
- A.1.4 Feinfühligkeit
- A.1.5 Innere Arbeitsmodelle
- A.2 Klinische Bindungsforschung
- A.2.1 Entwicklungspsychopathologie
- A.2.2 Bindungsorganisation und Psychopathologie
- A.2.3 Desorganisation
- A.2.3.1 Entstehungsbedingungen
- A.2.3.2 Elternfaktoren
- A.2.3.3 Kindliche Faktoren - Individuelle Disposition
- A.2.3.4 Entwicklungsverlauf von Desorganisation
- A.2.3.5 Desorganisierte Bindungsrepräsentation
- A.3 Klinische Anwendung der Bindungstheorie
- A.3.1 Stabilität und Beeinflussbarkeit der Bindungsorganisation
- A.3.2 Bindung und Psychotherapie
- A.3.3 Modell von bindungstheoretisch fundierten Interventionsarten
- A.3.4 Beispiele für bindungsbasierte Interventionen mit Videounterstützung
- A.4 Bindungstheoretisch orientiertes Lehrertrainingsprogramm
- A.4.1 Inhalte des Lehrertrainingsprogramms
- A.4.1.1 Einführung in die Bindungstheorie
- A.4.1.2 Fallbesprechungen und Interventionsstrategien
- A.4.1.3 Unsicher vermeidend gebundene Schüler
- A.4.1.4 Unsicher ambivalent gebundene Schüler
- A.4.1.5 Hochunsicher desorganisiert gebundene Schüler
- A.4.2 Videounterstütztes Feinfühligkeitstraining für Lehrer
- A.4.2.1 Videoaufnahme der Lehrer-Schüler-Interaktion
- A.4.2.2 Auswahl von Videosequenzen
- A.4.2.3 Inhalte des Feinfühligkeitstraining
- A.4.2.4 Analyse der Videosequenzen
- B EMPIRISCHER TEIL: KLINISCHE BINDUNGSFORSCHUNG AN EINER SONDERERZIEHUNGSSCHULE
- B.1 Querschnittstudie
- B.1.1 Fragestellungen der Querschnittstudie
- B.1.1.1 Bindungsmuster der Schüler
- B.1.1.2 Bindungsorganisation und Dissoziation
- B.1.1.3 Bindungsrepräsentationen der Lehrer
- B.1.1.4 Verhaltensauffälligkeiten der Schüler
- B.1.1.5 Bindungsorganisation und Verhaltensauffälligkeit
- B.1.1.6 Häufigkeitsverteilung von Belastungsfaktoren
- B.1.2 Methodik der Querschnittstudie
- B.1.2.1 Stichprobe der Querschnittstudie
- B.1.2.1.1 Beschreibung der Schule
- B.1.2.1.2 Beschreibung der Schüler
- B.1.2.1.3 Beschreibung des Schul- und Klassenklimas
- B.1.2.1.4 Beschreibung der Lehrer
- B.1.2.1.5 Beschreibung des Lehrerhandelns
- B.1.2.1.6 Beschreibung der Vergleichsstichproben
- B.1.2.2 Konstrukte und Erhebungsverfahren der Querschnittstudie
- B.1.2.2.1 Separation-Anxiety-Test (SAT)
- B.1.2.2.2 Adult-Attachment-Projective (AAP)
- B.1.2.2.3 Child-Dissociation-Scale (CDC)
- B.1.2.2.4 Teacher's Report Form (TRF)
- B.1.2.2.5 Anamnestisches und exploratives Interview mit Lehrern
- B.1.2.3 Untersuchungsablauf der Querschnittstudie
- B.1.2.4 Auswertung der Querschnittstudie
- B.1.2.5 Kritische Diskussion der Versuchsplanung
- B.1.3 Ergebnisse der Querschnittstudie
- B.1.3.1 Bindungsmuster der Schüler
- B.1.3.2 Bindungsorganisation und Dissoziation
- B.1.3.3 Bindungsrepräsentationen der Lehrer
- B.1.3.4 Verhaltensauffälligkeiten der Schüler
- B.1.3.5 Bindungsorganisation und Verhaltensauffälligkeit
- B.1.3.6 Häufigkeitsverteilung von Belastungsfaktoren
- B.1.4 Diskussion der Querschnittstudienergebnisse
- B.2 Längsschnittstudie
- B.2.1 Fragestellungen der Längsschnittstudie
- B.2.1.1 Verhalten der Schüler
- B.2.1.2 Verhalten der Lehrer
- B.2.1.3 Umsetzungserfahrungen
- B.2.2 Methodik der Längsschnittstudie
- B.2.2.1 Forschungsdesign der Längsschnittstudie
- B.2.2.2 Untersuchungsablauf der Längsschnittstudie
- B.2.2.3 Stichprobe der Längsschnittstudie
- B.2.2.3.1 Auswahl und Beschreibung der Zielkinder
- B.2.2.3.2 Auswahl und Beschreibung der Lehrer
- B.2.2.4 Erhebungsverfahren der Längsschnittstudie
- B.2.2.5 Setting der Längsschnittstudie
- B.2.2.5.1 Beobachtungsstunden
- B.2.2.5.2 Unterrichtseinheiten
- B.2.2.5.3 Unterrichtsfächer
- B.2.2.5.4 Unterrichtsart
- B.2.2.6 Auswertung der Längsschnittstudie
- B.2.2.7 Kritische Diskussion der Versuchsplanung
- B.2.3 Ergebnisse der Längsschnittstudie
- B.2.3.1 Verhalten der Schüler
- B.2.3.1.1 Nähe suchen
- B.2.3.1.2 Prosoziales Verhalten
- Klinische Bindungsforschung in der Sonderpädagogik
- Entwicklung und Evaluation eines bindungstheoretisch fundierten Lehrertrainings
- Die Bedeutung von Feinfühligkeit für die Entwicklung und das Verhalten von Schülern
- Der Einfluss von Bindungsmustern auf das Schülerverhalten und die Lehr-Lern-Beziehung
- Die Rolle von Videounterstützung bei der Schulung von Lehrkräften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation von Mag. Andreas Taumer zielt darauf ab, die Wirksamkeit eines bindungstheoretisch orientierten Lehrertrainings an einer Sondererziehungsschule mittels videobasierter Evaluation zu untersuchen. Das Training soll Lehrkräfte in ihrer Fähigkeit zur Feinfühligkeit gegenüber den Bedürfnissen von Schülern mit unterschiedlichen Bindungsmustern schulen und so die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten dieser Schüler verbessern.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Bindungstheorie und deren Relevanz in der Sonderpädagogik ein. Der theoretische Teil präsentiert einen umfassenden Überblick über die Bindungstheorie, die Entwicklung des Bindungsverhaltenssystems, unterschiedliche Bindungsmuster, die Rolle von Feinfühligkeit und inneren Arbeitsmodellen sowie den Zusammenhang zwischen Bindungsorganisation und Psychopathologie. Dabei wird besonderes Augenmerk auf das Konzept der Desorganisation gelegt und die Bedeutung von videobasierten Interventionen hervorgehoben. Es wird ein bindungstheoretisch orientiertes Lehrertrainingsprogramm vorgestellt, das auf die Förderung der Feinfühligkeit von Lehrkräften im Umgang mit Schülern mit unterschiedlichen Bindungsmustern abzielt.
Der empirische Teil befasst sich mit den Ergebnissen einer Querschnittstudie und einer Längsschnittstudie, die an einer Sondererziehungsschule durchgeführt wurden. Die Querschnittstudie untersucht die Bindungsmuster der Schüler, die Bindungsorganisation und Dissoziation, die Bindungsrepräsentationen der Lehrer, die Verhaltensauffälligkeiten der Schüler und den Zusammenhang zwischen Bindungsorganisation und Verhaltensauffälligkeiten. Die Längsschnittstudie analysiert die Entwicklung des Schüler- und Lehrerverhaltens im Verlauf des Lehrertrainings.
Schlüsselwörter
Bindungstheorie, Sonderpädagogik, Lehrertraining, Feinfühligkeit, Bindungsmuster, Desorganisation, Videounterstützung, Verhaltensauffälligkeiten, Querschnittstudie, Längsschnittstudie, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des bindungstheoretischen Lehrertrainings?
Das Training soll die Feinfühligkeit von Lehrkräften gegenüber verhaltensauffälligen Schülern fördern, um deren Bindungssicherheit und Verhalten zu verbessern.
Was sind desorganisierte Bindungsmuster?
Dies sind hochunsichere Bindungsrepräsentationen, die oft durch traumatische Erfahrungen wie Verlust, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen.
Wie wird Video-Feedback im Training eingesetzt?
Videoaufnahmen von Lehrer-Schüler-Interaktionen werden analysiert, um unfeinfühliges Verhalten zu erkennen und positive Interaktionsstrategien zu schulen.
Welche Ergebnisse lieferte die Untersuchung an der Sonderschule?
70% der Schüler wurden als hochunsicher-desorganisiert eingestuft. Das Training führte zu einer Abnahme von Störverhalten und einer Zunahme von Feinfühligkeit bei Lehrern.
Welche Tests wurden zur Erhebung der Bindung genutzt?
Eingesetzt wurden der Separation-Anxiety-Test (SAT) und das Adult-Attachment-Projective (AAP).
- Citation du texte
- Dr. Andreas Fida-Taumer (Auteur), 2004, Klinische Bindungsforschung an einer Sondererziehungsschule. Videogestützte Evaluation eines bindungstheoretisch orientierten Lehrertrainings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41984