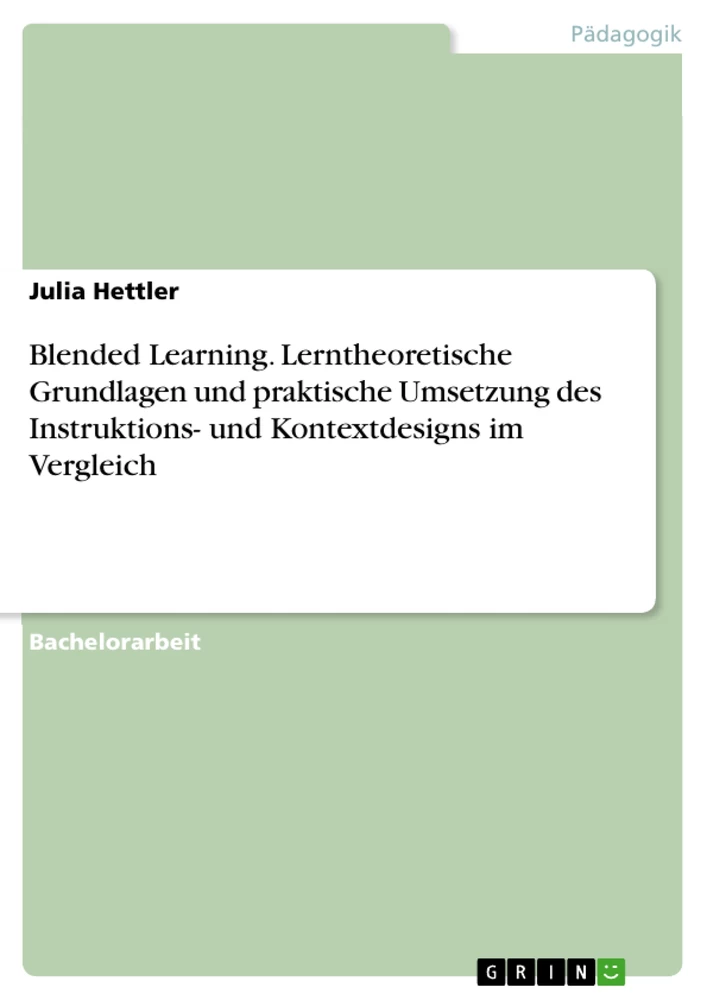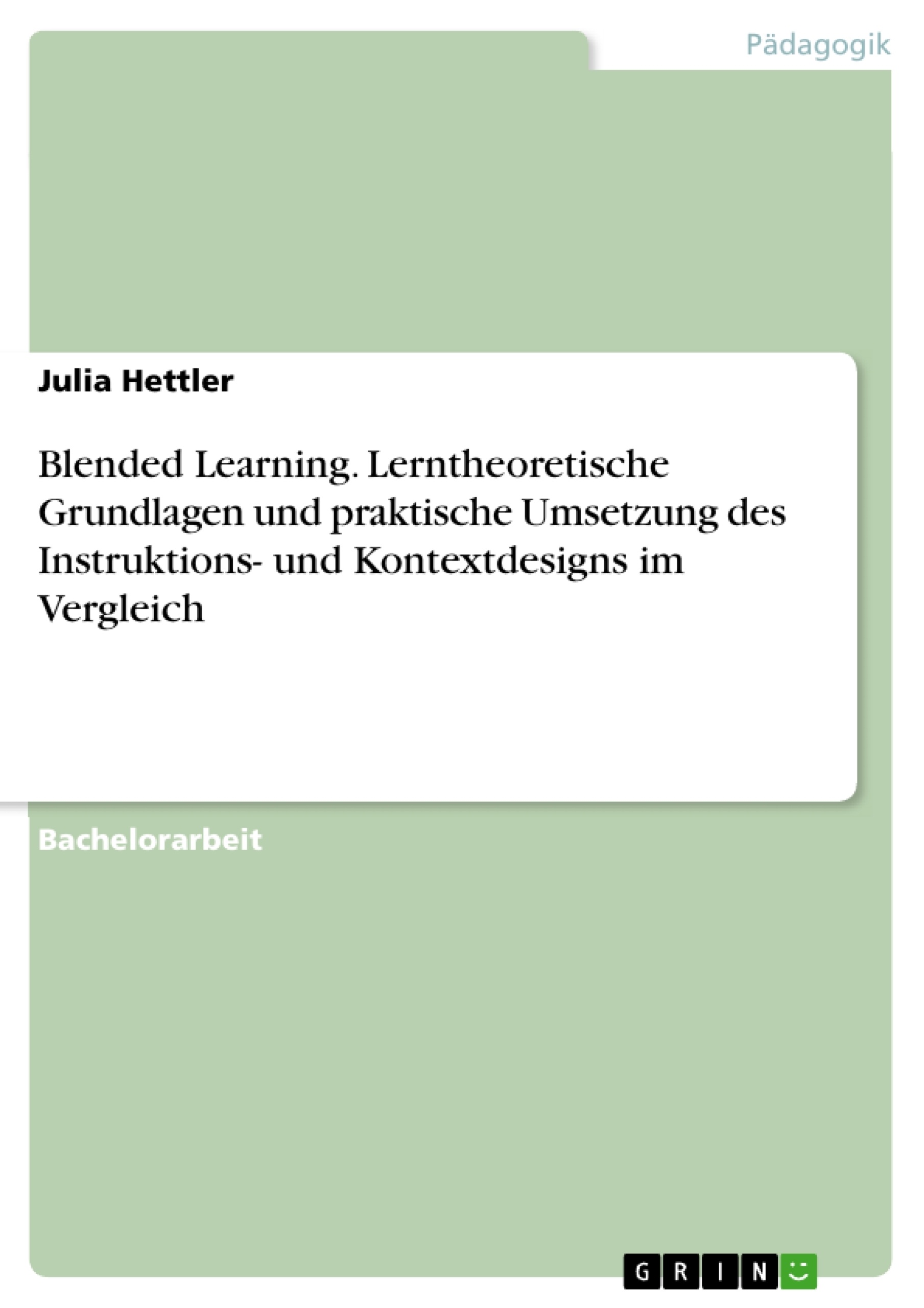Da Lernprozesse von vielen kognitiven sowie nicht-kognitiven Persönlichkeitseigenschaften bedingt werden, richtet die Didaktik ihren Fokus verstärkt auf Differenzierungs- und Individualisierungsaspekte. Durch ein differenziertes Unterrichtsangebot können die zu vermittelnden Inhalte, die Lernstile sowie die Aufgabenstellung bestmöglich individuell auf die einzelnen Lernenden abgestimmt werden. Als ausgesprochen vorteilhaft für die Individualisierung der Lehr-Lernprozesse erweisen sich E-Learning Plattformen, da hierbei die individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden, indem der Lernende sein Lerntempo, die Auswahl der Lernmaterialien sowie seine Lernstile und Präferenzen selbst anpassen bzw. auswählen kann. Ein weiterer Vorteil manifestiert sich darin, dass die Lehrenden durch E-Learning in die Lage versetzt werden, außerhalb der Präsenzphase mit den Lernenden individuell zu kommunizieren. Allerdings kristallisierte sich mit der Zeit heraus, dass computerunterstütztes Lernen alleine oftmals nicht ausreicht, um den nötigen Lernerfolg der Lernenden zu erzielen. Diesem Umstand wurde durch die Kombination von E-Learning und Präsenzlernen Rechnung getragen. Das Resultat dieser Vereinigung ist der Gegenstand vorliegender Untersuchung: das Blended Learning.
Begünstigt durch den technologischen Fortschritt und die damit verbundene Preisreduzierung technischer Endgeräte, die beständige Verbesserung der Internet-Infrastruktur sowie die Veränderung des Kommunikationsverhaltens und die verbesserte Verfügbarkeit relevanter Informationen, trat das Blended Learning, wie jüngste Untersuchungen aufzeigen, einen weltweiten Siegeszug im Bereich der höheren Bildung an. Blended Learning findet seinen Einfluss in einem breiten Spektrum der höheren Bildung, da es einen effizienten Ansatz darstellt, in welchem der traditionell definierte Förderungsprozess mit Technologie unterfüttert und ergänzt wird. Doch auch das Blended Learning selbst ist kein homogenes, statisches Lehr-Lernmodell sondern unterliegt im Lauf der Zeit zum Teil einschneidenden Veränderungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Traditionelle Lehr-Lernformen
- E-Learning
- Begriffliche Eingrenzung
- Typologie
- Funktionen
- Lernformen
- Komponenten computergestützter Lernumwelten
- Lerntheoretische Grundlagen
- Behaviorismus
- Kognitivismus
- Konstruktivismus
- Blended Learning
- Begriffliche Eingrenzung
- Blended Learning Szenarien
- Allgemeine didaktische Modelle
- Modelle des Instruktionsdesigns
- Programmierte Unterweisung
- Instruktionstheorie
- Elaborationstheorie der Instruktion
- Component Display Theory
- Instructional Transaction Theory
- Klassifikation von Blended Learning Ansätzen
- Charakterisierung von Instruktions- und Kontextdesign
- Cognitive Apprenticeship
- Modelle des Kontextdesigns
- Goal-Based Scenarios
- Vergleich der allgemeinen didaktischen Modelle
- Allgemeiner Modellvergleich
- Modellvergleich im Hinblick auf Blended Learning
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Konzept des Blended Learning. Das Ziel der Arbeit ist es, die lerntheoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung des Instruktions- und Kontextdesigns im Vergleich zu beleuchten. Hierbei werden die beiden Komponenten des Blended Learning - traditionelle Lehr-Lernformen und E-Learning - im Detail betrachtet, um die Entwicklung und Relevanz des Blended Learning-Ansatzes aufzuzeigen.
- Lerntheoretische Grundlagen des Blended Learning
- Vergleich verschiedener didaktischer Modelle für Blended Learning
- Charakterisierung von Instruktions- und Kontextdesign im Blended Learning
- Potenzial und Herausforderungen des Blended Learning-Ansatzes
- Praxisbezogene Implikationen und Anwendungsmöglichkeiten von Blended Learning
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz von Blended Learning in der heutigen Bildungswelt erläutert und den Fokus der Arbeit auf die lerntheoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung des Instruktions- und Kontextdesigns legt.
Kapitel 2 widmet sich den traditionellen Lehr-Lernformen, wobei der Schwerpunkt auf dem Frontalunterricht liegt. Es werden die historischen Wurzeln, die Definition und die kritische Betrachtung des Frontalunterrichts sowie die Bedeutung der Sozialform des Unterrichts in der heutigen Bildung beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem E-Learning. Der Begriff wird definiert und eine Typologie von E-Learning-Formen vorgestellt, die die Funktionen, Lernformen und Komponenten computergestützter Lernumwelten umfasst. Weiterhin werden die lerntheoretischen Grundlagen des E-Learning - Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus - dargestellt.
Kapitel 4 fokussiert sich auf den Begriff des Blended Learning. Dabei werden die Begriffliche Eingrenzung und die verschiedenen Szenarien des Blended Learning erläutert.
In Kapitel 5 werden allgemeine didaktische Modelle im Kontext von Blended Learning betrachtet. Das Kapitel umfasst Modelle des Instruktionsdesigns, Klassifikationen von Blended Learning Ansätzen und die Charakterisierung von Instruktions- und Kontextdesign.
Kapitel 6 widmet sich dem Vergleich verschiedener didaktischer Modelle. Sowohl ein allgemeiner Modellvergleich als auch ein Vergleich im Hinblick auf Blended Learning werden durchgeführt.
Schlüsselwörter
Blended Learning, Lehr-Lernformen, Instruktionsdesign, Kontextdesign, E-Learning, traditionelle Lehrformen, Frontalunterricht, Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, didaktische Modelle, Cognitive Apprenticeship, Goal-Based Scenarios
- Arbeit zitieren
- Julia Hettler (Autor:in), 2017, Blended Learning. Lerntheoretische Grundlagen und praktische Umsetzung des Instruktions- und Kontextdesigns im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420524