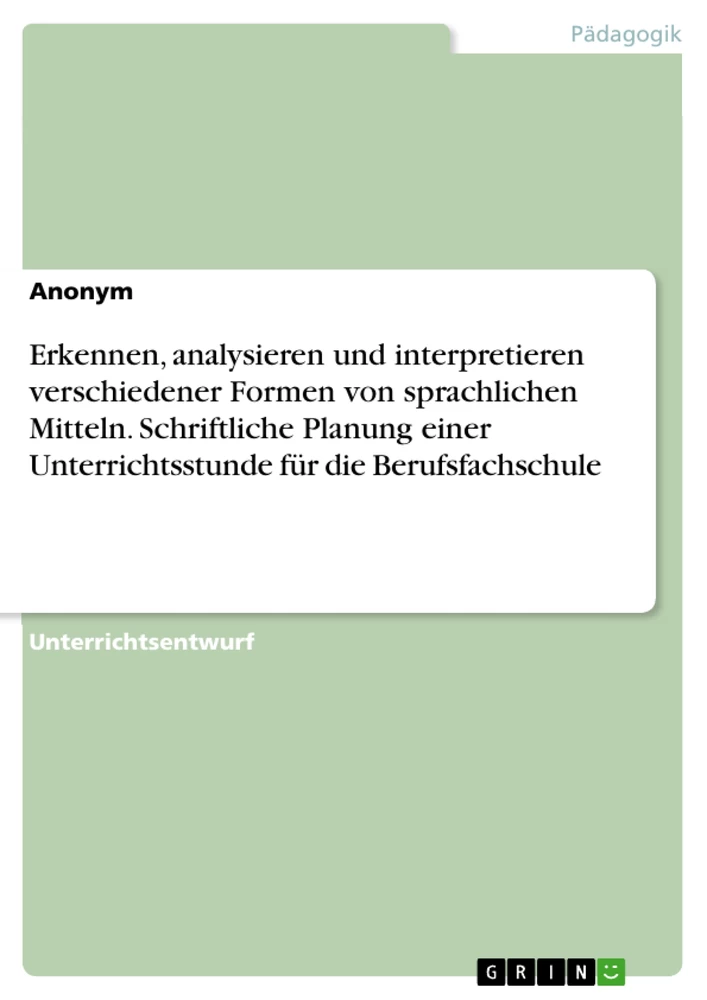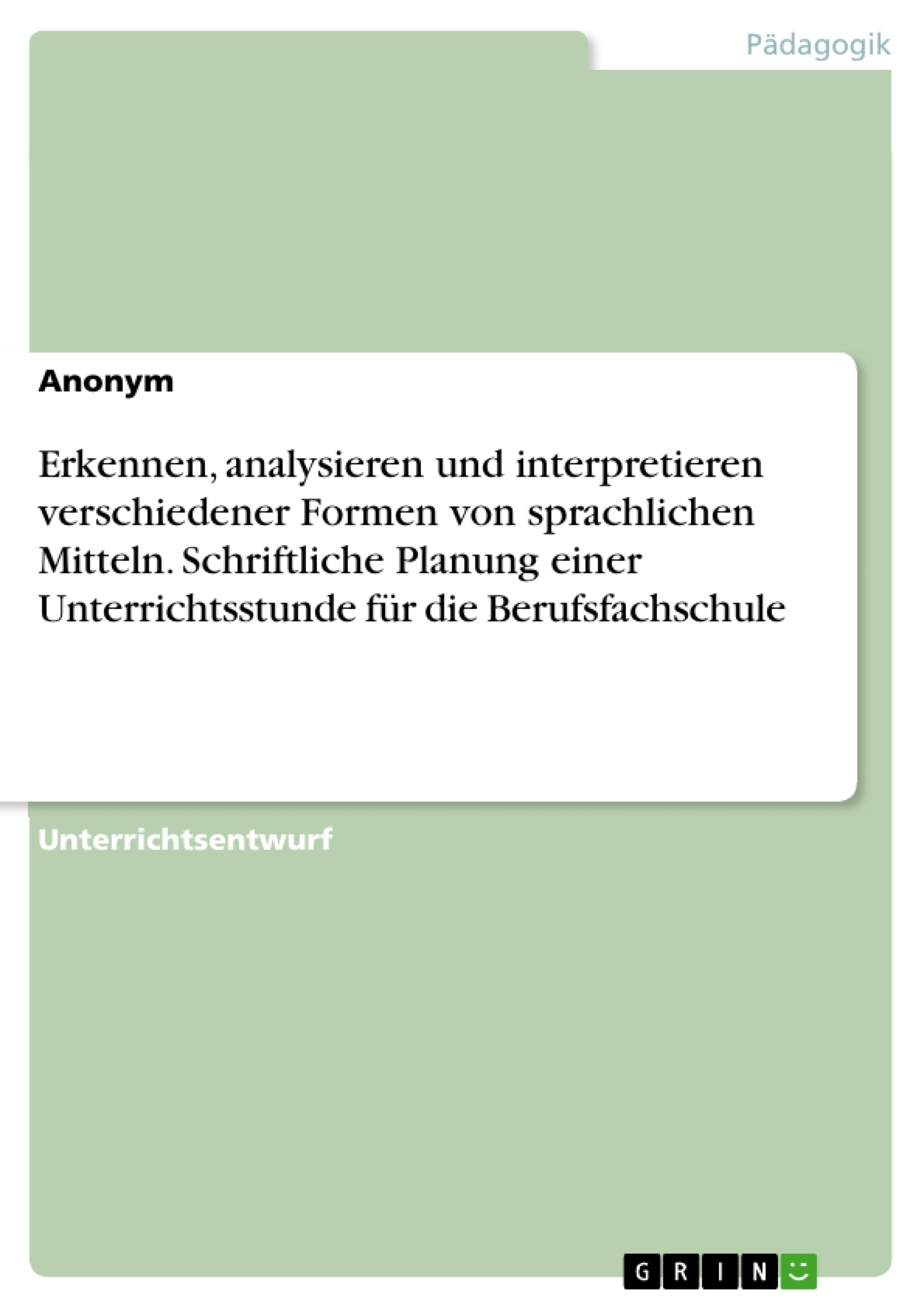Die Schülerinnen und Schüler sollen die Funktionen und Wirkungsweisen verschiedener sprachlicher Mittel erkennen und diese gezielt interpretieren; sie sollen verstehen, wo und wie sprachliche Mittel eingesetzt werden können, um bestimmte Intentionen zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Bedingungsfelder - Vorbedingungen des Unterrichts
- 1.1. Lerngruppe
- 1.2. Schule
- 2. Entscheidungsfelder: Stoff/ Didaktik/ Methodik/ Medien
- 2.1. Die Stunde im Unterrichtsganzen – curriculare Voraussetzungen
- 2.2. Vorstellung des Unterrichtsgegenstandes – Sachanalyse
- 2.3. Didaktische Überlegungen und Entscheidungen
- 2.4. Methodische Überlegungen und Entscheidungen
- 3. Reflexion der gegebenen Unterrichtsstunde
- 4. Stundenverlauf im Überblick
- 5. Geplantes Tafelbild
- 6. Materialien
- 6.1. Kurzgeschichte „Alles wie immer“ von Sibylle Berg
- 6.2. Arbeitsblatt
- 6.3. Übersicht sprachliche Mittel
- 7. Literaturverzeichnis
- 7.1. Primärliteratur
- 7.2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern die Funktionen und Wirkungsweisen verschiedener sprachlicher Mittel aufzuzeigen und sie zur gezielten Interpretation dieser Mittel zu befähigen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, wie sprachliche Mittel eingesetzt werden können, um bestimmte Intentionen zu erreichen.
- Analyse und Interpretation verschiedener sprachlicher Mittel (Wort-, Denk- und Satzbaufiguren, Satzformen und sprachliche Bilder)
- Verständnis der Funktion und Wirkungsweise sprachlicher Mittel in Texten
- Anwendung des Interpretationsdreischrittes und Analysetechniken
- Entwicklung der Sachkompetenz im Bereich der Texterschließung und Interpretation
- Förderung der Methodenkompetenz durch Anwendung von Analysemethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer detaillierten Beschreibung der Lerngruppe und der Schule, in der die Unterrichtsstunde stattfinden soll. Anschließend wird die Stunde im Kontext des gesamten Unterrichtsverlaufs und des Lehrplans für die Berufsfachschule III eingeordnet. Die Sachanalyse befasst sich ausführlich mit den verschiedenen Arten sprachlicher Mittel und ihrer Wirkungsweise. Dabei werden Wort-, Denk- und Satzbaufiguren, Satzformen und sprachliche Bilder erläutert. Abschließend stellt der Text die Kurzgeschichte "Alles wie immer" von Sibylle Berg als Beispiel für den methodischen Einsatz sprachlicher Mittel vor.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind: sprachliche Mittel, rhetorische Stilmittel, rhetorische Figuren, Wortfiguren, Denkfiguren, Satzbaufiguren, Satzformen, sprachliche Bilder, Interpretation, Analyse, Textverständnis, Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Unterrichtsplanung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Erkennen, analysieren und interpretieren verschiedener Formen von sprachlichen Mitteln. Schriftliche Planung einer Unterrichtsstunde für die Berufsfachschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420546