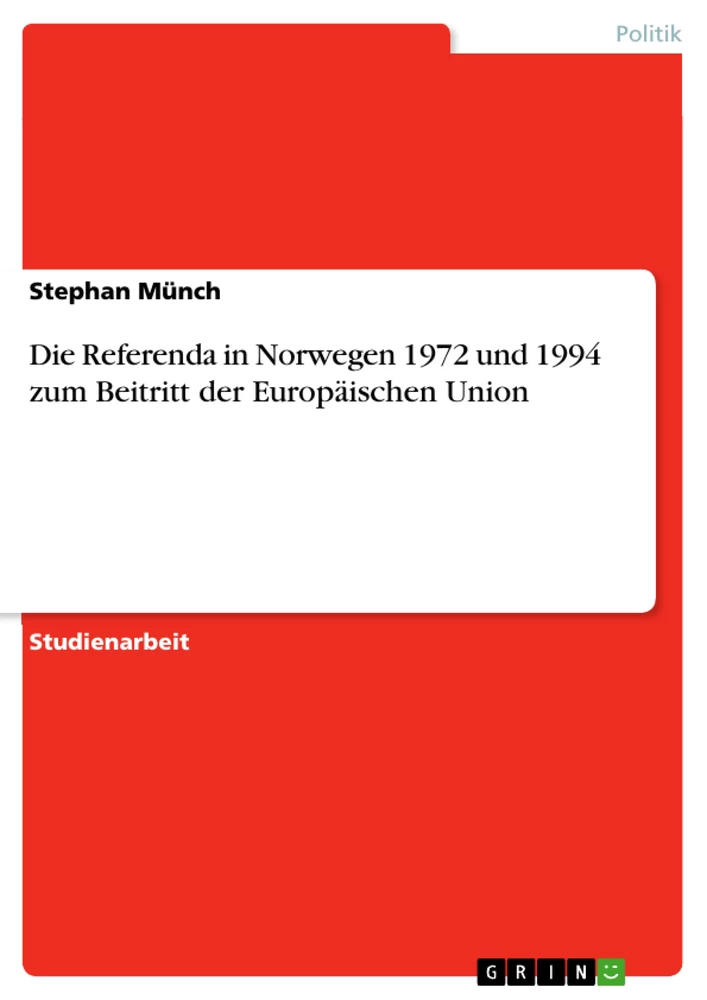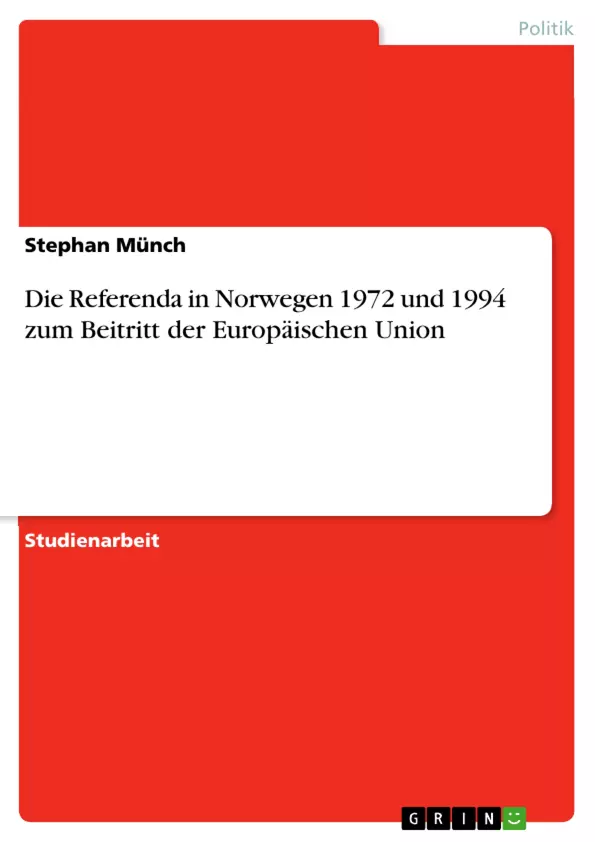Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den beiden Referenda 1972 und 1994 in Norwegen zum Beitritt in die Europäische Union. Das Königreich Norwegen ist bis zum heutigen Tag kein Mitglied der Europäischen Union. In den zwei Referenda entschieden sich die wahlberechtigten norwegischen Bürger 1972 gegen einen Beitritt in die damalige Europäische Gemeinschaft und später 1994 gegen einen EU-Beitritt. Dessen ungeachtet ist Norwegen durch seine geographische Lage und den gemeinsamen Binnenmarkt eng mit der EU verbunden. Es ist Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums und der Europäischen Freihandelsassoziation, so beteiligt es sich darüber hinaus auch am Schengen-Raum.
Bevor die norwegische Bevölkerung 1972 über einen Beitritt in die Europäische Gemeinschaft abstimmte, hatte das Land schon erste Bindungen und Beitrittsversuche hinter sich. Als sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957 aus den sechs Gründungsmitgliedern Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten und Italien bildete, waren die Mitglieder außerdem in dem westlichen Militärbündnis NATO vertreten, dessen Gründungsmitglied Norwegen bereits seit dem 04. April 1949 war. Durch diese erste Verbindung Norwegens mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft, verfügte es schon bald über enge wirtschaftliche Bindungen zu West- und Mitteleuropa. Da die EWG durch ihr wirtschaftliches Modell einen großen Aufschwung hatte und allen beteiligten Staaten zu einem starken Wirtschaftswachstum verhalf, versuchte Norwegen bereits 1961 und 1967 aus Eigeninitiative der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten. Die Verhandlungen für einen Beitritt in die EWG wurden allerdings von dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle blockiert, der die EWG nicht erweitern wollte. So blieben neben Norwegen auch andere Länder, wie das Vereinte Königreich Großbritannien und Nordirland fürs Erste außen vor. Erst nach dem Abdanken des damaligen französischen Präsidenten de Gaulles 1969, konnte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft Beitrittsverhandlungen mit anderen Ländern aufnehmen, um sich zu vergrößern. Unter diesen Umständen beschloss das norwegische Parlament 1970 mit 132 Stimmen zu 17 Stimmen einen nochmaligen Beitrittsantrag zur EWG zu stellen. Die kurz zuvor gescheiterten Verhandlungen über eine engere Zusammenarbeit der nordischen Länder spielten dabei eine Rolle. Trotzdem begann die anfänglich noch große Mehrheit im Parlament schon während der Verhandlungen abzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Referendum in Norwegen von 1972 zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft
- Hintergrund
- Das Referendum 1972
- Wahlbeteiligung
- Folgen des Referendums
- Fazit des Referendums 1972
- Das Referendum in Norwegen von 1994 zum Beitritt in die Europäische Union
- Hintergrund
- Das Referendum 1994
- Wahlbeteiligung
- Nach dem Referendum
- Fazit des Norwegen Referendums von 1994
- Vergleich der Referenda von 1972 und 1994
- Fazit des Vergleichs
- Warum Norwegen der EU trotz vermeintlicher Nachteile nicht beitritt: Die Gründe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den beiden Referenda in Norwegen von 1972 und 1994 zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft bzw. die Europäische Union. Die Arbeit untersucht die historischen Hintergründe, die Durchführung der Referenda, die Ergebnisse und die Folgen für Norwegen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Vergleich beider Volksentscheide und den Gründen, warum sich Norwegen trotz vermeintlicher Nachteile gegen einen EU-Beitritt entschieden hat.
- Historische Entwicklung des norwegischen Verhältnisses zur Europäischen Union
- Analyse der Referenda von 1972 und 1994
- Gründe für die Ablehnung des EU-Beitritts durch die norwegische Bevölkerung
- Bewertung der Folgen der Referenda für Norwegen
- Vergleich der norwegischen Situation mit anderen europäischen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Referendum in Norwegen von 1972 zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund des Referendums, einschließlich Norwegens früherer Bindungen zur Europäischen Gemeinschaft. Es behandelt die Debatte um einen Beitritt, die Argumente von Befürwortern und Gegnern, sowie die hohe Wahlbeteiligung und das Ergebnis des Referendums, das ein Nein zum EU-Beitritt brachte.
- Das Referendum in Norwegen von 1994 zum Beitritt in die Europäische Union: Das Kapitel beleuchtet das Referendum 1994, das sich mit einem EU-Beitritt befasste. Es behandelt die Gründe für die erneute Abstimmung, die wiedergegebene Debatte um einen Beitritt, die Wahlbeteiligung und das Ergebnis des Referendums, welches erneut ein Nein zum EU-Beitritt brachte.
- Vergleich der Referenda von 1972 und 1994: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Vergleich der beiden Referenda, analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede und zieht Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen.
- Warum Norwegen der EU trotz vermeintlicher Nachteile nicht beitritt: Die Gründe: Dieses Kapitel befasst sich mit den Faktoren, die trotz der potenziellen Vorteile einer EU-Mitgliedschaft zur Ablehnung eines Beitritts geführt haben.
Schlüsselwörter
Norwegen, Europäische Union, Europäische Gemeinschaft, Referendum, Volksabstimmung, Beitritt, EU-Mitgliedschaft, EWR, EFTA, Wirtschaft, Politik, Souveränität, Fischerei, Geschichte, Vergleich, Analyse
- Citar trabajo
- Stephan Münch (Autor), 2017, Die Referenda in Norwegen 1972 und 1994 zum Beitritt der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/420561