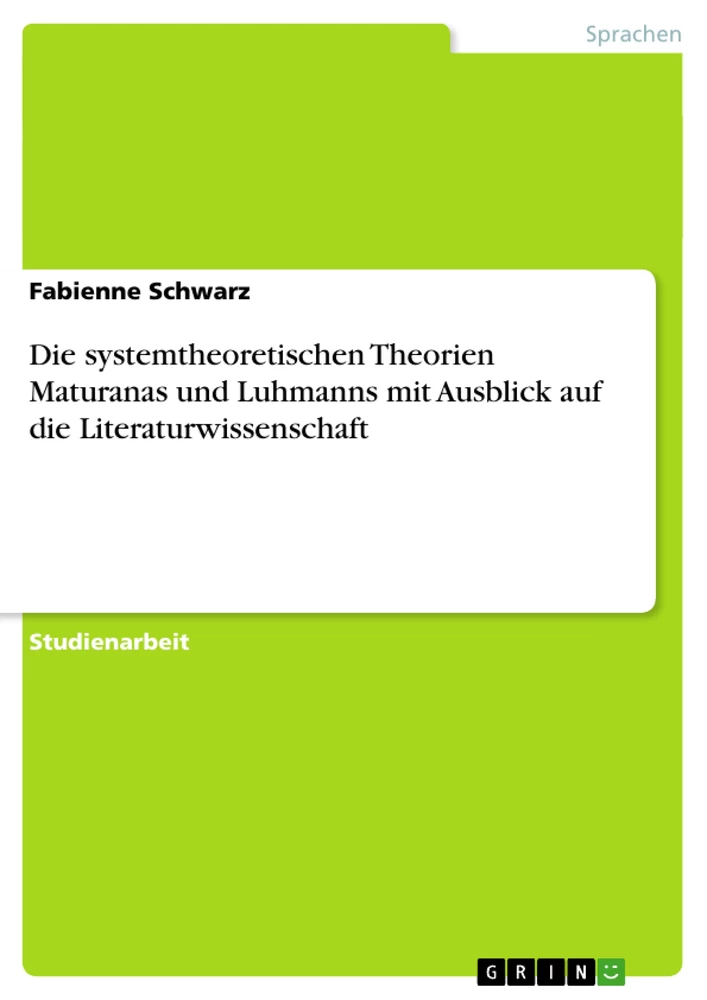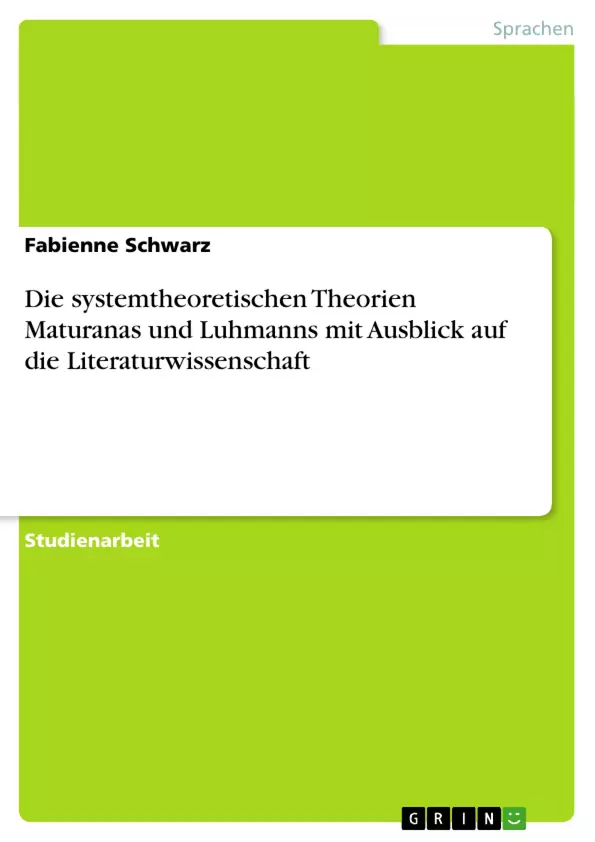Einleitung
In den siebziger und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entwickelten die chilenischen Neurobiologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela eine biologisch-konstruktivistische Theorie des Erkennens. Sie vertraten dabei die These, dass die Realität in einem objektiven Sinne nicht existent ist, sondern allein ein Produkt unserer Art der Sinneswahrnehmung darstellt. Ausgangspunkt dieser Überlegungen war ihre Beschreibung von Lebensformen als komplexe Systeme, welche die Eigenschaft der Autopoiese aufweisen. Der terminus tecnicus der „Autopoiese“ wurde von Maturana 1972 eingeführt; er setzt sich aus den beiden griechischen Begriffen ,,autos" (dt. selbst) und ,,poiein" (dt. produzieren/erschaffen) zusammen und benennt die Hauptwesenmerkmale lebender Systeme: ihre Selbstgestaltung bzw. Selbstherstellung.
Das Autopoiese-Konzept ist heute zu einem weit verbreiteten Schlagwort in unterschiedlichen Disziplinen geworden, so wurde es u.a. von Zeleny in die Geisteswissenschaften und von Probst in die Psychologie eingeführt. Vor allem jedoch durch die euphorische Aufnahme im (vor allem radikalen) Konstruktivismus erfuhr es eine weite Verbreitung. Der Radikale Konstruktivismus versucht dabei seine erkenntnistheoretischen Thesen mit der Theorie der Autopoiese zu begründen; die These der informationellen Geschlossenscheit lebender Systeme bildet dabei nach Dettmann die Schnittstelle zwischen der biologischen Theorie der Autopoiese und der erkenntnistheoretischen Theorie des Radikalen Konstruktivismus (Dettmann 1999: 5). Der radikale Konstruktivismus untersucht vor allem die Frage, wie unsere Vorstellung von Realität zustande kommt (Dettmann 1999: 1f). Seine Grundannahme ist, dass jedes Subjekt ständig seine eigene Realität individuell neu konstruiert und Realität so überhaupt fiktiv ist. Das Subjekt wird dabei als in seiner eigenen, abgeschlossenen Welt verortet angesehen, Erkenntnis über die objektive Welt kann in dieser Sichtweise aus objektiven Gründen nur subjektiven Charakter haben. Der radikale Konstruktivismus versucht so, die Relativität allen Erkennens mit den Möglichkeiten moderner Naturwissenschaft zu begründen. Diese Grundlagen einer biologischen, konstruktivistischen Systemtheorie nahm auch der deutsche Soziologe Niklas Luhmann zur Kenntnis, die ihm als Anregung und Ideengeber für seine soziologische Systemtheorie dienten....
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Die Theorie der Autopoiese von Maturana
- 1.1 Die Selbstreferentialität
- 1.2 Der Beobachter
- 1.3 Der Wirklichkeitsbegriff
- 2 Die soziologische Systemtheorie nach Luhmann
- 2.1 Systemdifferenzierung
- 2.2 Das Konzept der Autopoiese
- 2.3 Der Code
- 2.4 Wirklichkeit
- 3 Systemtheorie und Literatur
- 3.1 Der Roman Don Quijote als autopoietisches Textsystem
- 3.2 Die Selbstreferentialität im Don Quijote
- 4 Schlussüberlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die systemtheoretischen Ansätze von Humberto R. Maturana und Niklas Luhmann mit dem Fokus auf ihre Relevanz für die Literaturwissenschaft. Die Arbeit beleuchtet die zentralen Konzepte der Autopoiesis, wie Selbstreferentialität und Wirklichkeitskonstruktion, und zeigt auf, wie diese Konzepte auf das literarische Werk angewandt werden können.
- Die Theorie der Autopoiesis von Maturana und ihre Bedeutung für das Erkennen
- Die soziologische Systemtheorie von Luhmann und ihre Anwendung auf gesellschaftliche Funktionssysteme
- Die Anwendung der Systemtheorie auf literarische Texte, insbesondere den Roman "Don Quijote"
- Die Relevanz der Systemtheorie für die Literaturwissenschaft
- Die Herausforderungen und Potenziale der systemtheoretischen Analyse von literarischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 0: Einleitung: Diese Einleitung stellt die systemtheoretischen Ansätze von Maturana und Luhmann vor und beschreibt deren Relevanz für die Literaturwissenschaft. Sie erläutert die zentralen Konzepte der Autopoiesis und die Bedeutung der Systemtheorie für die Analyse von literarischen Texten.
- Kapitel 1: Die Theorie der Autopoiese von Maturana: Dieses Kapitel untersucht die Theorie der Autopoiesis von Maturana und erläutert ihre zentralen Konzepte, wie Selbstreferentialität, den Beobachter und den Wirklichkeitsbegriff. Es beleuchtet die Bedeutung der Autopoiesis für die Erkenntnistheorie und die Beschreibung von Lebewesen als komplexe Systeme.
- Kapitel 2: Die soziologische Systemtheorie nach Luhmann: Dieses Kapitel befasst sich mit Luhmanns soziologischer Systemtheorie. Es erläutert zentrale Konzepte wie Systemdifferenzierung, Autopoiesis, Code und Wirklichkeit. Es wird gezeigt, wie Luhmann die Autopoiesis auf soziale Systeme anwendet und wie diese Theorie für die Beschreibung von gesellschaftlichen Funktionssystemen relevant ist.
- Kapitel 3: Systemtheorie und Literatur: Dieses Kapitel untersucht die Anwendung der Systemtheorie auf literarische Texte. Es analysiert den Roman "Don Quijote" als autopoietisches Textsystem und zeigt die Relevanz der systemtheoretischen Konzepte für die Analyse von literarischen Werken auf. Es wird erläutert, wie Selbstreferentialität im Roman "Don Quijote" funktioniert und welche Bedeutung sie für das Verständnis des Textes hat.
Schlüsselwörter
Autopoiesis, Selbstreferentialität, Beobachter, Wirklichkeitskonstruktion, Systemdifferenzierung, Code, literarisches Textsystem, "Don Quijote", Literaturwissenschaft, Systemtheorie, Soziologie, Biologie, Konstruktivismus.
- Citar trabajo
- Fabienne Schwarz (Autor), 2005, Die systemtheoretischen Theorien Maturanas und Luhmanns mit Ausblick auf die Literaturwissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42093