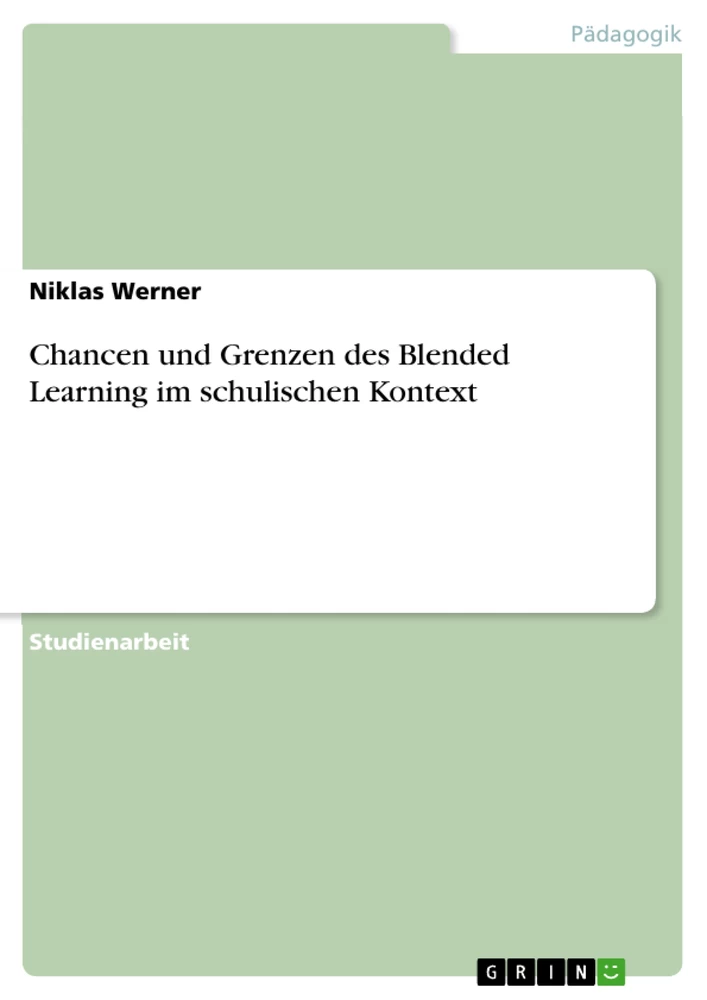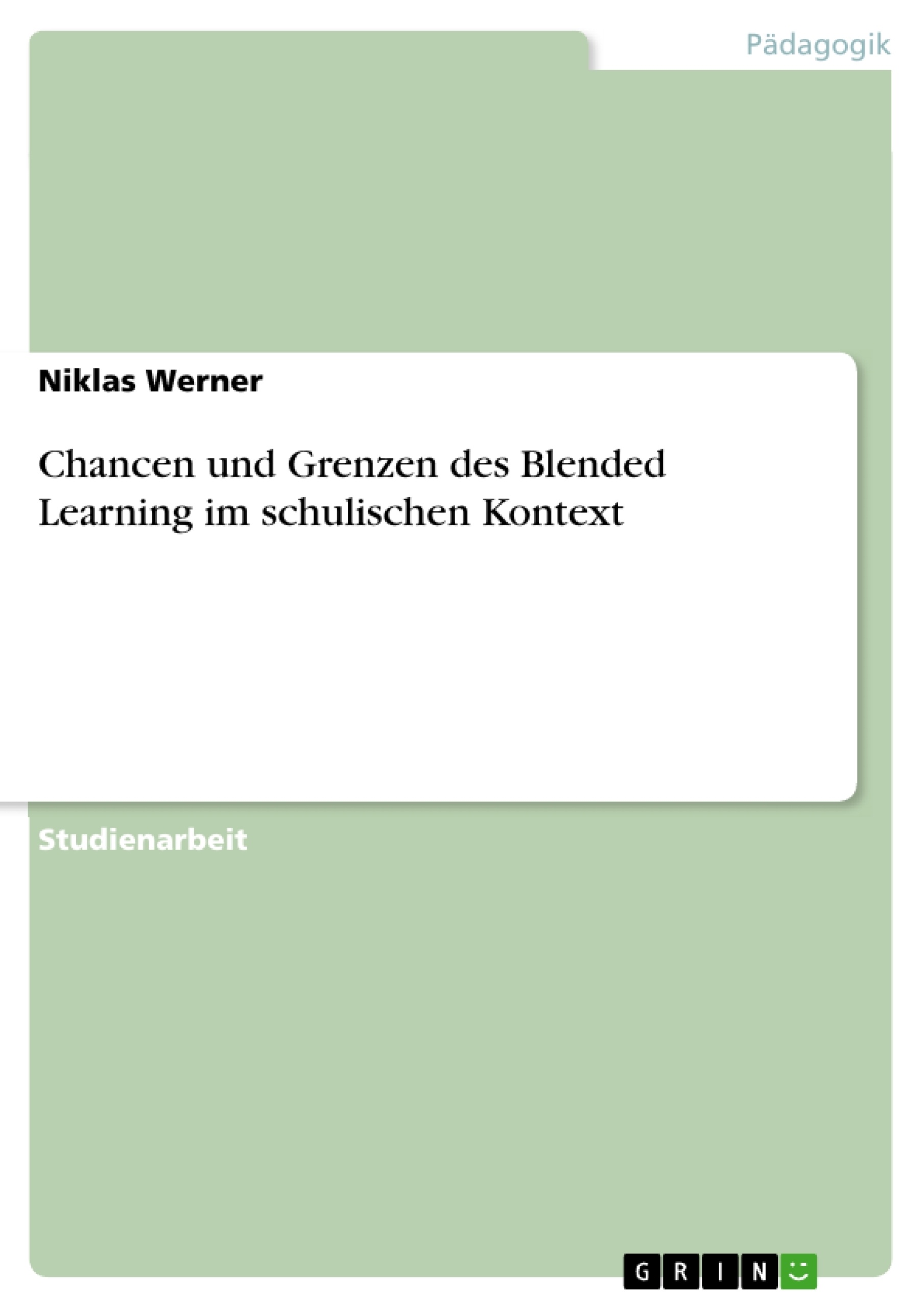Diese Arbeit geht der Leitfrage nach, welche Chancen und Grenzen Blended Learning im schulischen Kontext hat. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich um eine grundlegende Betrachtung handelt. Wer die gewonnenen Erkenntnisse vertiefen möchte, der findet am Ende dieser Arbeit weiterführende Themen zur Empfehlung. Zum Beantworten der dieser Arbeit zugrunde liegenden Leitfrage, soll zunächst eine für diese Arbeit geltende belastbare Definition zum Blended Learning formuliert werden, nach der sich eine Debatte über die Chancen und Grenzen von Blended Learning im schulischen Kontext anschließt. Die Resultate dieser Debatte sollen anhand praxistauglicher Unterrichtsbeispiele dargestellt werden. Es schließt sich im Fazit die Beantwortung der Leitfrage an. Außerdem wird ein Ausblick zum weiteren Verfolgen des Themas gegeben.
Spätestens seit der sozial-liberalen Regierung der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ist Bildung in Deutschland ein Thema, das sich quer durch die Gesellschaft und in verschiedenen Facetten einem hohen Stellenwert erfreut. In Zeiten der Digitalisierung, in denen ganze Berufsbilder von der Bildfläche zu verschwinden drohen, demgegenüber jedoch im quartären Sektor neue Berufsbilder entstehen, erreicht das Thema Bildung einen neuen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion. Heute sind nicht Wenige der Meinung, Bildung schaffe Wohlstand. Ob dem so ist, sei dahingestellt. Demungeachtet erleichtert Bildung im deutschen Gesellschaftssystem den Zugang zu Arbeit. Es bleibt die Frage, in welcher Form Bildungsinstitutionen in Deutschland den digitalen Wandel mitgehen, wie sie diesen in ihren Unterricht integrieren, welche Methoden zur Anwendungen kommen, sowie welche didaktischen Begründungen für die ausgewählten Methoden ins Feld geführt werden.
An welchen Stellen des Unterrichts können traditionelle Lernformen sinnvoll, also zielführend von neuen Lernformen abgelöst werden? In der Diskussion um dieses Thema fallen immer wieder Begriffe wie ‚elearning‘, ‚online-learning‘, ‚web based training‘ und andere. Aus der Diskussion um diese Begriffe etablierte sich auch der Begriff Blended Learning, eine Art Symbiose aus Präsenzlehre und eLearning.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Blended Learning in der Bildungswissenschaft
- Chancen und Grenzen des Blended Learning im schulischen Kontext
- Chancen des Blended Learning im schulischen Kontext
- Grenzen des Blended Learning im schulischen Kontext
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Chancen und Grenzen Blended Learning im schulischen Kontext bietet. Dabei werden traditionelle Lernformen, eLearning und die verschiedenen Formen des eLearning miteinander verglichen, um eine für die Arbeit geltende Definition von Blended Learning zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des Blended Learning und untersucht seine Möglichkeiten und Grenzen im schulischen Umfeld.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Blended Learning
- Chancen von Blended Learning im schulischen Kontext
- Grenzen von Blended Learning im schulischen Kontext
- Praktische Beispiele für den Einsatz von Blended Learning
- Bedeutung von Blended Learning für die Zukunft der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Bildung im digitalen Wandel dar und führt in die Leitfrage der Arbeit ein. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs Blended Learning und grenzt diesen von anderen Begriffen wie eLearning und traditionellen Lernformen ab. Hierfür werden verschiedene Definitionen und Ansätze aus der Literatur vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich den Chancen und Grenzen von Blended Learning im schulischen Kontext.
Schlüsselwörter
Blended Learning, eLearning, Bildung, Schule, Digitalisierung, Chancen, Grenzen, Unterricht, Medien, Lernen, Präsenzlehre, Interaktion, Kollaboration, didaktische Gestaltungsmodelle, Informations- und Kommunikationstechnologien, Schüler, Lehrer.
- Quote paper
- Niklas Werner (Author), 2018, Chancen und Grenzen des Blended Learning im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421334