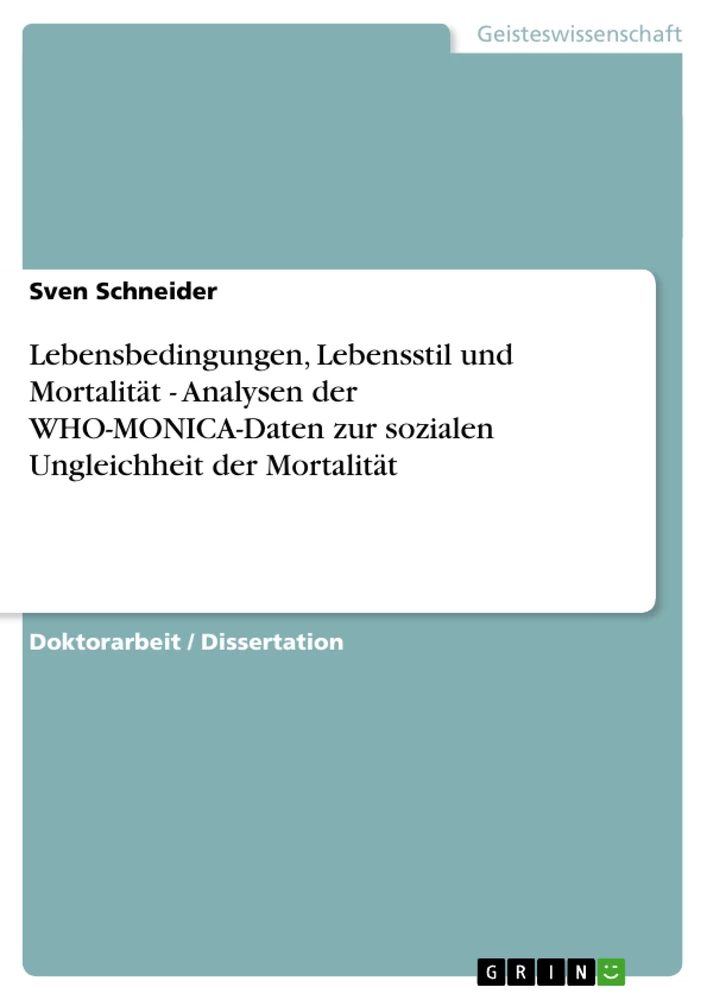Eine große gesellschaftliche und sozialpolitische Herausforderung der Zukunft wird von einer Entwicklung ausgehen, die gemeinhin als ‘demographische Alterung der Gesellschaft’ bezeichnet wird. Angesichts der weiteren Zunahme der Lebenserwartung und des damit fortschreitenden Alterungsprozesses der bundesdeutschen Bevölkerung ist zu vermuten, daß in den nächsten Jahren die Nachfrage seitens politischer und anderer gesellschaftlicher Institutionen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zusammenhang zwischen sozialen Dimensionen und Sterblichkeit zunehmen wird.
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich nicht auf eine – wegen mangelhaften Datenmaterials häufig anzutreffende – eindimensionale Verknüpfung von makrosoziologischen Dimensionen (wie Sozialschicht und Geschlecht) mit Mortalitätsdaten. Ziel dieser Arbeit ist vielmehr, die absolute und relative Bedeutung grundlegender soziologischer Dimensionen für die Mortalität zu erhellen und durch eine Verfeinerung dieser Dimensionen die hinter den makrosoziologischen Strukturen wirksamen Prozesse (Integration, soziale Kontrolle, Belastungsgrößen, lebensstiltypisches Verhalten) zu eruieren.
Ein fruchtbarer Weg stellt dabei die Arbeit mit epidemiologischen Daten dar, da derartige Studien i.d.R. neben klassischen sozioökonomischen und -strukturellen Variablen auch verhaltensbezogene und medizinische Parameter beinhalten. Außerdem sind sie oft longitudinal mit einer ausreichenden Fallzahl an Probanden angelegt.
Im empirischen Teil nimmt aus den o.g. Gründen die Analyse des Zusammenhanges zwischen makrosoziologischen Kategorien und verhaltens- also lebensstilbezogenen Angaben großen Raum ein. Aus den anschließenden zahlreichen multivariaten Verlaufsdatenanalysen gehen die Kategorien Schichtzugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Konfession und Netzwerkstruktur als die bedeutendsten sozialen Einflußgrößen auf die Mortalität hervor. Darüber hinaus stellen Alkohol- und Tabakkonsum die wichtigsten mortalitätsrelevanten Lebensstilaspekte dar. Der eigenständige Einfluß der eben genannten sozialen Kategorien bleibt beachtlicherweise auch nach Kontrolle des Lebensstils und objektiver sowie subjektiver Gesundheitsvariablen (wie Blutparameter, Puls und subjektiver Gesundheitszustand) empirisch relevant. Aus den gefundenen Zusammenhängen werden schließlich Schlußfolgerungen zu möglichen kausalen Ursache-Wirkungs-Beziehungen abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- A Vorbemerkungen
- B Summary
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht den Zusammenhang zwischen sozialen Dimensionen und Mortalität in Deutschland, basierend auf Daten des WHO-MONICA-Projekts. Es mangelt an soziologisch-empirischen Daten zu diesem Thema in Deutschland. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung soziologischer Dimensionen für die Mortalität aufzuzeigen und die zugrundeliegenden Prozesse zu erforschen.
- Soziale Ungleichheit der Mortalität in Deutschland
- Analyse der WHO-MONICA-Daten
- Einfluss soziologischer Dimensionen auf Mortalitätsraten
- Eruierung der Prozesse hinter makrosoziologischen Strukturen
- Vergleich mit Forschungstraditionen anderer Länder
Zusammenfassung der Kapitel
A Vorbemerkungen: Diese Einleitung beschreibt den Entstehungskontext der Arbeit im Rahmen des WHO-MONICA-Projekts und die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und Personen. Sie dankt den beteiligten Personen für ihre Unterstützung und hebt die Bedeutung regelmäßiger Projektbesprechungen und Diskussionen hervor. Die Einleitung betont den Mangel an soziologisch-empirischen Daten zur Mortalität in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Forschung auf diesem Gebiet.
B Summary: Der Summary fasst die zentrale Forschungsfrage der Dissertation zusammen: die Erhellung des Zusammenhangs zwischen sozialen Dimensionen und Mortalität in Deutschland. Er hebt das Defizit an soziologisch-empirischen Daten in Deutschland hervor und betont die Notwendigkeit, über eine eindimensionale Verknüpfung von Makrodaten mit Mortalitätsdaten hinauszugehen. Das Ziel ist die Analyse der absoluten und relativen Bedeutung grundlegender soziologischer Dimensionen für die Mortalität und die Erforschung der Prozesse (Integration, soziale Kontrolle, Belastungsgrößen, Lebensstil), die hinter den makrosoziologischen Strukturen wirken. Die demographische Alterung der Gesellschaft wird als gesellschaftliche Herausforderung genannt, die die Notwendigkeit dieser Forschung unterstreicht.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Mortalität, WHO-MONICA-Daten, Lebensstil, Soziologie, Empirische Forschung, Deutschland, demographische Alterung, Sozialschicht, Geschlecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Soziale Dimensionen und Mortalität in Deutschland
Was ist das Thema der Dissertation?
Die Dissertation untersucht den Zusammenhang zwischen sozialen Dimensionen und Mortalität in Deutschland. Sie analysiert die Bedeutung soziologischer Faktoren für die Mortalitätsraten und die zugrundeliegenden Prozesse, basierend auf Daten des WHO-MONICA-Projekts.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie hängt die Mortalität in Deutschland mit sozialen Dimensionen zusammen? Die Arbeit geht über eine einfache Verknüpfung von Makrodaten mit Mortalitätsdaten hinaus und untersucht die absoluten und relativen Einflüsse soziologischer Dimensionen und die dahinterliegenden Prozesse (Integration, soziale Kontrolle, Belastungsfaktoren, Lebensstil).
Welche Daten werden verwendet?
Die Dissertation basiert auf Daten des WHO-MONICA-Projekts. Es wird hervorgehoben, dass es in Deutschland an soziologisch-empirischen Daten zu diesem Thema mangelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die soziale Ungleichheit der Mortalität in Deutschland, die Analyse der WHO-MONICA-Daten, den Einfluss soziologischer Dimensionen auf die Mortalitätsraten, die Erforschung der Prozesse hinter makrosoziologischen Strukturen und einen Vergleich mit Forschungstraditionen anderer Länder.
Welche Kapitel umfasst die Dissertation?
Die Dissertation enthält mindestens zwei Kapitel: "A Vorbemerkungen" (Einleitung mit Kontextbeschreibung, Danksagungen und Hervorhebung des Forschungsbedarfs) und "B Summary" (Zusammenfassung der zentralen Forschungsfrage, des Datendefizits und der Zielsetzung der Arbeit).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Ungleichheit, Mortalität, WHO-MONICA-Daten, Lebensstil, Soziologie, Empirische Forschung, Deutschland, demographische Alterung, Sozialschicht, Geschlecht.
Welche gesellschaftliche Relevanz hat die Forschung?
Die demografische Alterung der Gesellschaft wird als gesellschaftliche Herausforderung genannt, die die Notwendigkeit dieser Forschung unterstreicht. Die Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse zur sozialen Ungleichheit im Zusammenhang mit Mortalität.
- Citar trabajo
- Privatdozent Dr. Sven Schneider (Autor), 2001, Lebensbedingungen, Lebensstil und Mortalität - Analysen der WHO-MONICA-Daten zur sozialen Ungleichheit der Mortalität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42169