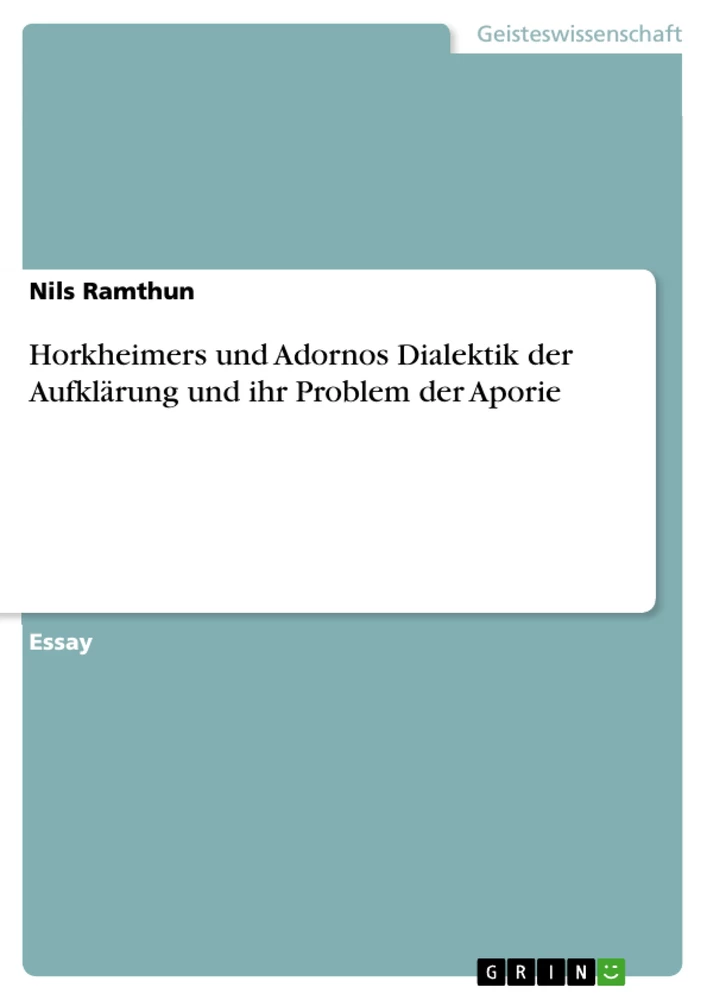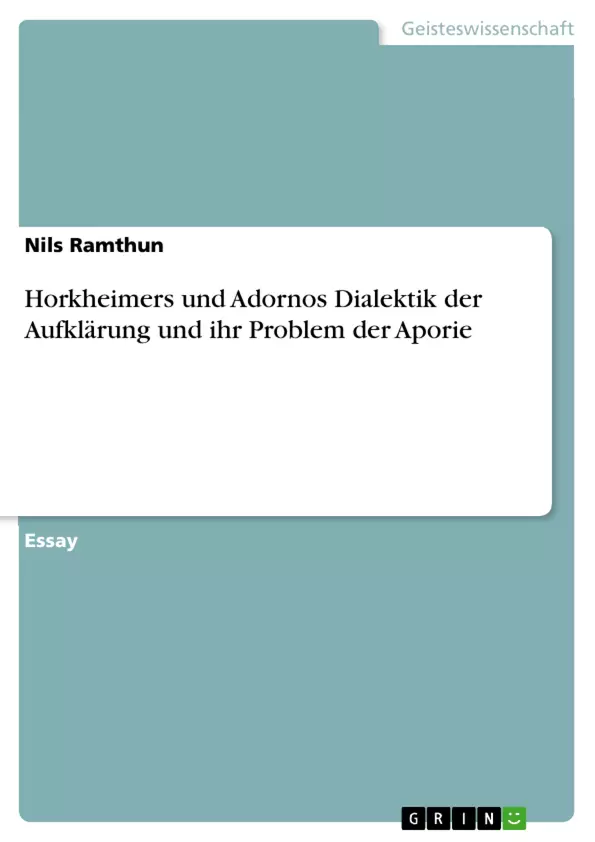Zunächst werde ich eine Skizze des „dialektischen Umschlags” von „Aufklärung in Barbarei” versuchen, indem ich das Verhältnis Aufklärung und Mythos untersuche. Der von Horkheimer und Adorno angeführte homersche Epos, die Odyssee, dem „Grundtext der europäischen Zivilisation”, soll einerseits zur Verdeutlichung herangezogen werden, schließlich aber auf die Kosten der instrumentellen Vernunft gegenüber dem einzelnen Individuum und der Gesellschaft hinführen. Abschließend möchte ich die DdA kritisch bewerten und verständlich machen, warum einzelne Standpunkt Horkeimer und Adornos widersprüchlich sind und in einer Aporie münden (müssen) - hier liegt die ganze Merkwürdigkeit des Buches! Nämlich einmal Aufklärung an-sich führt ins Unheil und ist ebenso unheilbar in blinde Herrschaft verstrickt. Dem nun -fast!- unvereinbar gegenüberstehend ist der von Horkeimer/Adorno formulierte Anspruch einen positiven Aufklärungsbegriff begründen zu wollen, im Sinne einer aus sich selbst selbstreflektierten Aufklärung. Angesichts des historischen Entstehungshorizontes wandelt die DdA stets am Abgrund: einerseits einer pessimistisch-resignativen Einsicht, anderseits dann dem Versuch progressiv-optimistischer Dialektik treubleiben zu wollen
Inhaltsverzeichnis
- I. Das Moment des dialektischen Umschlags von Aufklärung in Barbarei: Mythos, Aufklärung und instrumentelle Vernunft
- 1. Aufklärung, Mythos und das Moment des dialektischen Umschlags
- 2. Die instrumentelle Vernunft und der Mythos
- 3. Aufklärung und Mythos in der Odyssee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Dialektik der Aufklärung" von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno und analysiert deren zentralen These, dass die Aufklärung selbst zur Barbarei führt. Sie beleuchtet das komplexe Verhältnis von Mythos und Aufklärung und die Rolle der instrumentellen Vernunft als treibende Kraft hinter diesem dialektischen Umschlag.
- Die Dialektik von Mythos und Aufklärung
- Die instrumentelle Vernunft als Motor der Barbarei
- Die Rolle der Odyssee als Beispiel für die dialektische Beziehung von Mythos und Aufklärung
- Kritik an Horkheimer und Adornos These vom unheilbaren Charakter der Aufklärung
- Die Aporie des Aufklärungsbegriffs in der „Dialektik der Aufklärung"
Zusammenfassung der Kapitel
I. Das Moment des dialektischen Umschlags von Aufklärung in Barbarei: Mythos, Aufklärung und instrumentelle Vernunft
Das erste Kapitel beleuchtet das Verhältnis von Mythos und Aufklärung als dialektisches Verhältnis. Es wird erläutert, wie der Mythos die Aufklärung in sich trägt und wie die Aufklärung wiederum im Mythos zurückfällt. Der Autor zeigt auf, dass die instrumentelle Vernunft, die auf Ausbeutung und Beherrschung ausgerichtet ist, als treibende Kraft hinter diesem dialektischen Umschlag agiert. Um dieses Verhältnis zu verdeutlichen, analysiert er die Odyssee als Beispiel für die Verstrickung von Mythos und Aufklärung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die Dialektik der Aufklärung, Mythos, instrumentelle Vernunft, Barbarei, Odysseus, Odyssee, Aporie, Horkheimer, Adorno, positivismus, Herrschaft, Wissenschaft und Gentechnologie. Die Arbeit konzentriert sich auf die zentrale These, dass die Aufklärung in der dialektischen Beziehung zum Mythos in Barbarei umschlägt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese der "Dialektik der Aufklärung"?
Die zentrale These von Horkheimer und Adorno ist, dass Aufklärung in Barbarei umschlägt, wenn sie sich in instrumenteller Vernunft erschöpft.
Warum wird die Odyssee als Beispiel herangezogen?
Odysseus wird als früher Repräsentant des modernen Individuums gesehen, das durch List und instrumentelle Vernunft den Mythos besiegt, sich aber dabei selbst verleugnet.
Was verstehen die Autoren unter "instrumenteller Vernunft"?
Eine Form des Denkens, die nur noch auf Zweckmäßigkeit, Beherrschung der Natur und Effizienz ausgerichtet ist und den Sinn für das Ganze verliert.
Was bedeutet Aporie in diesem Zusammenhang?
Es beschreibt die Unausweichlichkeit des Widerspruchs: Aufklärung ist notwendig, führt aber gleichzeitig in das Unheil der totalen Herrschaft.
Gibt es einen Ausweg aus der Barbarei laut den Autoren?
Nur durch eine Selbstreflexion der Aufklärung, die ihre eigenen blinden Flecken und ihren Hang zur Herrschaft erkennt.
- Arbeit zitieren
- Nils Ramthun (Autor:in), 2001, Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung und ihr Problem der Aporie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4217