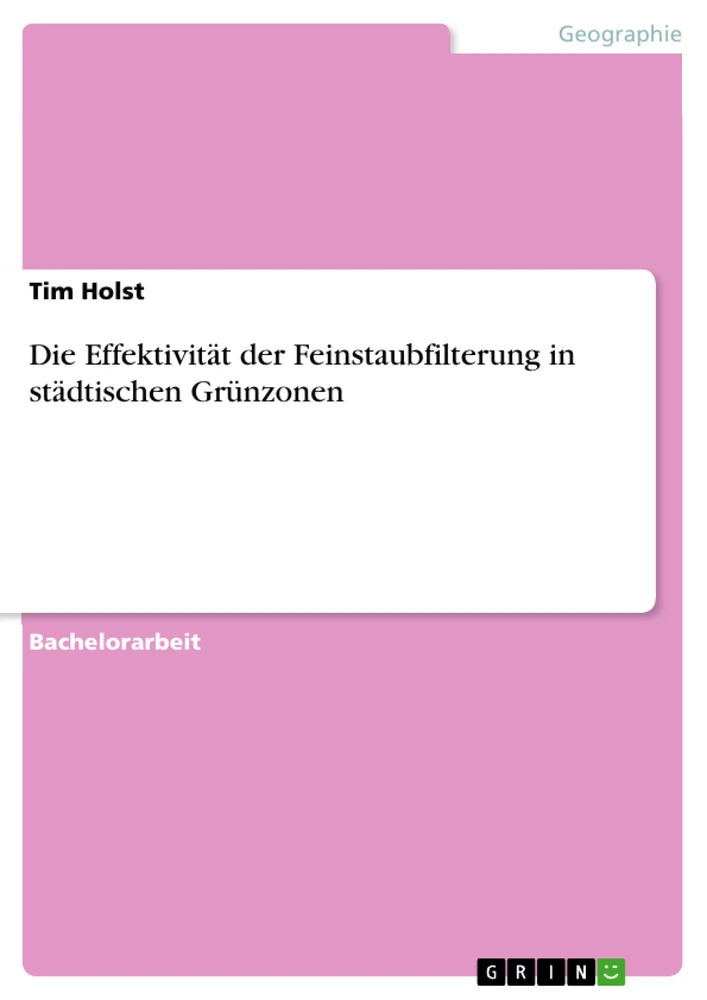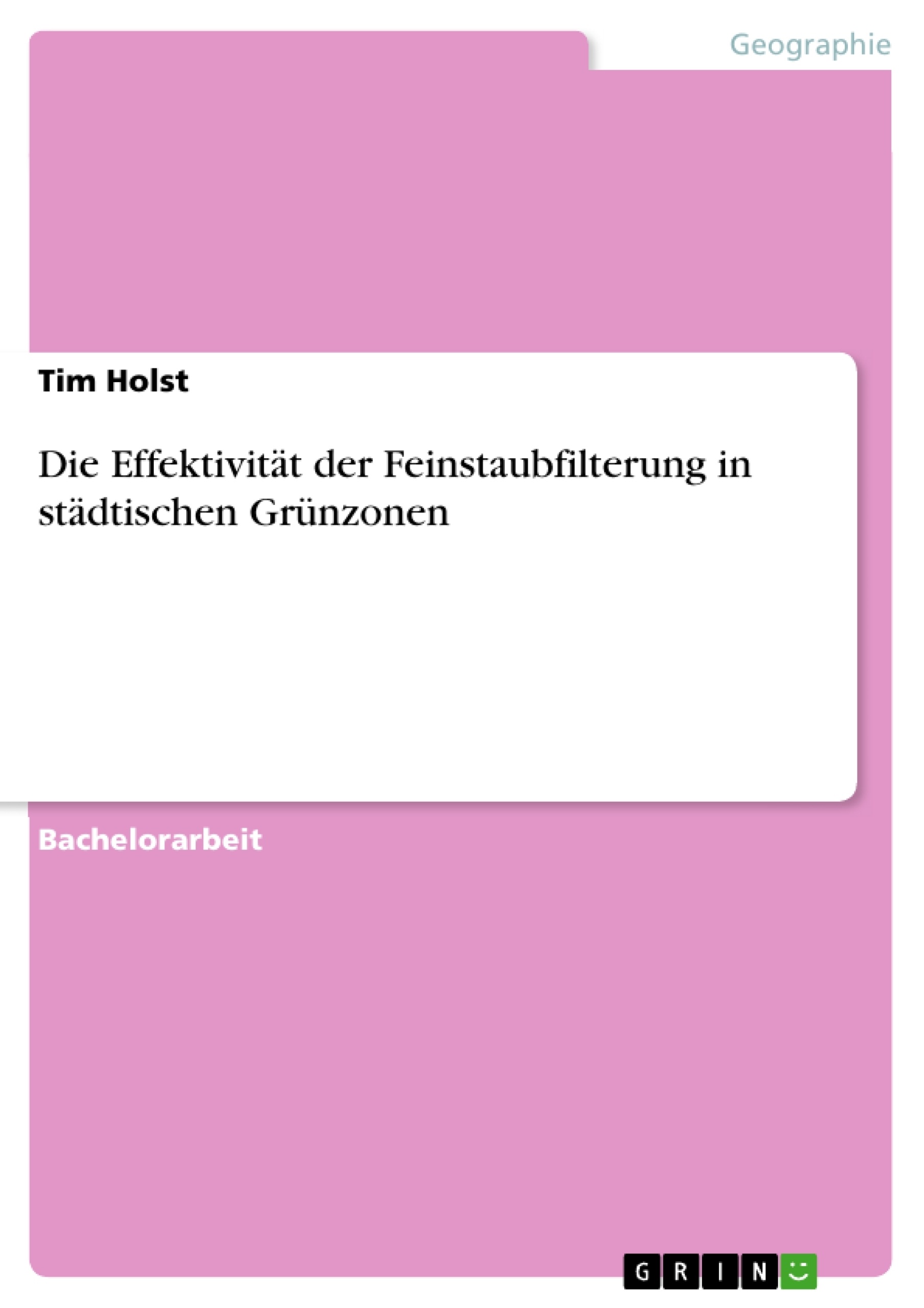Im Zuge der globalen Verstädterungsprozesse des 21. Jahrhunderts wird die Diskussion um die Feinstaubbelastung der Luft, ihrer Auswirkungen sowie Einschränkungsmöglichkeiten angesichts der drastisch steigenden Populationszahlen in Stadt- und Ballungsräumen immer polemischer. Das Bevölkerungswachstum einer Stadt korreliert mit der zunehmenden mehrdimensionalen Bedürfnisbefriedigung seiner BewohnerInnen, die durch differente Lebensstiltypen charakterisiert sind, und mit einer erhöhten Nutzung der Wirtschaftssektoren. Dieses kann sich mehr oder minder negativ auf die Umwelt auswirken. Aus diesen Gründen und wegen der permanenten Informationsübertragung mittels digitaler Medien ist die Feinstaubproblematik derart präsent wie nie zuvor in den letzten Jahrzehnten. Eines der Beispiele, die diese Präsenz evoziert, ist die Bevölkerung in China, da diese permanent einen Mundschutz trägt, um sich vor der toxikologischen Wirkung zu schützen. Ein europäisches Beispiel stellt Paris dar, dessen Regierung Fahrzeughaltern die Einfahrt in das Zentrum nur noch mit einer Feinstaubplakette erlaubt, um den erhöhten Konzentrationen entgegenzuwirken. Das aktuellste deutsche Beispiel stellt Stuttgart dar. In dieser Stadt herrschen aufgrund der hohen Belastung der Luft mit Partikeln und Stickoxiden regelmäßig Heiz-, Verkehrs- und Durchfahrtsverbote sowie Protestaktionen.
In Deutschland weist die Belastung der Luft mit partikulären Substanzen seit 1990 eine deutliche Abnahme auf, jedoch werden die geltenden Grenzwerte in vielen Städten kontinuierlich überschritten. Die Emission von Feinstaub ist auf unterschiedliche Quellen zurückzuführen, wobei der prozentuale Anteil menschlicher Aktivitäten deutlich überwiegt. Eine mögliche Maßnahme zur Reduzierung des Feinstaubs ist Stadtgrün, das aufgrund seiner Präsenz zahlreiche Wohlfahrtswirkungen ausüben kann. Für Beschäftigte im Bereich der Stadt- und Raumplanung, der Architektur, der Stadt- und Landschaftsökologie, des Garten- und Landschaftsbaus sowie der Bauwerksbegrünung sind Untersuchungen der Vegetationsleistung zur Filterung von Luftschadstoffen dringend erforderlich. Es existieren merklich wenig umfangreiche und vollständige Studien, die Methodik und Ergebnisse vieler verschiedener Pflanzenarten überschaubar und präzise vergegenständlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Feinstaubproblematik
- 2.1 Definition und Entstehung
- 2.2 Verhalten der Partikel in der Luft
- 2.3 Gesetzliche Grundlagen in der Europäischen Union und Deutschland
- 2.4 Aktuelle Situation in Deutschland
- 2.5 Auswirkungen der Feinstaubbelastung
- 3. Literaturstudie zur Effektivität der Feinstaubfilterung von Stadtgrün
- 3.1 Begründung der Auswahl
- 3.2 In situ und ex situ Untersuchungen an einzelnen Baumarten und einem Waldgebiet
- 3.2.1 Langner (2006): Exponierter innerstädtischer Spitzahorn (Acer platanoides) – eine effiziente Senke für PM10?
- 3.2.2 Alfani et al. (1996): Leaf contamination by atmospehric pollutants as assessed by elemental analysis of leaf Tissue, leaf surface deposit and soil ...
- 3.2.3 Beckett et al. (2000): The capture of particulate pollution by trees at five contrasting urban sites .....
- 3.3 Ex situ Untersuchungen an verschiedenen Pflanzenarten
- 3.3.1 Flohr, S. (2010): Untersuchungen zum Fangvermögen von Mittel- und Feinstaub (PM10 und PM2.5) an ausgesuchten Pflanzenarten unter Berücksichtigung der morphologischen Beschaffenheit der Blatt und Achsenoberflächen und der Einwirkung von Staubauflagen auf die Lichtreaktion der Photosynthese…….......
- 3.3.2 Gorbachevskaya, O.; Herfort, S.; (2012): Feinstaubbindungsvermögen der für die Bauwerksbegrünung typischen Pflanzen.
- 3.3.3 Frahm, J.-P.; Sabovljevic, M. (2007): Feinstaubreduzierung durch Moose
- 3.4 Zwischenfazit
- 4. Die Effektivität der Feinstaubfilterung alternativer Maßnahmen im Vergleich zu Stadtgrün
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Effektivität von Stadtgrün bei der Filterung von Feinstaub. Die Arbeit zielt darauf ab, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Feinstaubbindungsmechanismen von Pflanzen zu analysieren und die Wirksamkeit von Stadtgrün im Vergleich zu alternativen Maßnahmen zu bewerten.
- Die Feinstaubproblematik und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
- Die Rolle von Stadtgrün bei der Feinstaubfilterung
- Die Effektivität verschiedener Pflanzenarten und -formen bei der Feinstaubbindung
- Vergleich der Feinstaubfilterung von Stadtgrün mit anderen Maßnahmen
- Relevanz von Stadtgrün für die Luftqualität und das menschliche Wohlbefinden
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 legt die Grundlagen der Feinstaubproblematik dar. Es werden Definition, Entstehung, Verhalten der Partikel in der Luft sowie gesetzliche Grundlagen und die aktuelle Situation in Deutschland erläutert. Die Auswirkungen der Feinstaubbelastung auf die menschliche Gesundheit werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert wissenschaftliche Studien zur Effektivität der Feinstaubfilterung durch Stadtgrün. Dabei werden sowohl In-situ- als auch Ex-situ-Untersuchungen an einzelnen Baumarten und einem Waldgebiet sowie an verschiedenen Pflanzenarten betrachtet. Die Ergebnisse dieser Studien werden zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Relevanz für die Feinstaubreduktion in urbanen Gebieten diskutiert.
Schlüsselwörter
Feinstaub, Stadtgrün, Luftqualität, Feinstaubfilterung, PM10, PM2.5, Pflanzen, Bäume, Moose, urbane Gebiete, Gesundheit, Umwelt
Häufig gestellte Fragen
Kann Stadtgrün wirklich Feinstaub filtern?
Ja, die Bachelorarbeit untersucht wissenschaftliche Belege dafür, dass Pflanzen wie Bäume und Moose als effiziente Senken für PM10 und PM2.5 Partikel fungieren.
Welche Pflanzenarten sind besonders effektiv bei der Filterung?
Die Arbeit analysiert Studien zu Baumarten wie dem Spitzahorn (Acer platanoides) sowie die hohe Filterleistung von Moosen und Bauwerksbegrünungen.
Was sind PM10 und PM2.5?
Dies sind Bezeichnungen für Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 10 bzw. 2,5 Mikrometern, die gesundheitsgefährdend sein können.
Gibt es gesetzliche Grenzwerte für Feinstaub in Deutschland?
Ja, die Arbeit erläutert die gesetzlichen Grundlagen der EU und Deutschlands, die darauf abzielen, die Feinstaubbelastung in Ballungsräumen zu begrenzen.
Wie verhalten sich Partikel in der Luft in Bezug auf Vegetation?
Die Partikel lagern sich auf den Blatt- und Achsenoberflächen ab. Die morphologische Beschaffenheit der Blätter spielt dabei eine entscheidende Rolle für das Fangvermögen.
- Citar trabajo
- Tim Holst (Autor), 2017, Die Effektivität der Feinstaubfilterung in städtischen Grünzonen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423675