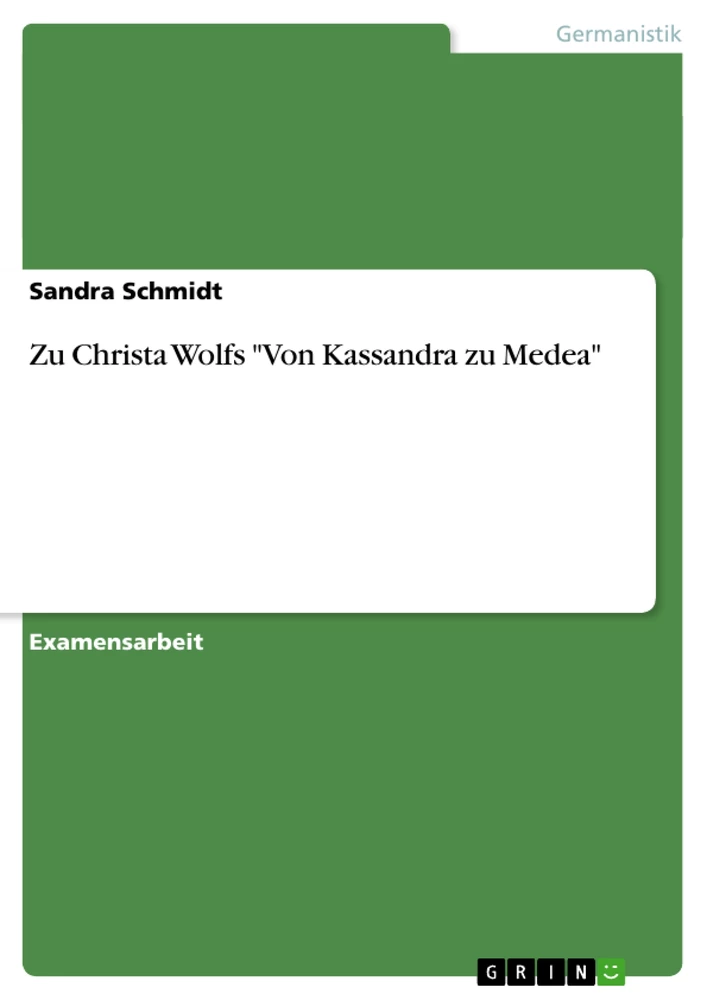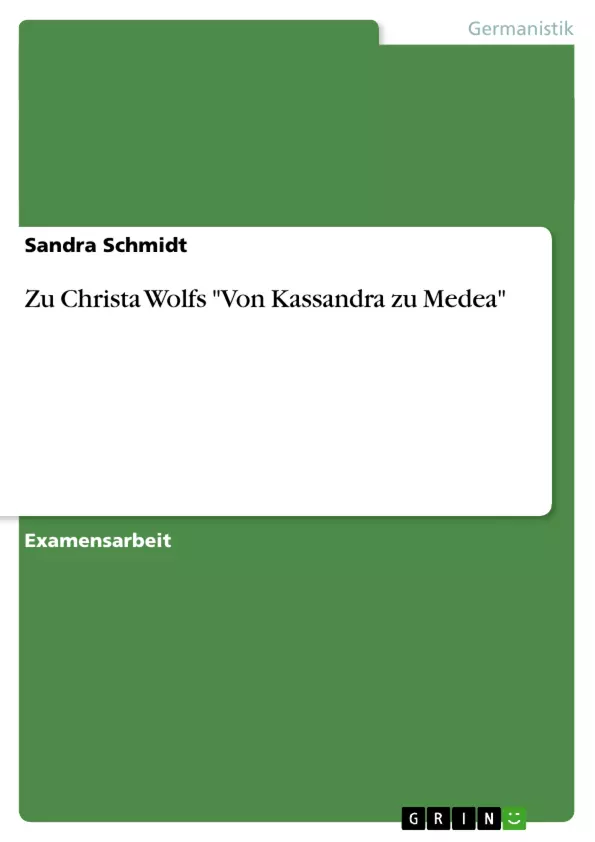„Dein schöner Stoff, Christa, ging mir tief unter die Haut. [...] Aber glaubst Du, dass man so entblößt leben kann, dass Du so leben kannst?“ fragt die früh verstorbene Schriftstellerin Maxie Wander, die mit authentischen Protokollen von Frauen aus der DDR unter dem Titel „Guten Morgen, Du Schöne“ bekannt wurde, ihrer Freundin Ende der 1970er Jahre. An Christa Wolf fasziniert nicht zuletzt das Engagement und die Unbedingtheit, mit der sie sich selbst als Mensch, als Persönlichkeit in die Literatur und in das öffentliche Geschehen einbringt.
Das Eingangszitat ist die verkürzte Version des Satzes „Reden geht nicht, schweigen will ich nicht, trottlig dabeisitzen?“ aus einem Brief Christa Wolfs, mit dem sie im März 1978 etwas ratlos auf eine Frauentagskarte von Franz Fühmann antwortet, der sich vorsichtig erkundigt hatte, ob sie denn „zu Schriftstellers zu Kongress“ [sic] gehe. Christa Wolf hat sich immer wieder redend eingemischt und dabei auch Vergeblichkeit, Aussichtslosigkeit kennen gelernt, so dass das Reden ihr gelegentlich als unzureichende Handlungsmöglichkeit erschienen ist. Doch zwischen reden und schweigen liegt für sie eben nicht „trottlig dabeisitzen“, sondern schreiben: „Doch hat es Sinn, sich zum Sprechen zu zwingen, auch wenn einem vor den Fakten, den Taten und dem was zu tun ist, das Wort im Hals stecken bleiben will.“ Sprechen und Schreiben sind für Christa Wolf die wichtigsten Instrumente zur Überwindung dieses Zustandes der Sprachlosigkeit, den sie in verschiedenen, inzwischen historisch gewordenen Situationen an sich selbst und anderen erlebt hat. Kassandra und Medea sind in der Version von Christa Wolf also nicht zufällig Frauen, die ihre eigenen Gegenwartserfahrungen gerade unter widrigen Umständen zur Sprache bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung: Zeitgenossenschaft und Authentizität
- 2. Literatur und Zeitgeschichte
- 2.1 Situation I - Von Biermann zu Kassandra
- 2.2 Situation II - Die Wende zwischen Kassandra und Medea. Stimmen
- 2.3 Schreibimpuls: Gegenwartserfahrung
- 2.4 Nachdenken über Mythen
- 3. Das Kassandra - Projekt
- 3.1 Eine Poetik-Vorlesung auf der Suche nach Poetik
- 3.2 Kassandra-Erzählung
- 3.2.1 Ein Monolog mit leiser Stimme
- 3.2.2 Die innere Geschichte der Kassandra
- 3.2.3 Die äußere Geschichte der Stadt Troia
- 4. Medea. Stimmen
- 4.1 Jetzt hören wir Stimmen
- 4.2 Im Spiegel der anderen
- 4.2.1 Medea - Die wilde Frau?
- 4.2.2 Von Glauke zu Agameda – Frauenschicksale
- 4.2.3 Jason, Leukon und Akamas – Zwischen Anpassung und Macht
- 5. Schreiben und Sprechen
- 5.1 Wer wird und wann die Sprache wiederfinden? Sprache in Kassandra
- 5.2 Jeder spricht für sich allein – Sprache der Medea. Stimmen
- 5.3 Weibliches Schreiben - Weibliches in der Sprache
- 6. Umdeutung von Mythen zur Utopie?
- 6.1 Utopie und Heterotopie in Kassandra
- 6.2 Keine Utopie, nirgends in Medea. Stimmen?
- 7. Was bleibt? - Ein Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die beiden Romane „Kassandra“ (1983) und „Medea. Stimmen“ (1996) von Christa Wolf im Kontext ihrer Zeitgenossenschaft und Authentizität. Die Analyse beleuchtet die Verbindung zwischen Wolfs literarischem Schaffen und ihrem persönlichen Engagement in der DDR und der deutschen Geschichte. Die Arbeit untersucht, wie Wolf Mythen und historische Ereignisse in ihren Romanen verarbeitet und gleichzeitig ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken zum Ausdruck bringt.
- Die Verbindung zwischen Literatur und Zeitgeschichte in Christa Wolfs Werk
- Die Rolle von Frauen in der Gesellschaft und in der Literatur
- Die Auseinandersetzung mit Mythen und deren Relevanz in der Gegenwart
- Die Bedeutung von Sprache und Schreiben für die Bewältigung von gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderungen
- Die Suche nach Utopie in der Geschichte und der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Zeitgenossenschaft und Authentizität
Das Kapitel beleuchtet die kontroversen Reaktionen auf Christa Wolfs Werk und ihre Persönlichkeit im Kontext der deutschen Geschichte und des Literaturstreits nach der Wende. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit Wolfs Werk und ihre Haltung als Person untrennbar miteinander verbunden sind.
Kapitel 2: Literatur und Zeitgeschichte
Das Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Wolfs literarischem Schaffen und der politischen Situation in der DDR. Es analysiert ihre Reaktion auf die Ausbürgerung Wolf Biermanns sowie die politische Wende und ihre Auswirkungen auf ihre literarische Arbeit.
Kapitel 3: Das Kassandra - Projekt
Das Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Romans „Kassandra“. Es werden die poetischen Aspekte des Romans sowie die innere und äußere Geschichte der Titelfigur Kassandra analysiert.
Kapitel 4: Medea. Stimmen
Das Kapitel widmet sich dem Roman „Medea. Stimmen“ und betrachtet die verschiedenen Stimmen und Perspektiven, die in dem Werk zum Ausdruck kommen. Es werden die komplexen Beziehungen zwischen den Figuren sowie die Rolle von Medea und anderen Frauen im Roman untersucht.
Kapitel 5: Schreiben und Sprechen
Das Kapitel analysiert die Bedeutung von Sprache und Schreiben in Wolfs Romanen. Es betrachtet, wie die Figuren mit Sprache umgehen und wie sie durch Sprache ihre individuellen Erfahrungen und Gedanken ausdrücken können.
Kapitel 6: Umdeutung von Mythen zur Utopie?
Das Kapitel untersucht die Rolle von Mythen in Wolfs Romanen und die Frage, inwieweit die Mythen als Mittel zur Gestaltung von Utopien dienen können.
Schlüsselwörter
Christa Wolf, Literatur, Zeitgeschichte, DDR, Wende, Kassandra, Medea, Mythos, Utopie, Sprache, Schreiben, Authentizität, Zeitgenossenschaft, Frauenliteratur, politische Engagement, Identität.
Häufig gestellte Fragen
Warum wählte Christa Wolf Mythen wie Kassandra und Medea?
Wolf nutzt diese antiken Figuren, um zeitlose Erfahrungen von Frauen in patriarchalen Machtstrukturen und ihre eigene Situation in der DDR-Geschichte zu reflektieren.
Was ist das zentrale Thema von "Medea. Stimmen"?
Der Roman deutet den Medea-Mythos um: Medea ist hier keine Kindsmörderin, sondern eine Sündenbock-Figur in einer korrupten Gesellschaft, die ihre Unabhängigkeit fürchtet.
Wie hängen Literatur und Zeitgeschichte bei Christa Wolf zusammen?
Ihre Werke sind oft Reaktionen auf politische Ereignisse wie die Ausbürgerung Biermanns oder die deutsche Wende, verarbeitet durch eine "subjektive Authentizität".
Welche Rolle spielt die Sprache in Wolfs Werk?
Sprechen und Schreiben sind Instrumente zur Überwindung von Sprachlosigkeit gegenüber Machtstrukturen und zur Suche nach einer eigenen, weiblichen Stimme.
Was bedeutet "weibliches Schreiben" für Christa Wolf?
Es ist der Versuch, eine Erzählweise zu finden, die nicht den traditionellen, oft gewaltvollen und linearen (männlichen) Strukturen folgt, sondern Ganzheitlichkeit anstrebt.
- Citar trabajo
- Sandra Schmidt (Autor), 2005, Zu Christa Wolfs "Von Kassandra zu Medea", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42412