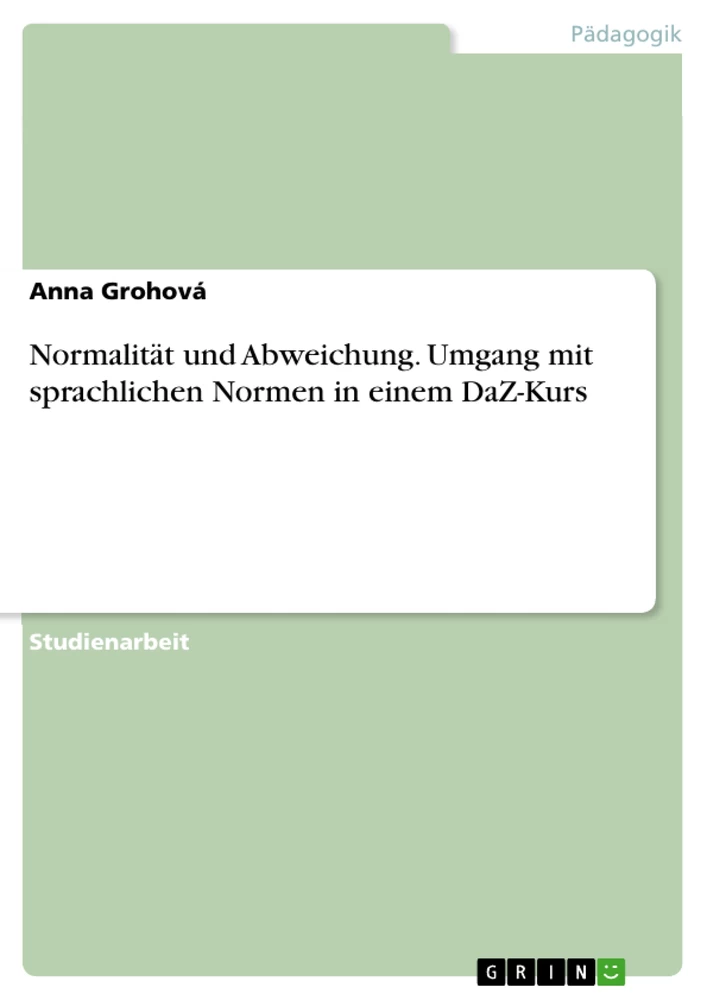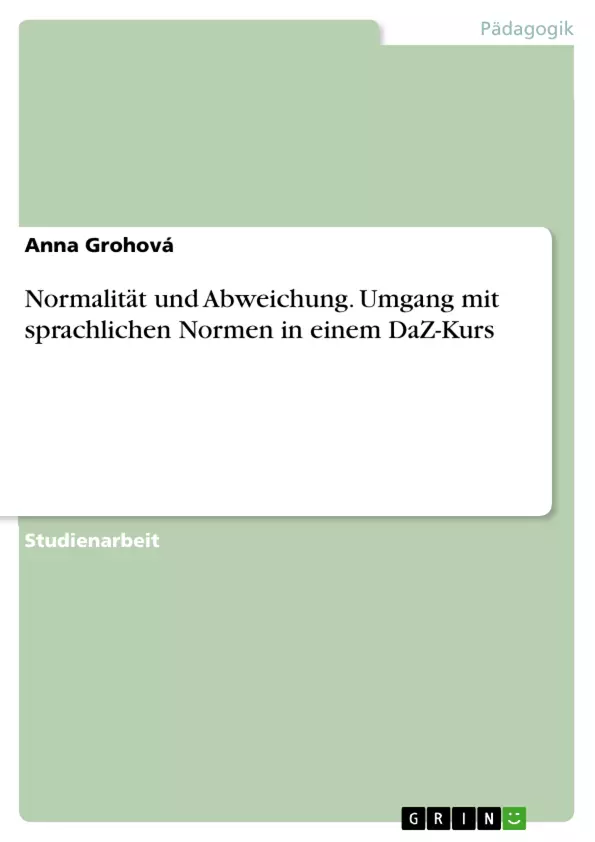Die Sprachkurse werden oft von ehrenamtlichen Mitarbeiter ohne ausreichende fachliche Ausbildung geleitet. Es ist unbestreitbar, dass diese Lehrpersonen nur das Beste für die Lernenden tun wollen. Im Bereich der direkten oder indirekten Normenvermittlung stoßen sie allerdings an zahlreiche Herausforderungen, dessen unsensible Handhabung die Motivation der Lernenden negativ beeinflussen kann. Die Art und Weise der Normenvermittlung hängt von äußeren und inneren Faktoren ab.
Zu den äußeren/fremdbestimmten Faktoren gehören die institutionellen und curricularen Vorgaben, gesellschaftliche Faktoren, gesetzliche Normen und Vorschriften (zum Beispiel Migrations- und Asylgesetze). Zu den inneren Faktoren gehört vor allem Hintergrundwissen der Lehrperson, beziehungsweise Unterscheidung und Typisierung von diesem Hintergrundwissen. Diese Prozesse sind später dafür verantwortlich, wie die Normen verstanden, angewendet und beurteilt werden.
Das Hintergrundwissen der Lehrperson ist wiederum von weiteren Faktoren abhängig – demographische, psychologische, soziale, wirtschaftliche Lage, aber auch persönliche Erfahrungen mit den exponierten Themen (Stigmatisierung, Diskriminierung, Othering, Linguizismus, Rassismus und Andere). Man findet keine zwei Menschen mit einem hundertprozentig gleichen Hintergrundwissen und Lebenserfahrungen – darum ist die Normwahrnehmung und -umsetzung auch sehr individuell.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Norm und Normalität in der Interaktion
- Soll-Norm
- Ist-Norm
- Normbewusstsein im menschlichen Handeln
- Sollen
- Können
- Müssen
- Naturgesetzliches Müssen
- Logisches Müssen
- Normatives Müssen
- Müssen der notwendigen Bedingung
- Normkonformität vs. Abweichung und ihre gesellschaftlichen Folgen
- Stigmatisierung und Othering
- Linguizismus
- Neolinguizismus
- Anti-Linguizismus vs. Linguizismuskritik
- Norm und Normalität in der Interaktion
- Methodenteil
- Leitfadengestütztes Interview
- Form und Erstellung des Leitfadens
- Vorteile und Nachteile der Methode
- Teilnehmende Beobachtung
- Durchführung des Beobachtungsverfahrens
- Vorteile und Nachteile der Methode
- Auswertungsmethode: Globalauswertung
- Beschreibung der einzelnen Schritte
- Repräsentation und Interpretation
- Ethische Verantwortung
- Positionierung
- Mögliche Einflüsse auf die Forschungssubjekten
- Auswertung
- Leitfadengestütztes Interview
- Zusammenfassung und Bewertung
- Sprachkenntnisse als Bedingung für die Integration
- Curriculare Vorgaben
- Selbstbestimmte Normen
- Normbildung und -anwendung: Kursleiterin
- Normbildung und -anwendung: Kursteilnehmer
- Hintergrundwissen der Kursleiterin und seine Einflüsse
- Akzent, Sprache, Zugehörigkeit
- Stigmatisierung und Othering
- Normabweichung und ihre Gründe und Folgen
- Anerkennung, Linguizismus und Othering: Wie viel Anerkennung ist zu viel Anerkennung?
- Konfrontationssituationen
- Weitere Forschungsperspektiven
- Mehrsprachigkeit und Prestigenorm in der Bildung
- Sprache und Identität bei Personen mit Migrations- und Fluchterfahrung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Hintergrundwissen und die Lebenserfahrungen einer Lehrperson in einem Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Kurs für Personen mit Fluchterfahrung und analysiert, wie diese Faktoren in die Normenvermittlung im Kurs einfließen, insbesondere im Hinblick auf die sprachliche Norm und Aussprache. Die Arbeit möchte erklären, wie das Hintergrundwissen der Lehrperson die Wahrnehmung und Umsetzung von Normen im DaZ-Kurs beeinflusst und welche Auswirkungen dies auf die Lernenden hat.
- Der Einfluss von Normen und Normalität auf die Interaktion im DaZ-Kurs
- Die Bedeutung von Normbildung und -anwendung im Kontext von Fluchterfahrung
- Die Rolle von Stigmatisierung, Othering und Linguizismus im DaZ-Unterricht
- Die Auswirkungen von Normabweichung auf die Integration und Teilhabe der Lernenden
- Die Bedeutung von sprachlichen Normen und Aussprache für die Integration und gesellschaftliche Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die gesellschaftliche Doppelmoral gegenüber Mehrsprachigkeit und die Bedeutung von Deutsch als Zweitsprache für Integration und Teilhabe von Geflüchteten. Die Arbeit verdeutlicht die Herausforderungen für Lehrpersonen im DaZ-Unterricht, insbesondere in Bezug auf die Vermittlung von Normen. Im theoretischen Teil werden die Begriffe Norm und Normalität anhand verschiedener Perspektiven erläutert, wobei die Entstehung von Normen, die Arten von Normen und die Folgen von Normabweichung im Mittelpunkt stehen.
Der Methodenteil beschreibt den Forschungsprozess, der auf einem leitfadengestützten Interview und teilnehmender Beobachtung basiert. Das Interview soll Einblicke in das Hintergrundwissen und die Lebenserfahrungen der Lehrperson geben, während die Beobachtung die Übereinstimmung zwischen den Aussagen der Lehrperson und der Kursrealität untersuchen soll. Die Auswertung wird in Unterkapitel unterteilt, die sich mit fremdbestimmten Normen, selbstbestimmten Normen, den Erfahrungen der Kursleiterin und ihren Einflüssen sowie mit Normabweichung und deren Gründen und Folgen beschäftigen.
Die Zusammenfassung und Bewertung soll eine Hypothese über die Entstehung, Anwendung, Einflüsse und Auswirkungen von sprachlichen und nichtsprachlichen Normen in einem DaZ-Kurs formulieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Normen, Normalität, Sprache, Mehrsprachigkeit, Integration, Teilhabe, Fluchterfahrung, DaZ-Kurs, Lehrperson, Hintergrundwissen, Lebenserfahrung, Stigmatisierung, Othering, Linguizismus, Normabweichung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen persönliche Erfahrungen der Lehrkraft den DaZ-Unterricht?
Persönliches Hintergrundwissen, wie Erfahrungen mit Diskriminierung oder soziale Herkunft, prägt individuell, wie Lehrkräfte sprachliche Normen wahrnehmen und an die Lernenden vermitteln.
Was versteht man unter „Othering“ im Bildungskontext?
Othering bezeichnet den Prozess, bei dem Gruppen (z. B. Geflüchtete) als „anders“ oder „fremd“ markiert werden, was im Unterricht zu Ausgrenzung und einer Abwertung ihrer Identität führen kann.
Welche Rolle spielt der Linguizismus in Sprachkursen?
Linguizismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund der Sprache oder des Akzents. Im DaZ-Kurs kann dies dazu führen, dass bestimmte Sprachvarianten als minderwertig angesehen werden.
Was sind äußere Faktoren der Normenvermittlung?
Dazu gehören gesetzliche Vorgaben (Migrationsgesetze), curriculare Lehrpläne und gesellschaftliche Erwartungen an die Integration durch Sprache.
Warum ist die Aussprache für die Integration so wichtig?
Eine Annäherung an die Standardaussprache wird oft als Bedingung für gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung angesehen, während starke Abweichungen zu Stigmatisierung führen können.
- Citation du texte
- M.A. Anna Grohová (Auteur), 2017, Normalität und Abweichung. Umgang mit sprachlichen Normen in einem DaZ-Kurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424518