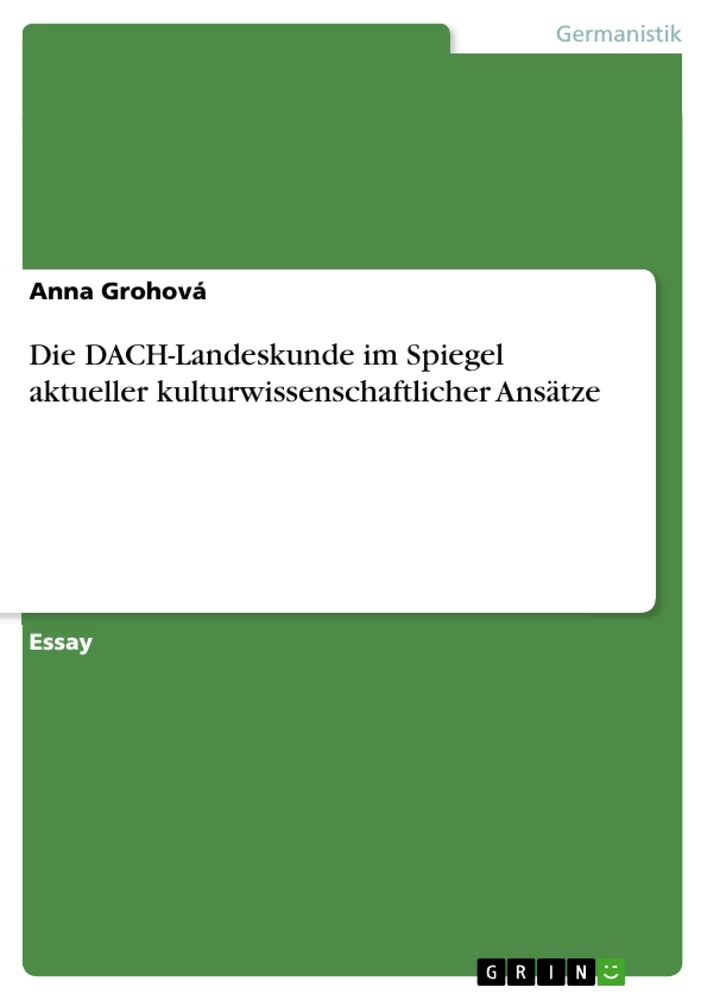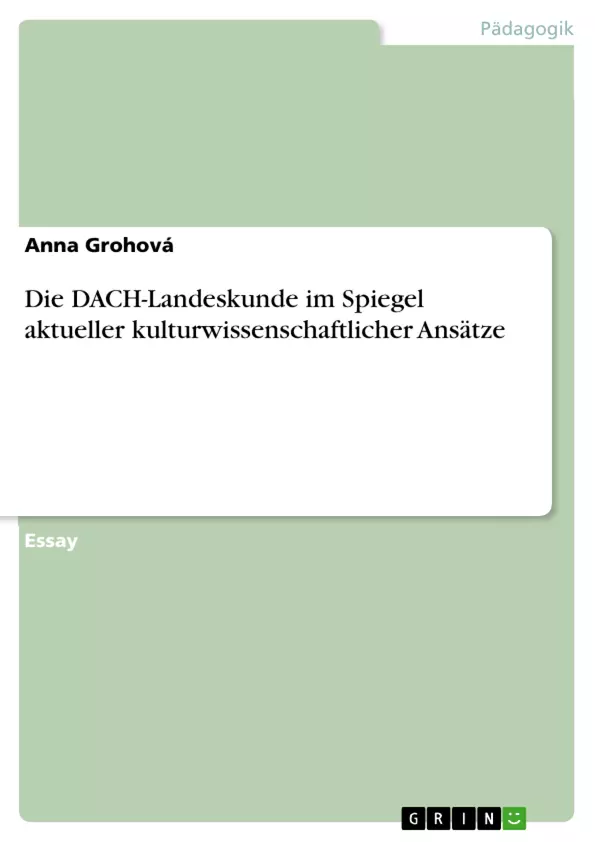In dieser Arbeit soll die DACH-Landeskunde mit der aktuellen kulturwissenschaftlichen verglichen werden. Dabei werden Kulturverständnis, Lernziele und Kritikpunkte näher betrachtet.
Im Vergleich zu dem ursprünglichen Konzept der faktenorientierten DACH(L)-Landeskunde beschäftigt sich die kulturwissenschaftliche Landeskunde mehr mit Wissen über die Umstände, unter denen wir unsere subjektive Realität bilden. Die Lernenden sind nicht mehr die „Konsumenten“ der Fakten, sie werden vielmehr zu einer aktiven Reflexion und Perspektivenwechsel aufgefordert.
Inhaltsverzeichnis
- Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller kulturwissenschaftlicher Ansätze (Kommentar)
- Kulturverständnis
- Lernziele
- Kritikpunkte
- Eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Integration kulturwissenschaftlicher Ansätze in die Landeskunde des deutschsprachigen Raums (DACH-L) im DaF/DaZ-Unterricht. Ziel ist es, die Veränderungen im Verständnis von Kultur und den daraus resultierenden neuen Lernzielen zu beleuchten und kritisch zu diskutieren.
- Der Wandel vom faktenorientierten zum kulturwissenschaftlichen Ansatz in der Landeskunde
- Das veränderte Kulturverständnis und die Bedeutung von Sinngebung und symbolischen Ordnungen
- Neue Lernziele im Kontext des kulturellen Lernens und der globalen Interaktion
- Kritikpunkte an traditionellen DACH-L-Ansätzen und die Notwendigkeit einer Modernisierung
- Die Rolle von Raum und Sprache im kulturwissenschaftlichen Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller kulturwissenschaftlicher Ansätze (Kommentar): Dieser Abschnitt beschreibt den Paradigmenwechsel von der interkulturellen Landeskunde hin zum kulturwissenschaftlichen Ansatz. Im Gegensatz zur faktenorientierten Herangehensweise, die auf objektiven Beschreibungen beruht, fokussiert der kulturwissenschaftliche Ansatz auf Deutungen menschlichen Handelns, Sinngebung und symbolische Ordnungen. Die Lernenden werden von passiven Konsumenten von Fakten zu aktiven Akteuren der Reflexion und des Perspektivenwechsels. Der Vergleich der "eigenen" und "fremden" Kultur wird kritisch hinterfragt, da er zu Stereotypisierungen führen kann.
Kulturverständnis: Dieses Kapitel definiert den Kulturbegriff im kulturwissenschaftlichen Kontext neu, indem es die Elemente "Wirklichkeit" und "Wissen" in den Mittelpunkt stellt. Kultur wird als ein gelerntes und sozial vermitteltes Wissensrepertoire verstanden, das symbolische Ordnungen und damit Motive für soziales Handeln schafft. Die subjektive, gedeutete Wirklichkeit entsteht durch den Prozess der Sinngebung. Dieser Ansatz bricht mit der engen Bindung des Kulturbegriffs an Nationalkulturen und ermöglicht ein offeneres Verständnis von kultureller Zugehörigkeit, welches Vielfalt und Toleranz fördert.
Lernziele: Der "cultural turn" beeinflusst auch die Lernziele im DaF/DaZ-Unterricht. Geographische, historische oder demographische Daten werden nicht mehr isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil kultureller Ressourcen, die zum Verständnis von Wissensordnungen und kulturellen Mustern beitragen. Ein wichtiges Ziel ist das Verständnis diskursiver Prozesse der Bedeutungszuschreibung und -aushandlung. Weiterhin wird die Förderung der globalen Interaktion ("global citizenship") durch die Beherrschung von Fremdsprachen betont. Die Arbeit mit Deutungsressourcen und die Reflexion eigener kultureller Ressourcen stehen ebenfalls im Fokus.
Kritikpunkte: Dieser Abschnitt kritisiert den Fokus der traditionellen DACH-L-Landeskunde auf die nationalstaatliche Ebene und die damit verbundene Homogenisierung des Landes. Die intensive Thematisierung regionaler Unterschiede wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, stößt aber ebenfalls auf Kritik, da "Region" als ein diskursives kulturelles Muster verstanden wird. Die räumlich-territoriale Anbindung des Begriffs "deutschsprachiger Raum" wird hinterfragt, und es wird eine stärkere Anknüpfung an Sprache und Diskurse vorgeschlagen, um den Fokus auf soziale, politische und historische Dimensionen zu legen.
Eigene Meinung: Die Autorin bewertet die Bereicherung der DACH-L-Landeskunde durch kulturwissenschaftliche Elemente positiv, sieht aber Unsicherheiten bezüglich einiger Begrifflichkeiten. Sie betont die Bedeutung der nationalstaatlich organisierten Diskurse, insbesondere im Kontext aktueller politischer Entwicklungen in Europa, und die Notwendigkeit, diese im Unterricht zu berücksichtigen. Die Autorin kritisiert eine zu starke Fokussierung auf mitteleuropäische Kontexte und schlägt die Einbeziehung von Deutschsprechern außerhalb traditionell deutschsprachiger Länder vor, um die Diversität des "deutschen Kulturraums" widerzuspiegeln. Sie betont die Notwendigkeit, kontroverse Diskurse nicht auszuschließen, sondern im Unterricht aktiv zu behandeln und die Lernerzentriertheit im Mittelpunkt der Unterrichtsplanung zu behalten.
Schlüsselwörter
DACH-Landeskunde, kulturwissenschaftlicher Ansatz, interkulturelles Lernen, kulturelles Lernen, Sinngebung, symbolische Ordnungen, global citizenship, Perspektivenwechsel, Diskurse, Heterogenität, Region, nationalstaatliche Grenzen, Migration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller kulturwissenschaftlicher Ansätze"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Integration kulturwissenschaftlicher Ansätze in die Landeskunde des deutschsprachigen Raums (DACH-L) im DaF/DaZ-Unterricht. Sie beleuchtet den Wandel vom faktenorientierten zum kulturwissenschaftlichen Verständnis von Kultur und die daraus resultierenden neuen Lernziele.
Welche Veränderungen im Kulturverständnis werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt einen Paradigmenwechsel: Weg von einer faktenorientierten, objektiven Beschreibung hin zu einem kulturwissenschaftlichen Ansatz, der Deutungen menschlichen Handelns, Sinngebung und symbolische Ordnungen in den Mittelpunkt stellt. Kultur wird als gelerntes und sozial vermitteltes Wissensrepertoire verstanden, das subjektive Wirklichkeiten schafft.
Wie beeinflussen diese Veränderungen die Lernziele im DaF/DaZ-Unterricht?
Die Lernziele verschieben sich von der bloßen Vermittlung geographischer, historischer oder demographischer Daten hin zum Verständnis kultureller Ressourcen, Wissensordnungen und kultureller Muster. Das Verständnis diskursiver Prozesse und die Förderung globaler Interaktion ("global citizenship") gewinnen an Bedeutung. Die Reflexion eigener kultureller Ressourcen wird ebenfalls betont.
Welche Kritikpunkte an traditionellen DACH-L-Ansätzen werden genannt?
Die Arbeit kritisiert den Fokus traditioneller DACH-L-Ansätze auf die nationalstaatliche Ebene und die damit verbundene Homogenisierung des Landes. Die räumlich-territoriale Anbindung des Begriffs "deutschsprachiger Raum" wird hinterfragt und eine stärkere Anknüpfung an Sprache und Diskurse vorgeschlagen, um soziale, politische und historische Dimensionen stärker zu berücksichtigen. Die intensive Thematisierung regionaler Unterschiede wird als mögliche, aber auch kritisch zu betrachtende Lösung vorgeschlagen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Autorin?
Die Autorin bewertet die Bereicherung der DACH-Landeskunde durch kulturwissenschaftliche Elemente positiv, sieht aber Unsicherheiten bezüglich einiger Begrifflichkeiten. Sie betont die Bedeutung nationalstaatlich organisierter Diskurse, insbesondere im Kontext aktueller politischer Entwicklungen in Europa. Sie kritisiert eine zu starke Fokussierung auf mitteleuropäische Kontexte und schlägt die Einbeziehung von Deutschsprechern außerhalb traditionell deutschsprachiger Länder vor. Kontroverse Diskurse sollten nicht ausgeschlossen, sondern im Unterricht aktiv behandelt werden, wobei die Lernerzentriertheit im Mittelpunkt stehen sollte.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: DACH-Landeskunde, kulturwissenschaftlicher Ansatz, interkulturelles Lernen, kulturelles Lernen, Sinngebung, symbolische Ordnungen, global citizenship, Perspektivenwechsel, Diskurse, Heterogenität, Region, nationalstaatliche Grenzen, Migration.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu: Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller kulturwissenschaftlicher Ansätze (Kommentar), Kulturverständnis, Lernziele, Kritikpunkte und Eigene Meinung. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende und Studierende im Bereich DaF/DaZ, Kulturwissenschaften und Landeskunde. Sie bietet Einblicke in aktuelle didaktische und wissenschaftliche Diskussionen zum Thema Kulturverständnis und Landeskunde.
- Citation du texte
- Anna Grohová (Auteur), 2016, Die DACH-Landeskunde im Spiegel aktueller kulturwissenschaftlicher Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424523