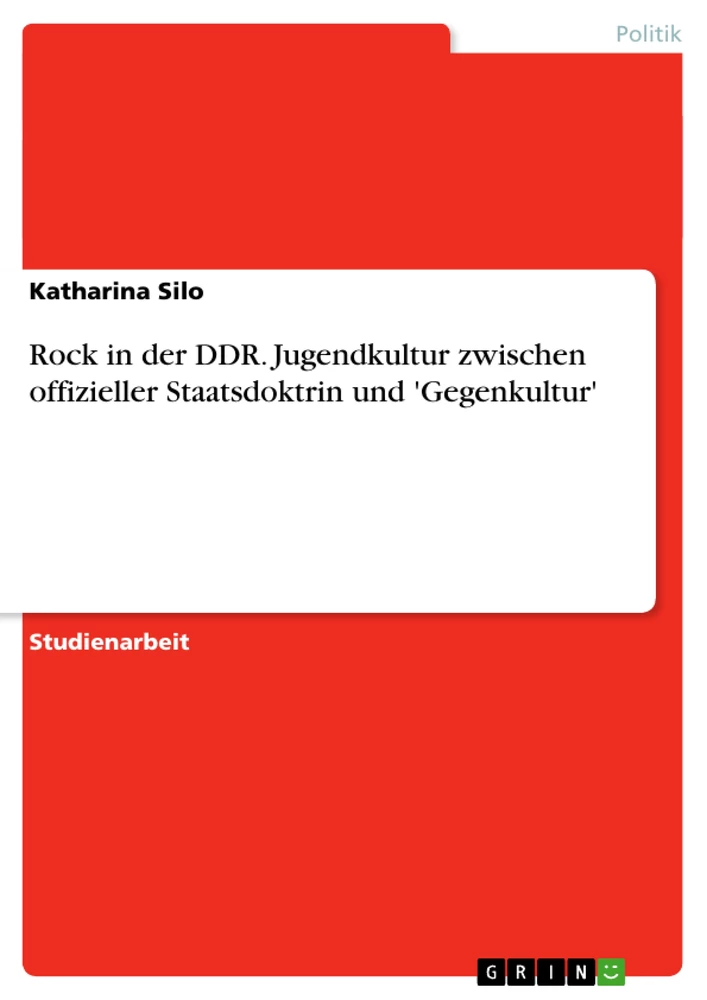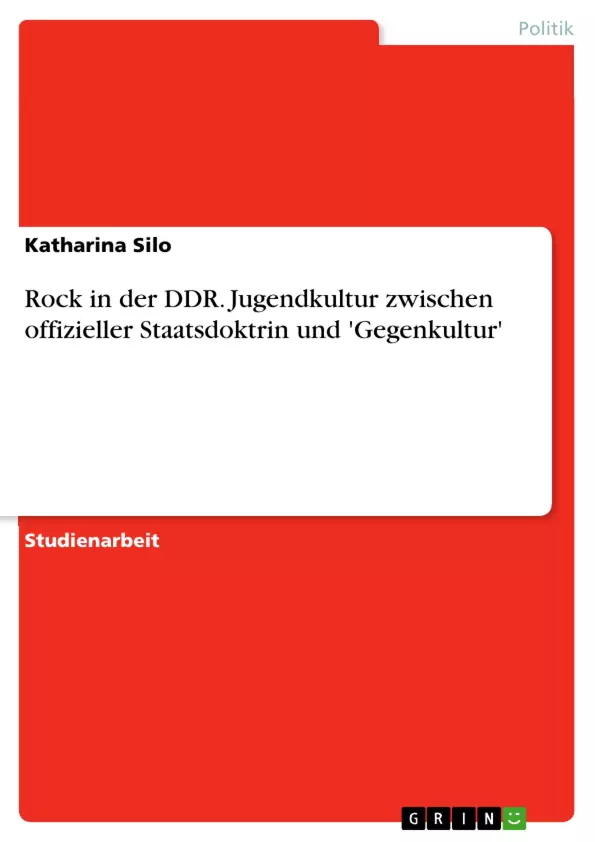Setzt man sich mit der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auseinander, wird deutlich, dass beinahe alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens auf die eine oder andere Art staatlicher Kontrolle unterlagen; so auch der Bereich der Kunst, der sog. Unterhaltungskunst und damit der populären Musik. Um diesen Bereich zu kontrollieren und im Sinne der DDR-Führung zu steuern, wurden im Lauf der Jahre verschiedene Regelungen und Institutionen geschaffen.
Doch wieso war dieser Bereich der populären Musik für die Offiziellen in der DDR so relevant? Dieser Arbeit liegen zu dieser Frage zwei Prämissen zugrunde:
1. Populäre Musik – also spätestens seit den siebziger Jahren in erster Linie Rock- und Popmusik in allen ihren Spielarten – hat einen wichtigen Stellenwert im Leben Jugendlicher und bietet eine Möglichkeit jugendlicher Identifikation und Integration.
2. Die Jugend war in der DDR Hauptziel politischer Einflussnahme und staatlicher Kontrolle. Die Erziehung zum `sozialistischen Menschen´ war bei den `Zukunftsträgern´ immanent wichtig.
Daraus folgt, dass es für die Staats- und Parteiführung von hohem Wert war, populäre Musik in ihrem Sinne zu beeinflussen, wenn sie auf die Jugendlichen nicht nur im Bereich von Schule, Ausbildung und sonstiger Freizeitgestaltung in ihrem Sinne Einfluss nehmen wollte. Da es sich die Führung zum Auftrag gemacht hatte v. a. die junge Generation im Sinne des „kommunistischen Persönlichkeitsideals“1 zu erziehen, wurden bald die entsprechenden Konsequenzen aus der musikalischen Entwicklung gezogen. Obwohl populäre Musik dem Anspruch an sozialistisches Kunstschaffen tendenziell widersprach, wurde sie doch in den Bereich der sog. Unterhaltungskunst aufgenommen und die entsprechenden Anforderungen an sie gestellt...
-----
1 Vgl. Rauhut, Michael (2002): Rock in der DDR 1964 bis 1989. Bonn. S. 5.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kultur- und Jugendpolitik
- 2.1 Ideologischer Hintergrund: Kulturpolitik im Zeichen des „neuen Menschen“
- 2.2 Staatliche Instrumente zur „Kontrolle“ der Musikentwicklung
- 2.3 Jugendbild und -politik
- 2.4 Zwischenfazit: Kultur- und Jugendpolitik in Theorie und Praxis
- 3. Die Musikszene der siebziger und achtziger Jahre
- 3.1 Die „Offiziellen“
- 3.2 Der „Untergrund“
- 4. Die Jugend
- 4.1 Die „Angepassten“
- 4.2 Jugendliche Interessen
- 4.3 Jugendszenen
- 5. Schluss: Der Einfluss von (staatlich gelenkter) Rockmusik auf die DDR-Jugend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss staatlich gelenkter Rockmusik auf die Jugendkultur in der DDR. Sie analysiert die Strategien der DDR-Führung zur Kontrolle und Einflussnahme auf populäre Musik und deren Auswirkungen auf die jugendliche Identifikation und Integration in die Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen offizieller Kulturpolitik, der Musikszene (sowohl "offiziell" als auch "underground") und den tatsächlichen Interessen und Verhaltensweisen der DDR-Jugendlichen.
- Staatliche Kulturpolitik und Kontrolle der Rockmusik in der DDR
- Die Rolle von Rockmusik in der jugendlichen Identitätsbildung
- Die Musikszene der DDR: "Offizielle" und "Underground"-Bewegungen
- Die Reaktionen der DDR-Jugend auf staatliche Einflussnahme
- Verbindung zwischen Musik und Jugendkultur in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung legt die Prämissen der Arbeit dar: Populäre Musik spielte eine zentrale Rolle in der jugendlichen Lebenswelt der DDR, und die DDR-Jugend war ein Hauptziel staatlicher Kontrolle und Einflussnahme. Die staatliche Führung versuchte, populäre Musik im Sinne des "sozialistischen Menschen" zu beeinflussen, da sie die Jugend im Bereich von Schule, Ausbildung und Freizeitgestaltung erreichen wollte. Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen staatlich gelenkter Rockmusik und der Jugendkultur, indem sie die ideologischen Anforderungen an die Unterhaltungskunst, die Instrumente zur Umsetzung dieser Forderungen und die Reaktionen der Jugend beleuchtet. Die vorhandene Literatur wird kritisch bewertet, da sie die Verbindung zwischen Musik und Jugendkultur meist nur am Rande behandelt.
2. Kultur- und Jugendpolitik: Dieses Kapitel beleuchtet die ideologische Funktion von Kunst und Unterhaltungskunst in der DDR. Es beschreibt die anfängliche Versuche, die Beat- und Rockmusik einzudämmen, die dann in die Erkenntnis mündete, dass die Musik für die Vermittlung sozialistischer Werte genutzt werden könnte. Das Kapitel skizziert die Entwicklung von theoretischen Anforderungen an "Tanz- und Unterhaltungsmusik" und die Schaffung von Institutionen zur Umsetzung dieser Anforderungen. Es bereitet den Boden für die nachfolgenden Kapitel, indem es die theoretischen Grundlagen der staatlichen Kulturpolitik darlegt.
3. Die Musikszene der siebziger und achtziger Jahre: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Musikszene in der DDR in den 70er und 80er Jahren, indem es die "offiziellen" und den "Underground"-Bereich unterscheidet. Es analysiert die Strategien der staatlichen Kontrolle und die gleichzeitig bestehenden Gegenbewegungen in der Musikszene. Der Unterschied zwischen der staatlich geförderten Musik und der von den Jugendlichen bevorzugten, oft verbotenen Musik wird beleuchtet. Die komplexen Beziehungen zwischen staatlicher Kontrolle und künstlerischer Ausdrucksfreiheit werden in diesem Kapitel analysiert.
4. Die Jugend: Dieses Kapitel untersucht die DDR-Jugend der späten 70er und 80er Jahre, um deren Integration in die Gesellschaft und deren Identifikation mit dem System zu beleuchten. Es analysiert, inwieweit sich die staatliche Kulturpolitik auf die Einstellungen der Jugendlichen auswirkte, ob diese sich über die staatlich gelenkte Rockmusik mit dem System identifizierten oder ob eine Abwendung erfolgte. Das Kapitel verknüpft die vorherigen Analysen der staatlichen Politik mit den realen Lebenswelten und Erfahrungen der Jugendlichen.
Schlüsselwörter
DDR, Rockmusik, Jugendkultur, staatliche Kontrolle, Kulturpolitik, sozialistischer Mensch, Identifikation, Integration, Underground, "Offizielle" Musik, Jugendliche Interessen, Einflussnahme, Repression, Propaganda.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Der Einfluss staatlich gelenkter Rockmusik auf die DDR-Jugend
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss staatlich gelenkter Rockmusik auf die Jugendkultur in der DDR. Sie analysiert die Strategien der DDR-Führung zur Kontrolle und Einflussnahme auf populäre Musik und deren Auswirkungen auf die jugendliche Identifikation und Integration in die Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen offizieller Kulturpolitik, der Musikszene (sowohl "offiziell" als auch "underground") und den tatsächlichen Interessen und Verhaltensweisen der DDR-Jugendlichen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die staatliche Kulturpolitik und die Kontrolle der Rockmusik in der DDR, die Rolle von Rockmusik in der jugendlichen Identitätsbildung, die Musikszene der DDR (offiziell und Underground), die Reaktionen der DDR-Jugend auf staatliche Einflussnahme und die Verbindung zwischen Musik und Jugendkultur in der DDR.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Kultur- und Jugendpolitik, ein Kapitel zur Musikszene der 70er und 80er Jahre, ein Kapitel zur DDR-Jugend und einen Schlussabschnitt. Die Einleitung legt die Prämissen dar, während die Kapitel die ideologischen Hintergründe, die staatlichen Strategien, die Entwicklung der Musikszene und die Reaktionen der Jugend detailliert untersuchen. Der Schlussabschnitt fasst den Einfluss staatlich gelenkter Rockmusik auf die DDR-Jugend zusammen.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit erwähnt eine kritische Auseinandersetzung mit bestehender Literatur, die die Verbindung zwischen Musik und Jugendkultur oft nur am Rande behandelt. Konkrete Quellen werden im Haupttext nicht genannt, da es sich hier nur um eine Inhaltsangabe handelt.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit (ohne den gesamten Inhalt vorwegzunehmen)?
Die Arbeit zeigt die komplexen Wechselwirkungen zwischen staatlicher Kulturpolitik, der Musikszene (sowohl "offiziell" als auch "Underground") und den Interessen und Verhaltensweisen der DDR-Jugend auf. Sie beleuchtet, wie die DDR-Führung versuchte, Rockmusik für die Vermittlung sozialistischer Werte zu nutzen und wie die Jugend darauf reagierte. Die Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung von Musik für die Identitätsbildung und Integration der Jugendlichen in die Gesellschaft, sowie den Umgang mit staatlicher Kontrolle und Repression.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
DDR, Rockmusik, Jugendkultur, staatliche Kontrolle, Kulturpolitik, sozialistischer Mensch, Identifikation, Integration, Underground, "Offizielle" Musik, Jugendliche Interessen, Einflussnahme, Repression, Propaganda.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für alle relevant, die sich für die Geschichte der DDR, Jugendkultur, Musikgeschichte und staatliche Einflussnahme auf Kultur interessieren. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler und Studenten, die sich mit diesen Themen im Rahmen akademischer Arbeiten auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Katharina Silo (Autor), 2005, Rock in der DDR. Jugendkultur zwischen offizieller Staatsdoktrin und 'Gegenkultur', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42466