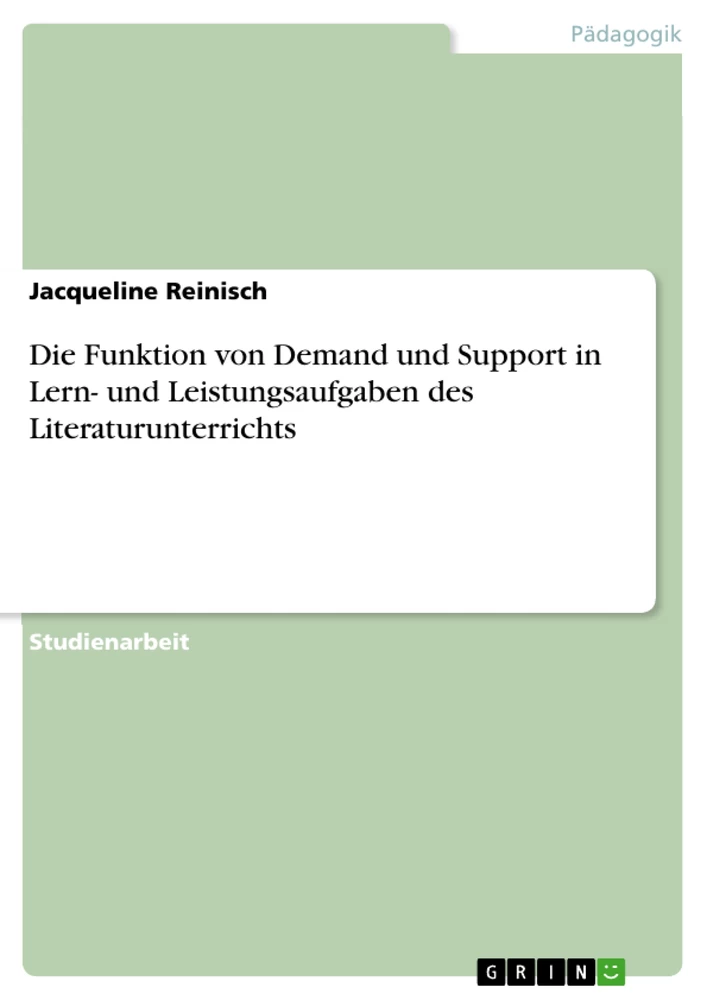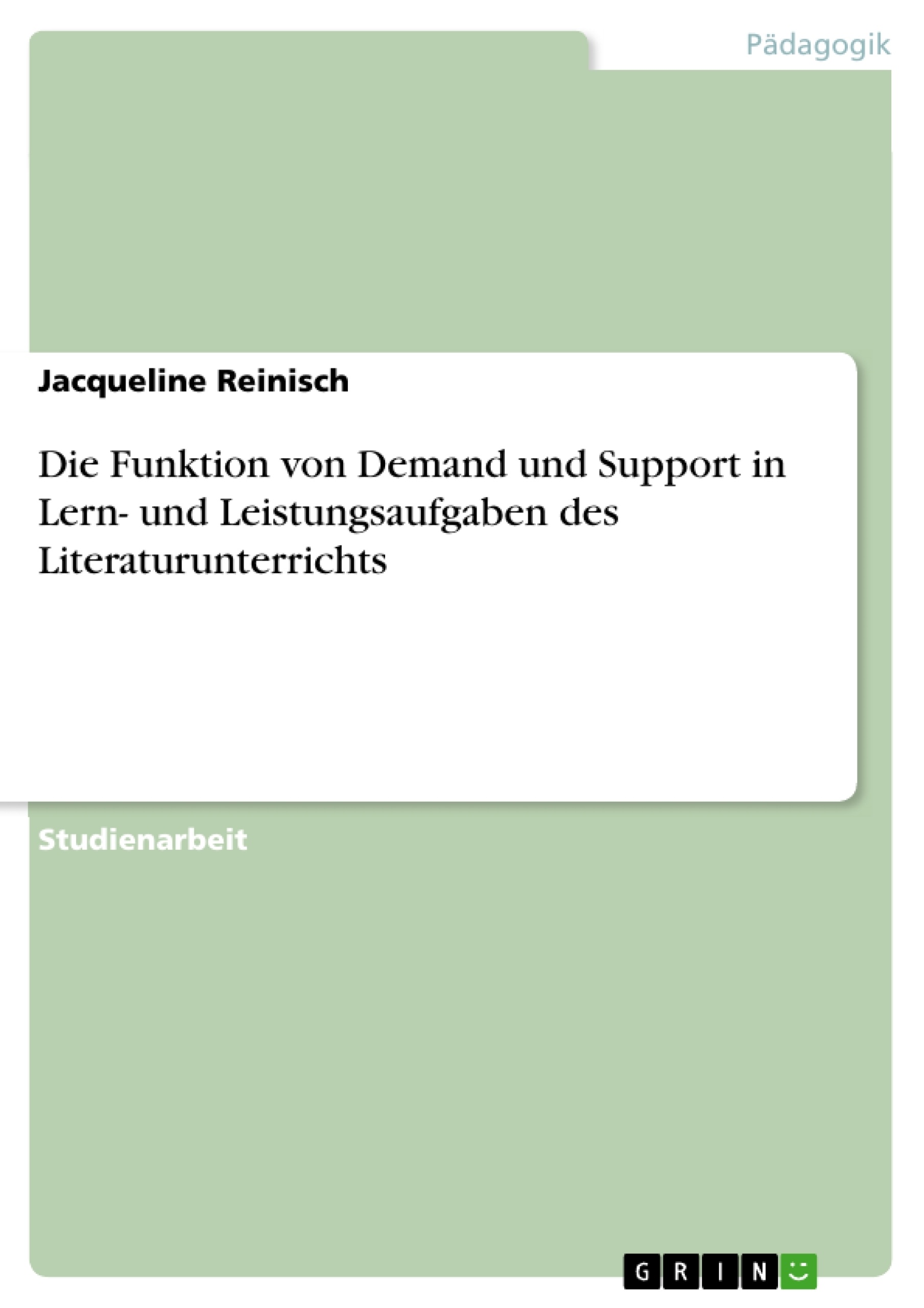Aufgabenstellungen sind im Deutsch- und Literaturunterricht ein zentrales Mittel zum Lernen an literarischen Gegenständen.
Da das literarische Lernen innerhalb der Forschung als eigenständiger Aspekt zentral ist, besteht die Auffassung, dass Lernprozesse existieren, die gezielt auf literarische Gegenstände ausgerichtet sind. Aus diesem Grund benötige man laut Spinner bestimmte Lese- und Verstehensanforderungen, um einen kompetenten Umgang mit literarischen, also fiktionalen und poetischen Texten gewährleisten zu können.
Weil die Literatur innerhalb des Unterrichts weiterhin einen wichtigen Stellenwert innehat, sollen dem literarischen Lernprozess, der von Schülerinnen und Schülern verschiedenste Kompetenzen abverlangt und daher für diese nach wie vor eine Schwierigkeit darzustellen scheint, durch Hilfestellungen Unterstützungen geliefert werden.
Diese Seminararbeit soll sich daher mit der Frage auseinandersetzen, wie und aus welchem Grund sich die benannte Unterstützung in ausgewählten Sets von Lern- und Leistungsaufgaben auffinden lässt. Hierbei soll genauer darauf eingegangen werden, inwieweit das Auftreten von Support in Leistungsaufgaben auch eine wirkliche Unterstützung für die SuS liefern kann.
Zunächst soll aufgezeigt werden, wie die Begriffe Lernaufgabe und Leistungsaufgabe in der didaktischen Forschung derzeitig definiert sind.
Im darauffolgenden Schritt werden die Begriffe Support und Demand genauer erläutert und dargelegt, welchen Einfluss diese Maßnahmen auf verschiedene Aufgabenformate haben können. Bevor zuletzt eine allgemeine Schlussbetrachtung stattfinden wird, soll ein fokussierter Blick auf das Verhältnis von Demand und Support in Leistungsaufgaben geworfen werden.
Aus Gründen der Zugänglichkeit und der zahlenmäßigen Eingrenzung werden zehn exemplarische Aufgabensets der Oberstufe des Abiturjahrgangs 2010 (Gymnasium) und des Abiturjahrgangs 2017 (Berufliches Gymnasium) auf dieses Verhältnis hin untersucht und herausgearbeitet, ob und, wenn ja, inwieweit Hilfestellungen zur Verfügung gestellt werden. Die Analyse der Sets betrachtet zunächst einige thematisch unabhängige Aufgaben und wird weiterhin drei Aufgaben zum Themenbereich der Romantik und drei weitere zum Werk „Faust I“ genauer betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Unterscheidung von Lern- und Leistungsaufgaben
- 3. Das Verhältnis von Demand und Support
- i. Zur Begrifflichkeit von Demand und Support
- ii. Das Auftreten von Support im Verhältnis verschiedener Aufgabenformate
- iii. Arten von Support
- 4. Analyse der Aufgabensets
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Funktion von Demand und Support in Lern- und Leistungsaufgaben des Literaturunterrichts. Sie beleuchtet das Verhältnis zwischen diesen beiden Konzepten und analysiert, wie Support in verschiedenen Aufgabenformaten zum Tragen kommt.
- Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungsaufgaben
- Definition und Bedeutung von Demand und Support
- Analyse von Support in verschiedenen Aufgabensets
- Wirkung von Support auf das Lernerlebnis
- Kritik an der Rolle von Support im Literaturunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit dar: Wie und warum findet sich Support in Lern- und Leistungsaufgaben im Literaturunterricht wieder? Sie erläutert die Bedeutung von literarischem Lernen und die Notwendigkeit von Unterstützung für Schüler. Außerdem werden die wichtigsten Punkte der Arbeit und die Methodik der Untersuchung vorgestellt.
2. Zur Unterscheidung von Lern- und Leistungsaufgaben
Dieses Kapitel befasst sich mit der Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungsaufgaben im Deutschunterricht. Es wird die Argumentation von Juliane Köster aufgezeigt, die betont, dass die beiden Aufgabenarten unterschiedliche Ziele verfolgen und daher unterschiedliche Anforderungen an die Schüler stellen.
3. Das Verhältnis von Demand und Support
Im dritten Kapitel werden die Begriffe Demand und Support genauer definiert und erläutert. Es werden verschiedene Arten von Support vorgestellt und deren Einfluss auf verschiedene Aufgabenformate untersucht.
4. Analyse der Aufgabensets
Dieses Kapitel beinhaltet die Analyse von zehn exemplarischen Aufgabensets, die den Einfluss von Demand und Support auf die Schüler beleuchten. Die Analyse betrachtet verschiedene thematische Bereiche, um die Funktion von Support in verschiedenen Kontexten zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Demand und Support im Kontext von Lern- und Leistungsaufgaben im Literaturunterricht. Weitere wichtige Themen sind das literarische Lernen, die Differenzierung von Lern- und Leistungsaufgaben, Aufgabenformate, und die Analyse von Aufgabensets.
- Arbeit zitieren
- Jacqueline Reinisch (Autor:in), 2017, Die Funktion von Demand und Support in Lern- und Leistungsaufgaben des Literaturunterrichts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424810