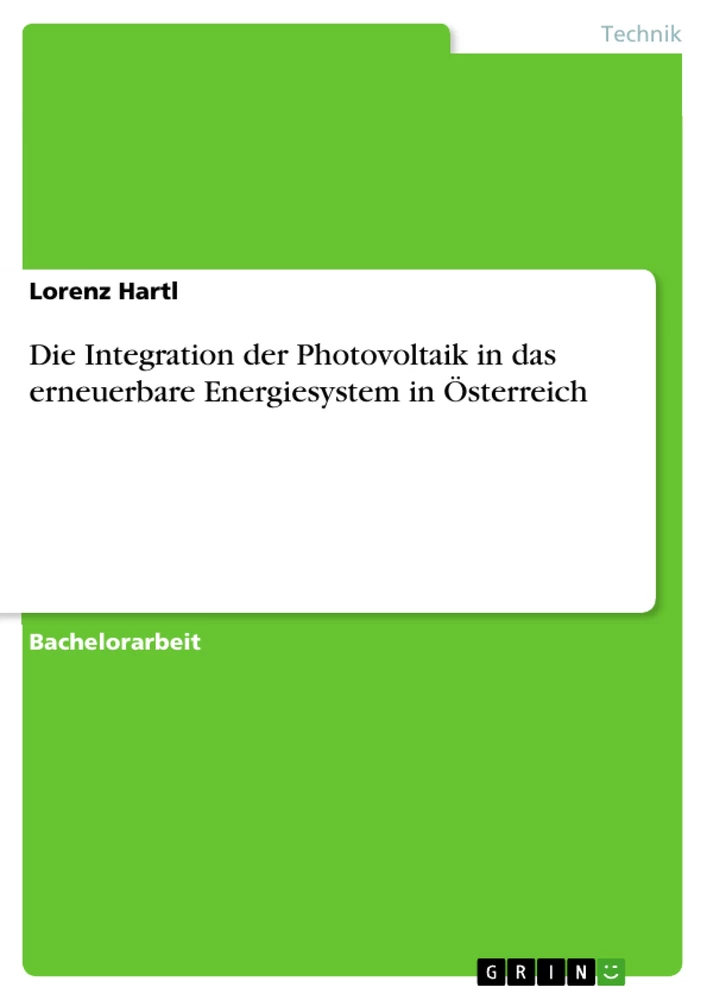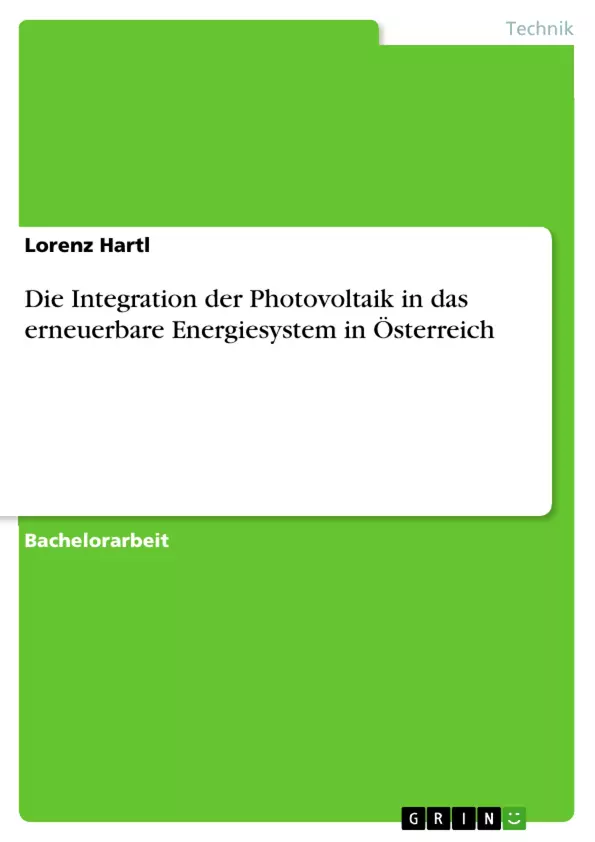Diese Bachelorseminararbeit soll die Bedeutung des Energieträgers Photovoltaik aufzeigen und geht der Frage nach, wie dieser bestmöglich ins erneuerbare Energiesystem in Österreich integriert werden kann und welche gesetzlichen Änderungen für eine solche Integration notwendig sind. Der Grund für diese Untersuchung ist der geringe Mengenanteil von rund 2 % (2018) am Gesamtstromaufkommen, den die Photovoltaik aktuell am österreichischen Stromerzeugungsmix aufweist. Es wurde daher analysiert, welche Unterstützungssysteme für die Photovoltaik am geeignetsten sind; welche Anreize gesetzt werden können, um mehr Zubau von Photovoltaikanlagen zu erreichen; welchen Beitrag die Photovoltaik im Hinblick auf eine komplette erneuerbare Stromversorgung leisten kann und welche Veränderungen durch eine erfolgreiche Integration entstehen können. Hierfür wurde zum einen eine Erhebung aus wissenschaftlichen Studien und behördlichen Dokumenten vollzogen und zum anderen empirische Experteninterviews durchgeführt. Anschließend wurden die daraus gewonnen Erkenntnisse zusammengeführt und diskutiert und schließlich Schlussfolgerungen abgeleitet, die zu einem höheren Photovoltaikanteil in Österreich führen können.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- MATERIAL UND METHODIK
- ALLGEMEINES ZUR PHOTOVOLTAIK UND IHRE ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
- MARKTENTWICKLUNG DER PHOTOVOLTAIK IN ÖSTERREICH
- PREISENTWICKLUNG DER PHOTOVOLTAIK IN ÖSTERREICH
- STROMGESTEHUNGSKOSTEN VON PV-ANLAGEN
- FÖRDERUNG DER ERNEUERBAREN STROMERZEUGUNG
- DIE EINSPEISEVERGÜTUNG UND DIE PHOTOVOLTAIKFÖRDERUNG IN ÖSTERREICH
- EINSPEISEVERGÜTUNG (FIT)
- DIE ÖSTERREICHISCHE PHOTOVOLTAIKFÖRDERUNG AUF BUNDESEBENE
- DAS ÖSTERREICHISCHE ÖKOSTROMFÖRDERSYSTEM AUF LANDESEBENE
- ÄNDERUNGEN FÜR DIE PHOTOVOLTAIK DURCH DIE „KLEINE ÖKOSTROMNOVELLE“
- INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN UND STROMSPEICHER
- DIE GEMEINSCHAFTLICHE ERZEUGUNGSANLAGE
- ZUKÜNFTIGE ANSÄTZE FÜR DIE PHOTOVOLTAIKFÖRDERUNG IN ÖSTERREICH
- PRÄMIENMODELL (FIP)
- AUSSCHREIBUNGSMODELL (TEN)
- PHOTOVOLTAIK IN DEUTSCHLAND
- MARKTENTWICKLUNG DER PHOTOVOLTAIK IN DEUTSCHLAND
- AKTUELLE FÖRDERSITUATION IN DEUTSCHLAND DURCH DAS EEG
- ALLGEMEINES ZUR PHOTOVOLTAIK UND IHRE ENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH
- ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE AUS DEN EXPERTENINTERVIEWS
- DISKUSSION UND ZUSAMMENFÜHRUNG DER ERGEBNISSE AUS LITERARISCHER RECHERCHE UND EXPERTENINTERVIEWS
- OPTIMALES FÖRDERSYSTEM
- AUSSCHREIBUNGEN
- ANREIZE UND ERLEICHTERUNGEN FÜR PV-ANLAGENBETREIBER
- MINDESTAUSBAUZIELE FÜR MEHR PV-ANTEIL
- SCHLUSSFOLGERUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorseminararbeit untersucht die Bedeutung der Photovoltaik als Energieträger und erörtert deren optimale Integration in das österreichische erneuerbare Energiesystem. Sie analysiert die aktuelle Situation, die Notwendigkeit gesetzlicher Änderungen und die Eignung verschiedener Unterstützungssysteme zur Förderung des Photovoltaik-Ausbaus.
- Die Rolle der Photovoltaik im österreichischen Stromerzeugungsmix
- Eignung verschiedener Unterstützungssysteme für den Photovoltaik-Ausbau
- Mögliche Anreize und rechtliche Rahmenbedingungen für eine verstärkte Integration von Photovoltaik
- Der Beitrag der Photovoltaik zu einer vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energie
- Potentielle Auswirkungen einer erfolgreichen Integration von Photovoltaik auf das österreichische Energiesystem
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung erläutert den globalen Wandel in der Energiepolitik hin zu erneuerbaren Energieformen. Sie betont die Bedeutung von Fördermaßnahmen und die Frage der optimalen Integration von Photovoltaik in das österreichische Energiesystem.
- Kapitel 2: Material und Methodik
Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik und stellt die Relevanz der Photovoltaik in Österreich sowie die Entwicklung der Markt- und Preisdynamik dar. Es behandelt die wichtigsten Ökostromfördermodelle für Solarstromanlagen, die historische Entwicklung der Photovoltaik-Förderung in Österreich und die Auswirkungen der "kleinen Ökostromnovelle". Abschließend werden die Entwicklungen in Deutschland beleuchtet.
- Kapitel 3: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Experteninterviews
Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse aus den Experteninterviews, die im Rahmen der Forschungsarbeit durchgeführt wurden.
- Kapitel 4: Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse aus literarischer Recherche und Experteninterviews
Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews. Es beleuchtet Themen wie das optimale Fördersystem, Ausschreibungen, Anreize für PV-Anlagenbetreiber und die Bedeutung von Mindestausbauzielen für einen höheren Photovoltaik-Anteil.
Schlüsselwörter
Photovoltaik, erneuerbares Energiesystem, Stromerzeugungsmix, Unterstützungssysteme, Förderung, Ökostrom, Integration, Marktentwicklung, Preisentwicklung, Experteninterviews, Österreich, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Anteil der Photovoltaik am österreichischen Strommix?
Im Jahr 2018 lag der Anteil der Photovoltaik am Gesamtstromaufkommen in Österreich bei lediglich rund 2 %.
Was sind die wichtigsten Fördermodelle für Solarstrom in Österreich?
Unterschieden wird zwischen Einspeisevergütungen (FIT), Investitionszuschüssen und zukünftigen Modellen wie dem Prämienmodell (FIP) oder Ausschreibungen.
Welche Neuerungen brachte die „kleine Ökostromnovelle“?
Sie ermöglichte unter anderem gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen (z.B. auf Mehrparteienhäusern) und verbesserte die Investitionszuschüsse für Speicher.
Wie unterscheiden sich die Fördersysteme in Österreich und Deutschland?
Die Arbeit vergleicht das österreichische System mit dem deutschen EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und analysiert die jeweilige Marktentwicklung.
Was ist eine gemeinschaftliche Erzeugungsanlage?
Es ist ein Modell, bei dem mehrere Nutzer (z.B. Mieter eines Hauses) gemeinsam Strom aus einer PV-Anlage beziehen können, was die Integration im urbanen Raum fördert.
Welchen Beitrag kann Photovoltaik zu einer 100% erneuerbaren Stromversorgung leisten?
Photovoltaik gilt als eine der tragenden Säulen, um die saisonale Lücke (besonders im Sommer) zu schließen und die Abhängigkeit von fossilen Importen zu verringern.
- Quote paper
- Lorenz Hartl (Author), 2018, Die Integration der Photovoltaik in das erneuerbare Energiesystem in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425062