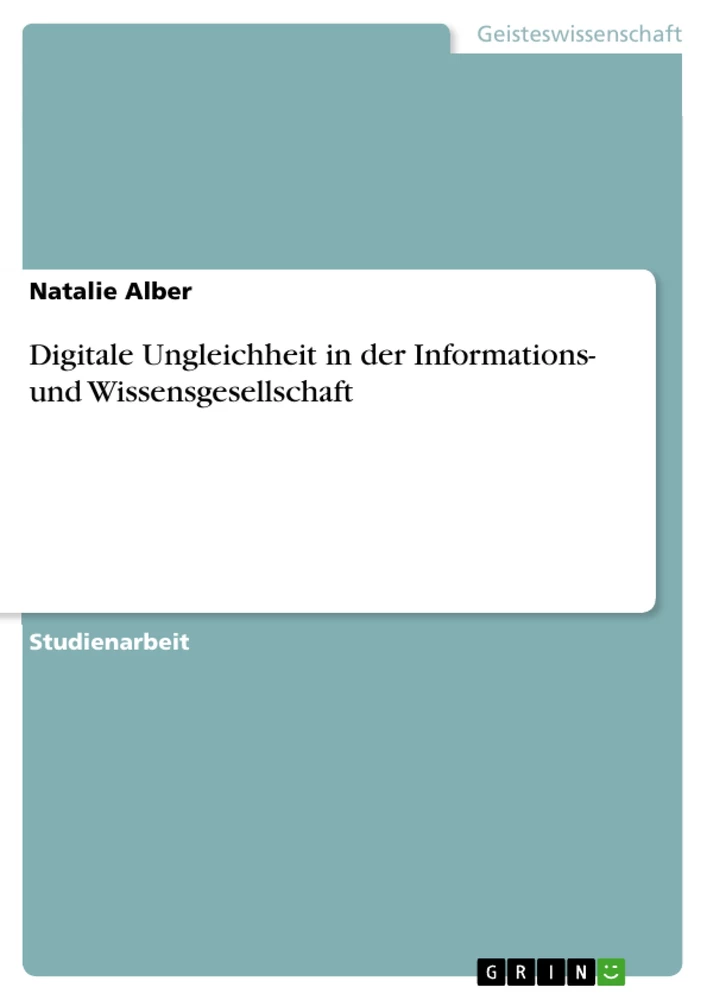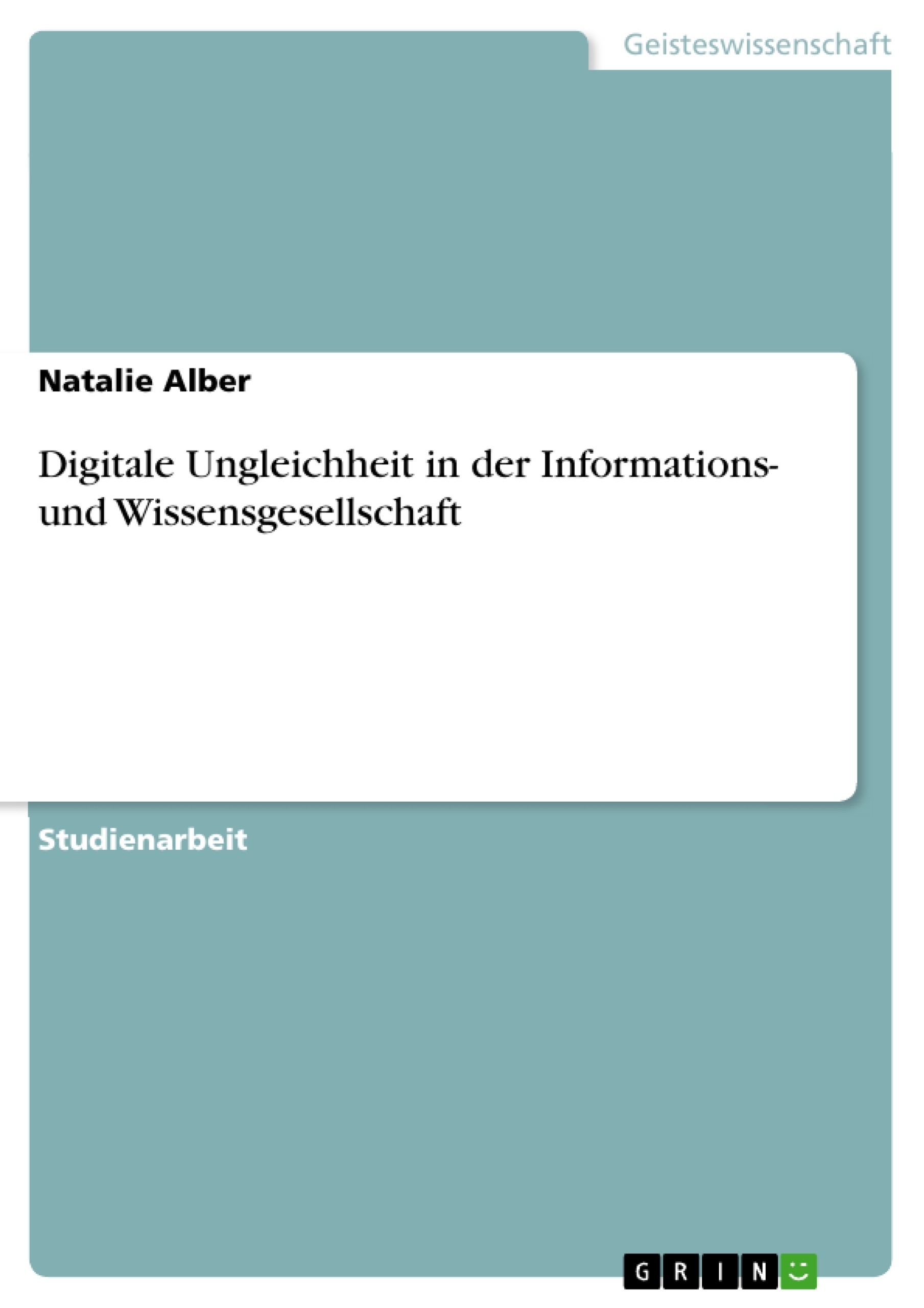Die digitale Ungleichheitsforschung auch „Digital Divide“ genannt beschreibt das Phänomen der digitalen Spaltung als Folge einer unterschiedlichen Verteilung und Nutzung von technologischen Ressourcen in der Gesellschaft. In Anbetracht der Tatsache, dass sich die meisten Aktivitäten von Kommunikation bis Online-Bewerbung medial im Internet abspielen, kann davon ausgegangen werden, dass eine digitale Ungleichheit Auswirkungen auf das soziale Leben hat und zu einer sozialen Benachteiligung führen kann. Mit dem Aspekt der Entstehung von neuen digitalen Ungleichheiten stellen sich für die Soziale Arbeit neue Herausforderungen. Es gilt Ungleichheiten zu beseitigen um die gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit wiederherzustellen. Um der digitalen und sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken, ist es daher wichtig Informationen für alle zugänglich zu machen, Medienkompetenz zu vermitteln aber auch eine zielgerichtete und strukturierte Selektion und Verarbeitung von Informationen zu fördern.
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wird die moderne Gesellschaft durch den ansteigenden Informationsfluss und zunehmende Verfügbarbar von Massenmedien als „Informations- und Wissensgesellschaft“ verstanden. Jedoch existieren laut Wirth (1997) keinerlei Definitionen, die die Konstrukte „Information“ und „Wissen“ präzisieren und voneinander unterscheiden, obwohl sie für die Wissenskluftforschung unverzichtbar sind.
Deshalb werden einleitend im ersten Kapitel zunächst die Begriffe Information und Wissen nach Kuhlen (2004) definiert. Information gilt als die Vorstufe des Wissens, welche lebensdinglich und einen Gebrauchswert für den Nutzer haben muss um dann von ihm aus der Fülle von Informationen selektiert und aneignet werden zu können. Während Information einen Prozess des Wissenserwerbes beschreibt, ist Wissen ein Zustand. An die Definition von Information und Wissen schließt sich im zweiten Kapitel die Beschreibung des Konzeptes der Wissensgesellschaft nach Drucker (1969). Steinbicker (2001) schreibt in diesem Zusammenhang, dass die Gesellschaft einen sozialen und technologischen Wandlungsprozess unterliegt und sich von der industriellen Gesellschaft zu einer modernen Informations- und Wissensgesellschaft entwickelt hat. Informationen und insbesondere Wissen haben in der Gesellschaft eine zentrale Rolle eingenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Definition von Information und Wissen.
- 2. Konzept der Informations- und Wissensgesellschaft nach Peter Drucker
- 3. Einführung in die Wissensklufthypothese
- 3.1. Ausgangshypothese und Theoretische Begründung
- 3.2. Konzepterweiterung der Wissenskluftperspektive
- 4. Von der Wissenskluft zur Spaltung in der Verfügbarkeit und Nutzung von Massenmedien
- 4.1. Definition Digitale Spaltung
- 4.2. Soziale Relevanz der digitalen Spaltung
- 5. Dreistufiges Modell nach Wirth.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der digitalen Ungleichheit, auch bekannt als "Digital Divide", und analysiert die Herausforderungen, die diese für die Soziale Arbeit in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft mit sich bringt.
- Definition von Information und Wissen im Kontext sozialer Ungleichheiten
- Das Konzept der Informations- und Wissensgesellschaft nach Peter Drucker
- Die Wissensklufthypothese und ihre Bedeutung für die digitale Spaltung
- Soziale Relevanz der digitalen Spaltung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Analyse der Entstehung und Ursachen der digitalen Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einführung beleuchtet das Phänomen der digitalen Ungleichheit und die damit verbundenen Herausforderungen für die Soziale Arbeit.
- Kapitel 1 definiert die Begriffe Information und Wissen nach Kuhlen und stellt deren Bedeutung für die Entstehung von Wissensklüften dar.
- Kapitel 2 beschreibt das Konzept der Wissensgesellschaft nach Drucker und zeigt die Bedeutung von Wissen als Innovations- und Produktionsfaktor in der modernen Gesellschaft auf.
- Kapitel 3 führt in die traditionelle Wissensklufthypothese nach Tichenor, Donohue und Olien ein und erläutert die Konzepterweiterungen der Wissenskluftperspektive.
- Kapitel 4 setzt die digitale Spaltung in den Kontext der Wissenskluftforschung und definiert das Phänomen sowie seine sozialen Auswirkungen.
- Kapitel 5 präsentiert das dreistufige Modell nach Wirth, welches die Entstehungsursachen der digitalen Ungleichheit erklärt.
Schlüsselwörter
Digitale Ungleichheit, Digital Divide, Informations- und Wissensgesellschaft, Wissenskluft, Wissensklufthypothese, soziale Ungleichheit, Medienkompetenz, Informationsverfügbarkeit, Informationsnutzung, digitale Spaltung, Teilhabe, Chancengleichheit
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Digital Divide“?
Der Digital Divide (digitale Spaltung) bezeichnet die ungleiche Verteilung des Zugangs zu und der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Gesellschaft.
Wie unterscheiden sich Information und Wissen?
Information ist die Vorstufe von Wissen und hat einen Gebrauchswert. Wissen hingegen ist ein Zustand der Aneignung und Verarbeitung dieser Informationen durch das Individuum.
Was besagt die Wissensklufthypothese?
Die Hypothese besagt, dass Segmente der Bevölkerung mit höherem sozioökonomischem Status Informationen schneller aufnehmen, wodurch sich die Wissenskluft zu statusniedrigeren Gruppen vergrößert.
Warum ist digitale Ungleichheit ein Thema für die Soziale Arbeit?
Da gesellschaftliche Teilhabe zunehmend digital erfolgt, führt digitale Ausgrenzung zu sozialer Benachteiligung. Die Soziale Arbeit muss hier Medienkompetenz vermitteln und Zugänge schaffen.
Welche Rolle spielt Peter Drucker in diesem Kontext?
Peter Drucker prägte das Konzept der Wissensgesellschaft, in der Wissen zum zentralen Produktionsfaktor und zur Grundlage des sozialen Wandels wird.
- Quote paper
- Natalie Alber (Author), 2017, Digitale Ungleichheit in der Informations- und Wissensgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425080