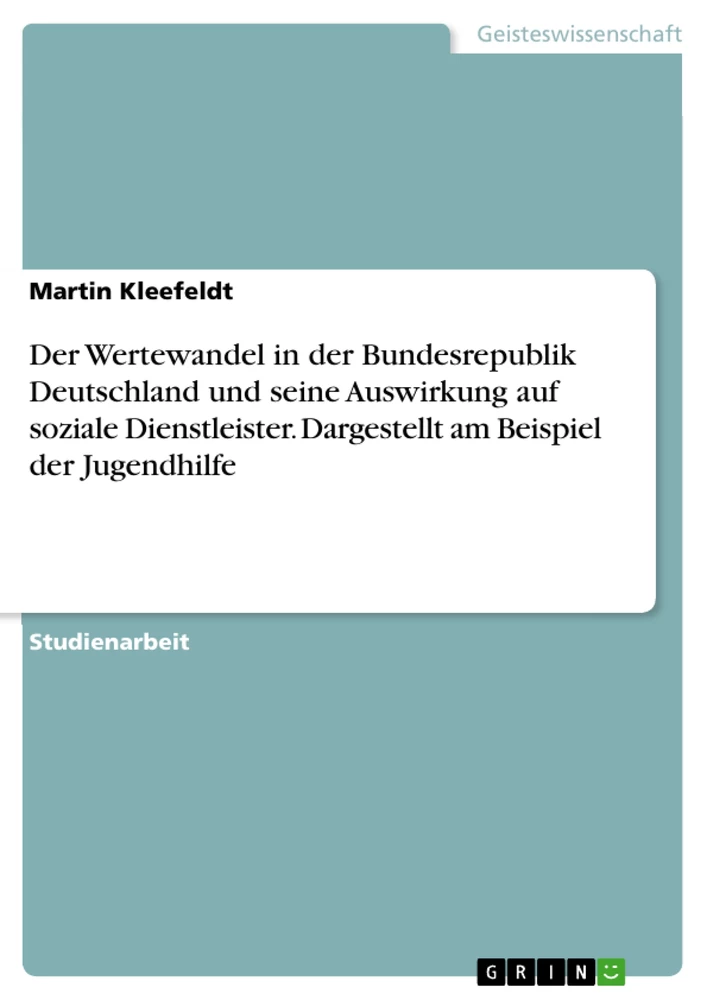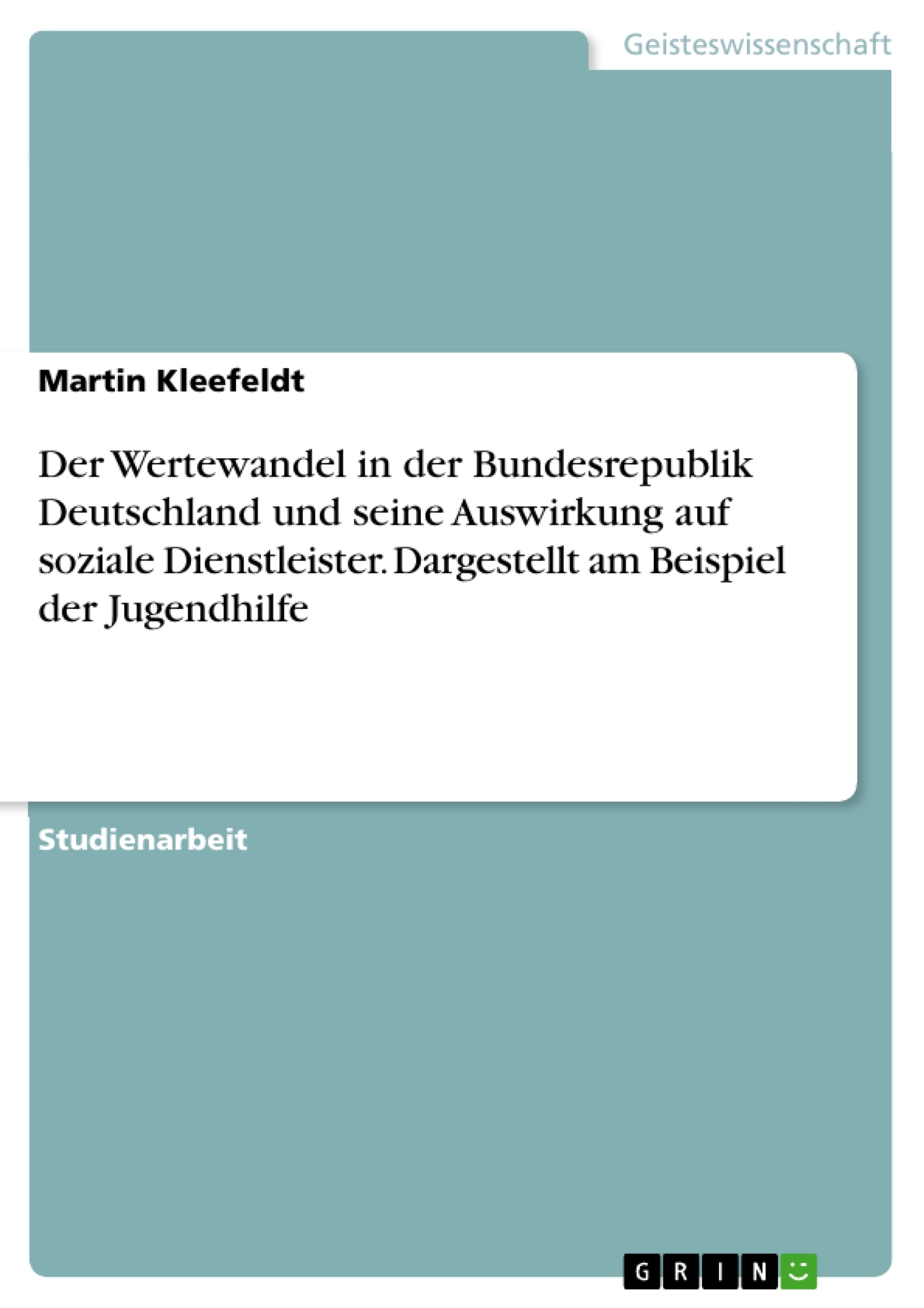Um den Prozess des Wertewandels in der Bundesrepublik Deutschland besser verstehen zu können und die Auswirkungen auf soziale Dienstleiter und jugendliche Lebenswelten dazustellen, werden als erstes die theoretischen Hintergründe des Wertewandels besprochen und die wichtigsten Theoretiker des entsprechenden Diskurses vorgestellt. Anschließend wird aufgezeigt, was den Wertewandel laut des Soziologen R. Inglehart begünstigt hat.
Exemplarisch werden dann die Auswirkungen dieses Wandels auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft (Kernfamilie, Geschlechterrollen, Arbeitswelt) aufgezeigt. Anhand der aktuellen Shell-Studie wird diskutiert, welche Auswirkungen der Wertepluralismus und Wandel auf die aktuelle Jugendgeneration hat. Es soll gezeigt werden, dass ein Zusammenhang zwischen Depression, Sinnfindung und Konsumverhalten in der Postmoderne zu bestehen scheint und warum demokratische Wertebildung einen hohen Stellenwert in der Jugendarbeit einnehmen sollte.
Anschließend wird besprochen, wie soziale Dienstleister junge Menschen erfolgreich auf die Veränderungen in der Gesellschaft vorbereiten können und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden müssen. Sinnvermittlung und Wertebildung sind dabei ebenso wichtig wie die Vorbereitung auf neue Geschlechterrollen und veränderte Anforderungen in der Arbeitswelt. Um das Thema in seiner vollen Tiefe zu verstehen, greift die Arbeit zusätzlich das Phänomen der "postmodernen Sinnkriese" auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Ziel der Arbeit
- Theoretische Hintergründe des Wertewandels
- Ursachen von Wertewandel in der Gesellschaft
- Die Auswirkungen des Wertewandels auf verschiedene Teilbereiche der Gesellschaft
- Auswirkungen des Wertewandels auf die klassische Kernfamilie
- Auswirkungen des Wertewandels auf Geschlechterrollen und Erwerbswelt
- Auswirkungen des Wertewandels auf die aktuelle Jugendgeneration
- Anforderungen an soziale Dienstleister im heutigen Wertepluralismus
- Konsumverhalten und Depression durch Sinnvermittlung begegnen
- Durch Familienarbeit die Wertevermittlung stärken
- Wertevermittlung durch Schul- und Jugendarbeit
- Jugendliche Männer auf ein neues Rollenverständnis vorbereiten
- Die Vorbereitung Jugendlicher auf veränderte Anforderungen in der Arbeitswelt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland und seine Auswirkungen auf soziale Dienstleister, insbesondere in der Jugendhilfe. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des Wertewandels, analysiert seine Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft und diskutiert die Herausforderungen für soziale Dienstleister im Kontext des Wertepluralismus.
- Theoretische Grundlagen des Wertewandels
- Auswirkungen des Wertewandels auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft
- Die Rolle sozialer Dienstleister im Kontext des Wertewandels
- Sinnvermittlung und Wertebildung in der Jugendhilfe
- Die Vorbereitung junger Menschen auf veränderte Anforderungen in der Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Ziel der Arbeit
Die Einleitung führt in das Thema Wertewandel und dessen Auswirkungen auf soziale Dienstleister und die Lebenswelt junger Menschen ein. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit dar, die darin besteht, die theoretischen Hintergründe des Wertewandels zu beleuchten und seine Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft zu analysieren.
2. Theoretische Hintergründe des Wertewandels
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Theoretiker des Wertewandels, darunter C. Kluckhohn, M. Rokeach, G. Hofstede und R. Inglehart. Es wird die Konzeption von Werten und deren Wandel erläutert und der Einfluss des Wertewandels auf die Gesellschaft untersucht.
3. Die Auswirkungen des Wertewandels auf verschiedene Teilbereiche der Gesellschaft
Dieses Kapitel widmet sich den Auswirkungen des Wertewandels auf die klassische Kernfamilie, Geschlechterrollen und die Arbeitswelt. Es untersucht die Veränderungen, die durch den Wertewandel in diesen Bereichen entstanden sind und wie sie sich auf die Lebenswelt von Menschen auswirken.
4. Anforderungen an soziale Dienstleister im heutigen Wertepluralismus
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen für soziale Dienstleister im Kontext des Wertepluralismus. Es diskutiert die Bedeutung von Sinnvermittlung und Wertebildung in der Jugendarbeit und wie soziale Dienstleister junge Menschen erfolgreich auf die Veränderungen in der Gesellschaft vorbereiten können.
Schlüsselwörter
Wertewandel, Bundesrepublik Deutschland, soziale Dienstleister, Jugendhilfe, Wertepluralismus, Sinnvermittlung, Wertebildung, Geschlechterrollen, Arbeitswelt, Postmoderne, Shell-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für den Wertewandel in Deutschland?
Laut Theoretikern wie Ronald Inglehart wurde der Wandel durch wirtschaftliche Sicherheit und steigenden Wohlstand begünstigt, was zu einer Verschiebung von materiellen zu postmateriellen Werten führte.
Wie wirkt sich der Wertewandel auf die Kernfamilie aus?
Die klassische Kernfamilie verliert an Exklusivität; es entstehen vielfältigere Lebensformen und veränderte Rollenverständnisse zwischen den Geschlechtern.
Welche Herausforderungen ergeben sich für die heutige Jugendgeneration?
Jugendliche stehen einem Wertepluralismus gegenüber, der zu Orientierungslosigkeit oder einer "postmodernen Sinnkrise" führen kann, was sich oft in Depressionen oder verstärktem Konsumverhalten äußert.
Welche Aufgaben hat die Jugendhilfe im Kontext des Wertewandels?
Soziale Dienstleister müssen junge Menschen auf neue Arbeitsweltanforderungen vorbereiten, demokratische Wertebildung fördern und Sinnvermittlung als Gegenpol zur Konsumorientierung leisten.
Warum ist die Vorbereitung auf neue Geschlechterrollen wichtig?
Besonders junge Männer müssen auf ein verändertes Rollenverständnis vorbereitet werden, um den Anforderungen einer modernisierten Gesellschaft und Arbeitswelt gerecht zu werden.
- Quote paper
- Martin Kleefeldt (Author), 2017, Der Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland und seine Auswirkung auf soziale Dienstleister. Dargestellt am Beispiel der Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425412