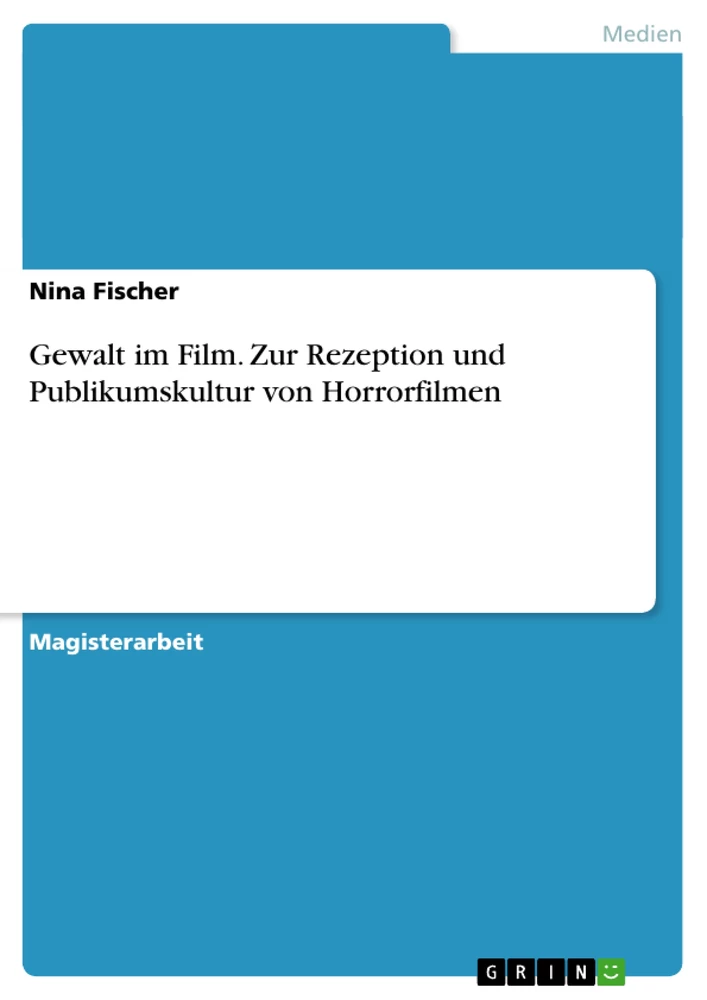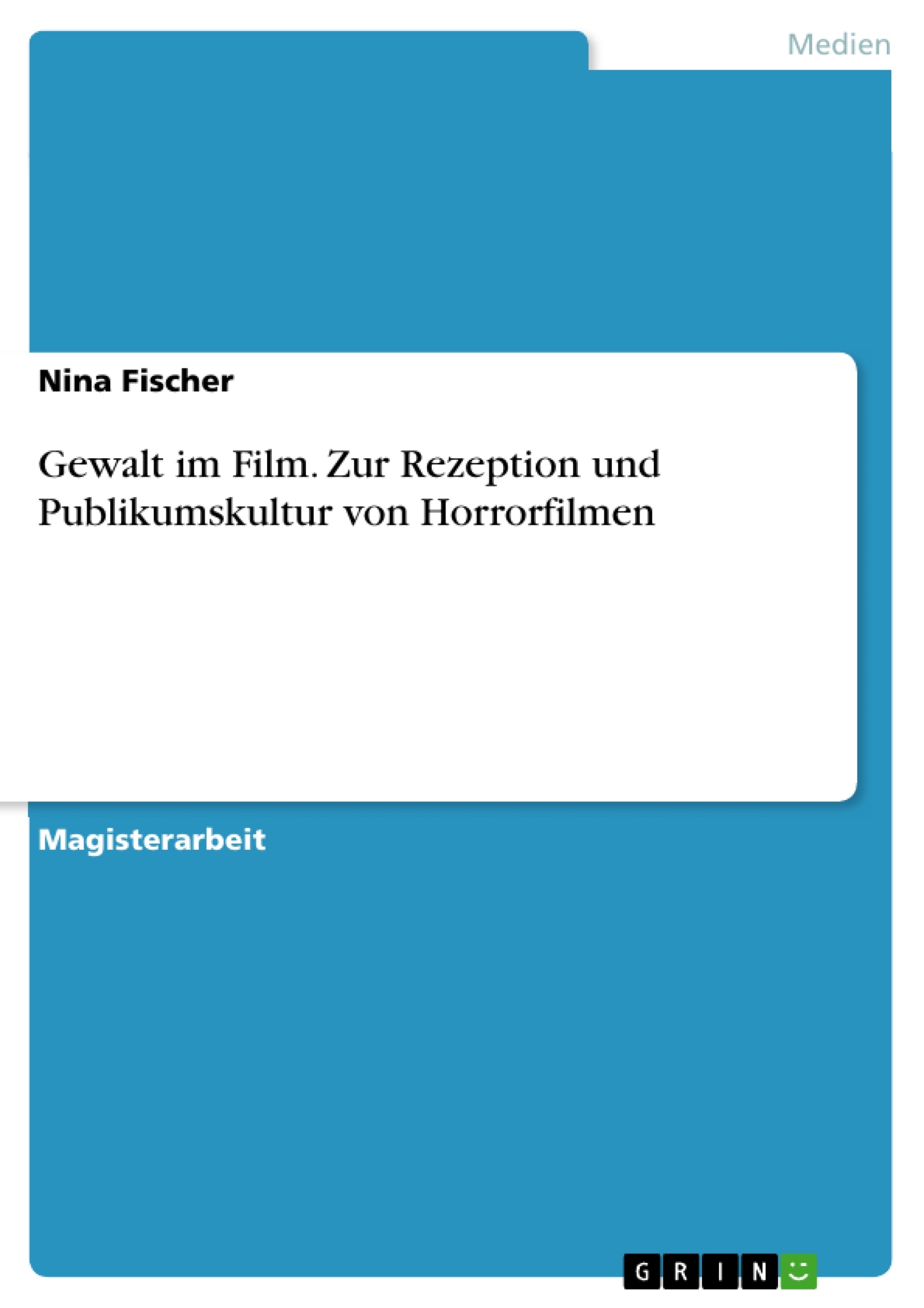Kurze Einführung in das Thema
Die Medienwirkungsforschung durchzieht die gesamte Medienlandschaft. Will ein neues Medium den Markt erobern, so muss es sich zunächst einmal den sehr kritischen Beobachtungen von Pädagogen, Eltern und Forschern unterziehen, auf seine möglichen schädlichen Auswirkungen auf das Wohl einer sich gut entwickelnden Gesellschaft hin.
Besonders häufig und zu besonders brisanten Diskussionen führte und führt das Medium Film.
Seit die Bilder „laufen lernten“ mit der Entwicklung des Kinematographen Ende des 19. Jahrhunderts wurden immer wieder Feindrufe laut, z. Bsp. dass „häufiges Anschauen von Schundfilms mit fast mathematischer Sicherheit zu einer Verrohung des Jugendlichen führen muss“ (Hellwig 1911 in Kunczik 1996, S.11) oder dass „ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Konsum jugendgefährdender Videos (z. Bsp. Horrorvideos) und aggressivem Verhalten“ bestünde (Glogauer 1993, S. 121).
Anlässe so zu denken, bieten sich in der Vergangenheit zahlreich an. Im April 1999 laufen zwei Jugendliche an der Columbine Highschool in Littelton, Colorado, USA Amok und erschießen dreizehn Menschen. Im April 2002 erschießt der ehemalige Schüler Robert Steinhäuser am Gutenberg Gymnasium in Erfurt 16 Menschen und richtet danach sich selbst. All diese Ereignisse geschahen völlig unerwartet und mit höchster Brutalität. Umso brutaler wirken die Taten, da die Täter allesamt noch Jugendliche waren. Schnell sucht man nach Antworten und schnell scheint man sie gefunden zu haben: Die Medien sind schuld. In beiden Fällen konsumierten die Täter harte Videos, harte Musik oder „übten“ bereits am PC das Ausführen von Gräueltaten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Kurze Einführung ins Thema
- 2. Zielsetzung der Arbeit
- 3. Aufbau der Arbeit
- II. Theoretische Grundlagen
- 1. Entwicklung der Medienwirkungsforschung
- 1.1 Die Gewaltdebatte und ihre Anhänger
- 1.2 Die experimental-psychologische Erforschung von Gewaltwirkungen
- 1.3 Momentaner Stand der Medienwirkungsforschung
- 1.4 Zusammenfassung
- 2. Rezeptionsforschung
- 2.1 Der Uses-And-Gratifications-Ansatz
- 2.2 Medien-Interaktion
- 2.3 Rezeption von gewalthaltigen Filmen
- 2.3.1 Action- versus Horrorfilm
- 2.3.2 Verwendung von Gewalt im Film
- 2.3.3 Motivation zur Nutzung von gewalthaltigen Filmen
- 2.3.4 Lebensweltlicher Zweck
- 2.3.5 Täter- und opferzentrierte Rezeption
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Publikumskulturen
- 3.1 Typologie der Rezipienten
- 3.2 Angst - Typen
- 3.3 Die Karriereleiter
- 3.4 Soziologische Charakterisierung der Rezipienten
- 3.4.1 Milieubeschreibungen nach Schulze
- 3.4.2 Filmverhalten der einzelnen Milieus
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. Mediensozialisation
- 4.1 Sozialisationsphasen
- 4.2 Einflussfaktoren
- 4.3 Integration der Medien in den Alltag
- 4.4 Zusammenfassung
- III. Praktischer Teil
- 1. Zielsetzung und Hypothesenbildung
- 2. Forschungsdesign
- 2.1 Zielgruppe
- 2.2 Setting
- 2.3 Fragebogen
- 2.3.1 Inhaltlicher und methodischer Aufbau
- 2.3.2 Der Fragebogen
- 3. Ergebnisse und Interpretationen
- 3.1 Statistische Angaben
- 3.2 Klassifizierung der unterschiedlichen Zuschauertypen
- 3.3 Verteilung der Rezipiententypen an den Bildungsinstitutionen
- 3.3.1 Verteilung der Rezipiententypen an Gymnasien
- 3.3.2 Verteilung der Rezipiententypen an Hauptschulen
- 3.3.3 Der Vergleich: Hauptschule – Gymnasium
- 3.4 Viel- und Wenigseher unter den verschiedenen Rezipiententypen
- 3.5 Der Besitz eines eigenen Fernsehers
- 3.6 Motivation und emotionales Filmerleben der Schüler
- 3.6.1 Gymnasiasten
- 3.6.2 Hauptschüler
- 3.6.3 Der Vergleich: Hauptschule - Gymnasium
- 3.7 Einfluss von Horrorfilmen auf die Einschätzung realer Gewalt bei Hauptschülern und Gymnasiasten
- IV. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgewohnheiten von Schülern verschiedener Schulformen im Umgang mit Horrorfilmen. Ziel ist es, den Einfluss von soziokulturellen Faktoren auf die Rezeption gewalthaltiger Medieninhalte zu analysieren und Unterschiede zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern aufzuzeigen.
- Entwicklung der Medienwirkungsforschung und ihre Relevanz für die Rezeption von Gewalt im Film
- Rezeptionsforschung und verschiedene Ansätze zur Analyse des Medienkonsums
- Soziologische Charakterisierung der Rezipienten und deren Einfluss auf die Filmauswahl und -rezeption
- Vergleichende Analyse der Rezeptionsgewohnheiten von Gymnasiasten und Hauptschülern
- Der Einfluss des Konsums von Horrorfilmen auf die Wahrnehmung von realer Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel führt in die Thematik der Rezeptionsgewohnheiten im Kontext von Horrorfilmen ein, beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel. Es legt den Fokus auf den Vergleich der Rezeption von Horrorfilmen bei Schülern unterschiedlicher Schulformen und die Bedeutung der Medienwirkungsforschung in diesem Zusammenhang.
II. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Medienwirkungsforschung, beginnend mit der Gewaltdebatte und der experimentell-psychologischen Forschung. Es präsentiert den aktuellen Stand der Forschung und beleuchtet verschiedene Ansätze der Rezeptionsforschung, insbesondere den Uses-and-Gratifications-Ansatz. Der Fokus liegt auf der Rezeption gewalthaltiger Filme, der Motivation zur Nutzung und den unterschiedlichen Rezeptionstypen (z.B. täter- oder opferzentriert). Zusätzlich werden Publikumskulturen und Mediensozialisation als relevante Einflussfaktoren auf die Medienrezeption thematisiert. Die Kapitel umfassen verschiedene Theorien und Modelle, die im weiteren Verlauf der Arbeit zur Interpretation der Ergebnisse herangezogen werden.
III. Praktischer Teil: Der praktische Teil beschreibt das Forschungsdesign, die Methodik und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Zielgruppe, das Setting und der Aufbau des Fragebogens detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Befragung von Schülern verschiedener Schulformen werden präsentiert und interpretiert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Unterschiede in der Rezeption von Horrorfilmen zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern gelegt wird. Die Analyse umfasst die Verteilung verschiedener Rezipiententypen, das Filmbetrachtungsverhalten und den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Horrorfilmen und der Einschätzung von realer Gewalt.
Schlüsselwörter
Rezeptionsgewohnheiten, Horrorfilm, Medienwirkungsforschung, Gewalt, Rezeptionsforschung, Publikumskulturen, Mediensozialisation, Schüler, Gymnasiasten, Hauptschüler, Schulform, Vergleichende Analyse, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rezeptionsgewohnheiten von Schülern im Umgang mit Horrorfilmen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rezeptionsgewohnheiten von Schülern verschiedener Schulformen (Gymnasium und Hauptschule) im Umgang mit Horrorfilmen. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Einflusses soziokultureller Faktoren auf die Rezeption gewalthaltiger Medieninhalte und der Vergleich zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss soziokultureller Faktoren auf die Rezeption von Horrorfilmen zu analysieren und Unterschiede zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern aufzuzeigen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung des Einflusses des Konsums von Horrorfilmen auf die Wahrnehmung von realer Gewalt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung der Medienwirkungsforschung und ihre Relevanz für die Rezeption von Gewalt im Film; verschiedene Ansätze der Rezeptionsforschung (insbesondere Uses-and-Gratifications); die soziologische Charakterisierung der Rezipienten und deren Einfluss auf die Filmauswahl und -rezeption; eine vergleichende Analyse der Rezeptionsgewohnheiten von Gymnasiasten und Hauptschülern; und schließlich den Einfluss des Konsums von Horrorfilmen auf die Wahrnehmung realer Gewalt.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Entwicklung der Medienwirkungsforschung, beginnend mit der Gewaltdebatte und der experimentell-psychologischen Forschung. Es werden verschiedene Ansätze der Rezeptionsforschung, wie der Uses-and-Gratifications-Ansatz, sowie Theorien zu Publikumskulturen und Mediensozialisation behandelt. Diese theoretischen Grundlagen dienen der Interpretation der empirischen Ergebnisse.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile: Einleitung (Einführung ins Thema, Zielsetzung, Aufbau), Theoretische Grundlagen (Medienwirkungsforschung, Rezeptionsforschung, Publikumskulturen, Mediensozialisation), Praktischer Teil (Forschungsdesign, Methodik, Ergebnisse der empirischen Untersuchung) und Ausblick.
Welche Methodik wurde im praktischen Teil verwendet?
Der praktische Teil beinhaltet eine empirische Untersuchung mit einem Fragebogen. Die Zielgruppe umfasste Schüler verschiedener Schulformen. Der Fragebogen erfasste Aspekte wie Filmauswahl, Rezeptionsgewohnheiten, emotionales Filmerleben und die Wahrnehmung von realer Gewalt. Die Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die statistische Auswertung der Fragebogendaten, die Klassifizierung verschiedener Zuschauertypen, deren Verteilung an Gymnasien und Hauptschulen, den Vergleich des Filmbetrachtungsverhaltens und des Besitzes eines eigenen Fernsehers. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen Gymnasiasten und Hauptschülern hinsichtlich ihrer Motivation, ihres emotionalen Filmerlebens und des Einflusses von Horrorfilmen auf die Einschätzung realer Gewalt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Unterschiede in den Rezeptionsgewohnheiten von Gymnasiasten und Hauptschülern im Umgang mit Horrorfilmen und den Einfluss soziokultureller Faktoren. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Horrorfilmen und der Wahrnehmung von realer Gewalt interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rezeptionsgewohnheiten, Horrorfilm, Medienwirkungsforschung, Gewalt, Rezeptionsforschung, Publikumskulturen, Mediensozialisation, Schüler, Gymnasiasten, Hauptschüler, Schulform, Vergleichende Analyse, Empirische Forschung.
- Citation du texte
- Nina Fischer (Auteur), 2004, Gewalt im Film. Zur Rezeption und Publikumskultur von Horrorfilmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42553