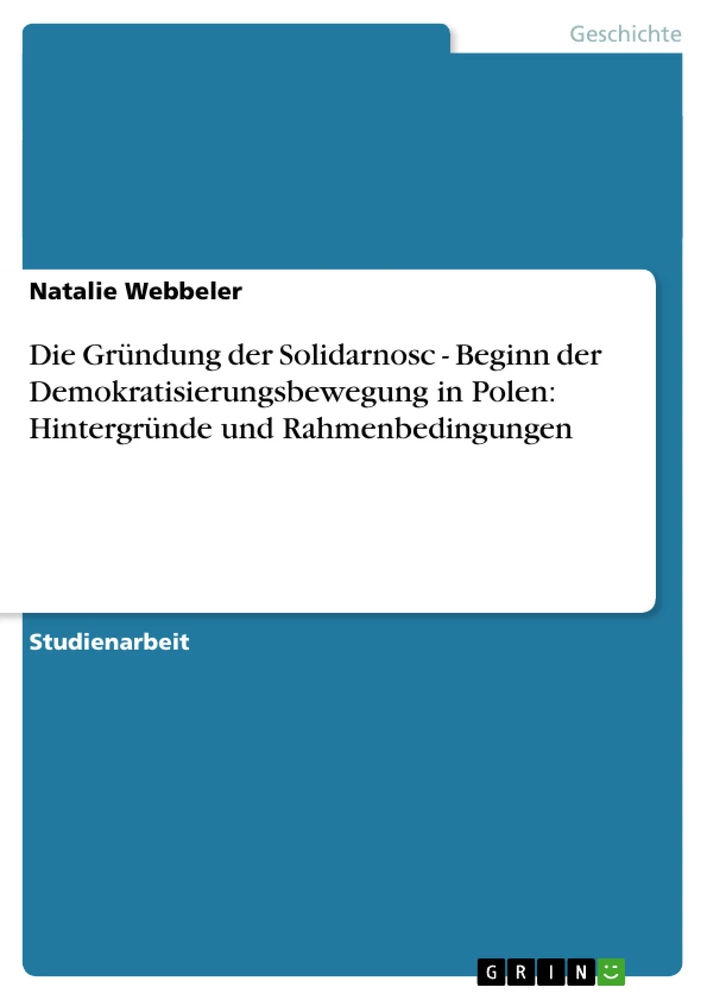Bis in das 19. Jhd. lässt sich zurückverfolgen, dass Polen stets über ein Parteiensystem verfügte, dessen Parteien mit unterschiedlichen Positionen politisch tätig waren. So war es auch nicht verwunderlich, dass nach 1945 sich die polnische Gesellschaft am intensivsten dagegen sträubte, eine von der Sowjetunion (SU) aufgezwungene Ein-Parteien-Diktatur hinzunehmen. Eine weitere Grunderfahrung, welche die Abläufe von 1980/81 beeinflusste, war die Tatsache, dass die Polnische Vereinte Arbeiterpartei (PZPR) in der Nachkriegszeit bereits zweimal durch Druck aus der Bevölkerung gezwungen worden war, ihre Führungsmannschaft auszutauschen. 1956 wurde auf Druck der Arbeiter und Intellektuellen Gomułka als Erster Sekretär eingesetzt, welcher erst kurz zuvor wegen Abweichungen vom stalinistischen Kurs aus der Haft entlassen wurde. 1970, 14 Jahre später, wurde jedoch auch er durch öffentlichen Druck gezwungen, sein Amt niederzulegen. In Danzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen streikenden Arbeitern und der bewaffneten Polizei mit dem Ergebnis, dass nahezu 50 Menschen getötet und mehr als 1000 verletzte wurden. Die landesweite Empörung war so groß, dass wiederum die Führungsmannschaft ausgewechselt wurde. Edward Gierek wurde Erster Sekretär der PZPR und damit der leitende Mann im Staate. Beide Vorgänge, die in anderen sozialistischen Ländern keine Parallele finden, sind kennzeichnend für die besondere Situation Polens und stehen in engem Zusammenhang mit der Bewegung der Solidarność.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtlicher Rückblick
- Die Entfaltung der oppositionellen Kräfte vor 1980
- Die Diskussion über die Verfassungsänderung in den Jahren 1975 und 1976
- Die Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und Helsinki
- Die Arbeiterunruhen im Sommer 1976 vor allem in den Städten Radom und Ursus, hervorgerufen durch drastische, nicht vorangekündigte Preiserhöhungen
- Die Forderung nach einer freien, unabhängigen Gewerkschaft
- Arbeiterselbstverwaltung
- Literatur und Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Gründung der Solidarność in Polen und beleuchtet die Hintergründe und Rahmenbedingungen, die zu dieser wegweisenden Entwicklung führten. Die Entstehung der Solidarność markiert den Beginn der Demokratisierungsbewegung in Polen und setzt ein wichtiges Zeichen für die Herausforderungen und Chancen, die mit einem Wandel von einer Ein-Parteien-Diktatur zu einer freien Gesellschaft einhergehen.
- Die historische Entwicklung und die politischen Rahmenbedingungen in Polen vor 1980
- Die Rolle der Arbeiterklasse und die Entstehung der Opposition im Arbeitermilieu
- Die Forderung nach einer freien, unabhängigen Gewerkschaft und die Bedeutung der Solidarność
- Die Auswirkungen der Solidarność auf die polnische Gesellschaft und die politische Landschaft
- Die Herausforderungen und Chancen der Demokratisierung in Polen
Zusammenfassung der Kapitel
Geschichtlicher Rückblick
Das Kapitel zeichnet die historischen Entwicklungen in Polen nach, die die Entstehung der Solidarność prägten. Es beleuchtet die Geschichte der politischen Partizipation in Polen, die Herausforderungen der Ein-Parteien-Diktatur nach dem Zweiten Weltkrieg und die Rolle der Polnischen Vereinten Arbeiterpartei (PZPR). Die Kapitel analysiert zudem die Ereignisse von 1956 und 1970, die zeigen, wie die polnische Bevölkerung in den 1970er Jahren immer stärker gegen die Herrschaft der PZPR protestierte.
Die Entfaltung der oppositionellen Kräfte vor 1980
Das Kapitel analysiert die Entwicklung der oppositionellen Kräfte in Polen vor 1980 und zeigt, wie die Diskussion über die Verfassungsänderung, die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki und die Arbeiterunruhen von 1976 die Opposition weiter stärkten. Es wird deutlich, dass die Opposition trotz dieser Fortschritte noch keine einheitliche Bewegung bildete und ihre Forderungen zum Teil auf die konkrete Situation in Polen beschränkt blieben. Die Kapitel stellt auch die Rolle des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter (KOR) und die Bedeutung der Charta der Arbeiterrechte heraus.
Die Forderung nach einer freien, unabhängigen Gewerkschaft
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung der Solidarność im „Polnischen Sommer“ 1980. Die unerwartete Preiserhöhung für Lebensmittel führte zu lokalen Protesten und Arbeitsniederlegungen, die sich bald im gesamten Land ausbreiteten. Das Kapitel fokussiert auf die Forderungen der Streikenden nach einer freien, unabhängigen Gewerkschaft, die garantieren sollte, dass der Streik jederzeit als Mittel gegen Nichteinhalten von Versprechungen seitens des Staates eingesetzt werden konnte. Die Kapitel stellt außerdem die Gründung der Landeskoordinierungskommission unter Lech Walesa und die Ausweitung des Wirkungsbereichs der Solidarność auf ganz Polen dar.
Arbeiterselbstverwaltung
Das Kapitel befasst sich mit der Selbstverwaltung in der Solidarność und ihren Auswirkungen auf die polnische Gesellschaft und die Politik. Es werden die Herausforderungen und Chancen beleuchtet, die mit der Selbstverwaltung der Gewerkschaft verbunden waren, sowie die Bedeutung der Solidarność als Sammelbecken für politische Opposition. Die Kapitel stellt außerdem die Gründung der unabhängigen, selbstverwalteten Gewerkschaft der Individualbauernsolidarität heraus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Gründung der Solidarność in Polen und beleuchtet die Hintergründe und Rahmenbedingungen, die zu dieser Entwicklung führten. Die zentralen Schlüsselbegriffe sind: Arbeiterklasse, oppositionelle Kräfte, freie Gewerkschaft, Solidarność, Arbeiterselbstverwaltung, Demokratisierungsbewegung, Polen, Sowjetunion, PZPR, Kommunismus, Sozialismus, Protest, Streik, Charta der Arbeiterrechte, Johannes Paul II., Helsinki-Akte.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung der Gründung von Solidarność?
Die Gründung der Solidarność im Jahr 1980 markierte den Beginn einer massiven Demokratisierungsbewegung in Polen und war die erste unabhängige Gewerkschaft in einem sozialistischen Land.
Wer war der Anführer der Solidarność-Bewegung?
Lech Wałęsa war der zentrale Kopf der Bewegung und Vorsitzender der Landeskoordinierungskommission der Gewerkschaft.
Welche Ereignisse führten zu den Streiks im Sommer 1980?
Auslöser waren drastische Preiserhöhungen für Lebensmittel durch die polnische Regierung, die auf eine bereits unzufriedene Bevölkerung und eine organisierte Opposition trafen.
Welche Rolle spielte die PZPR in Polen?
Die Polnische Vereinte Arbeiterpartei (PZPR) war die herrschende Einheitspartei, die mehrfach durch öffentlichen Druck gezwungen wurde, ihre Führung auszutauschen (z. B. 1956 und 1970).
Was forderte die Solidarność-Bewegung?
Hauptforderungen waren freie, vom Staat unabhängige Gewerkschaften, das Streikrecht, Arbeiterselbstverwaltung und politische Mitbestimmung.
- Citation du texte
- Natalie Webbeler (Auteur), 2005, Die Gründung der Solidarnosc - Beginn der Demokratisierungsbewegung in Polen: Hintergründe und Rahmenbedingungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42583