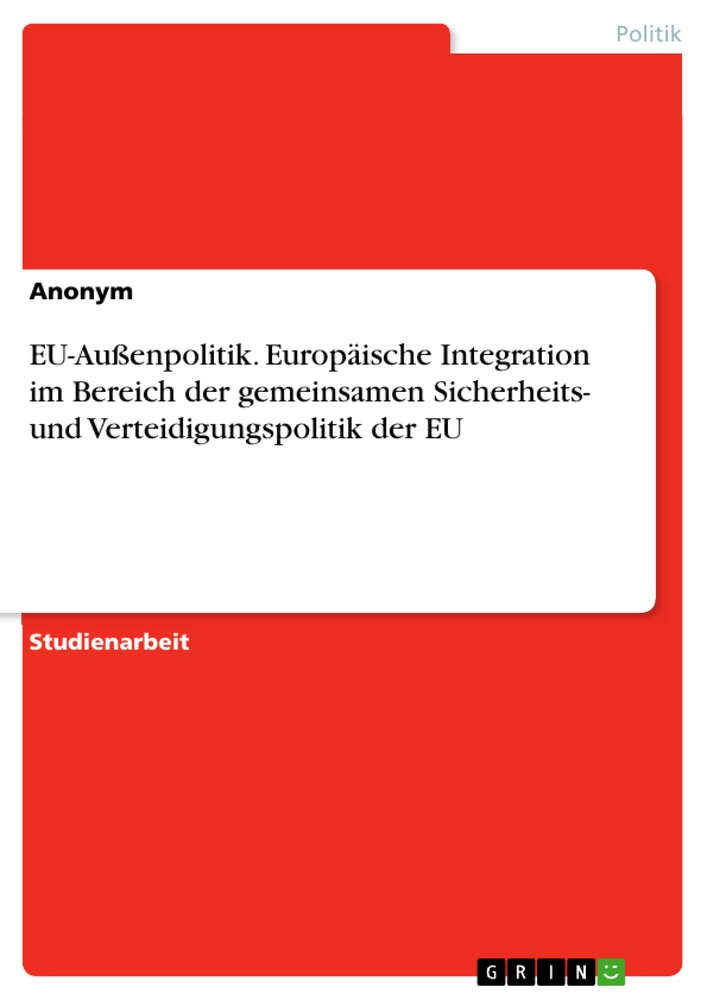In der folgenden Forschungsarbeit standen die Integrationstheorien des Neofunktionalismus und des Liberalen Intergouvernementalismus und ihre Erklärungskraft für die zunehmende europäische Integration durch den Vertrag von Lissabon im Feld der GSVP im Fokus. Die Forschungsfrage, die die Arbeit beantworten sollte, war: Wie lässt sich die zunehmende europäische Integration im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, die durch den Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 eingeleitet wurde, anhand von Integrationstheorien erklären?
Es wurde dafür eine qualitative Inhaltsanalyse für die theoretischen Annahmen der jeweiligen Vertreter der Theorien und die wichtigsten Reformierungen, die durch den Vertrag eingeführt worden sind, durchgeführt. Ziel dabei war es zu ermitteln, inwieweit sich die jeweiligen theoretischen Annahmen dazu eignen die speziellen Reformen und die wachsende europäische Integration im Feld der GSVP zu erklären. Nach einer tiefgründigen Analyse, bei dem die Annahmen auf die speziellen Reformierungen bezogen worden sind, wurde festgestellt, dass sich beide Theorien im unterschiedlichen Maße dazu eignen, die zunehmende Integration innerhalb der GSVP der EU zu erklären. Als Antwort auf die Forschungsfrage kann durchaus die Annahme gemacht werden, dass sich die zunehmende Vergemeinschaftung der MG-Staaten der EU im Bereich der GSVP mehr durch den Liberalen Intergouvernementalismus erklären lässt als durch den Neofunktionalismus.
Hier bestätigte sich vor allem die Annahme von Moravcsik, dass in einen so sensiblen Bereich der GSVP besonders die Nationalstaaten die Integration vorantreiben können, sie aber ebenso schnell wieder stoppen können. Sie bleiben Herren der Verträge und nicht die supranationalen Institutionen, wie es Haas voraussagte. Der europäische Integrationsprozess im Bereich der GSVP richtet sich somit lediglich nach den Interessen der Mitgliedstaaten der EU und nicht nach der Kommission oder dem Europäischen Parlament.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel und Aufbau der Arbeit
- 1.2 Literaturlage
- 2 Theorieauswahl
- 2.1 Neofunktionalismus nach Haas
- 2.2 Liberaler Intergouvernementalismus nach Moravcsik
- 3 Entwicklungen der GSVP bis zum Vertrag von Lissabon
- 3.1 Europäische Sicherheitsstrategie 2003 und 2008
- 3.2 Umgestaltung der GSVP durch den Vertrag von Lissabon
- 3.3 Beziehung EU-NATO mit der Einführung PESCO
- 3.4 PESCO
- 4 Methode und Fallauswahl
- 5 Analyse
- 5.1 Analyse aus Sicht des Neofunktionalismus
- 5.2 Analyse aus Sicht des Liberalen Intergouvernementalismus
- 6 Resümee
- 7 Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die zunehmende europäische Integration im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU, die durch den Vertrag von Lissabon im Jahr 2009 eingeleitet wurde. Dabei werden zwei Integrationstheorien, der Neofunktionalismus und der Liberale Intergouvernementalismus, auf ihre Erklärungskraft für diese Entwicklung untersucht.
- Die Entwicklung der GSVP bis zum Vertrag von Lissabon
- Die Reformierung der GSVP durch den Vertrag von Lissabon
- Die Rolle der Europäischen Sicherheitsstrategie
- Die Anwendung des Neofunktionalismus und des Liberalen Intergouvernementalismus auf die Integration der GSVP
- Die Analyse der Erklärungskraft beider Theorien für die Entwicklung der GSVP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Ziel der Arbeit vor, erläutert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die Relevanz der Thematik im Kontext der europäischen Integration. Die Kapitel 2 und 3 beleuchten die zwei ausgewählten Integrationstheorien, den Neofunktionalismus und den Liberalen Intergouvernementalismus, sowie die Entwicklungen der GSVP bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Kapitel 4 befasst sich mit der Methode und Fallauswahl der Arbeit. Die Analyse in Kapitel 5 untersucht die Reformierungen im Lissaboner Vertrag aus Sicht beider Theorien. Abschließend fasst das Resümee die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit fokussiert auf die europäische Integration im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU, die Integrationstheorien Neofunktionalismus und Liberaler Intergouvernementalismus, den Vertrag von Lissabon, die Europäische Sicherheitsstrategie, die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) bzw. PESCO sowie die Beziehung zwischen der EU und der NATO.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat der Vertrag von Lissabon die GSVP verändert?
Der Vertrag von 2009 führte wichtige Reformen ein, darunter die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) und eine stärkere Koordinierung der europäischen Verteidigungspolitik.
Was erklärt der Liberale Intergouvernementalismus in der GSVP?
Diese Theorie (nach Moravcsik) besagt, dass die Nationalstaaten "Herren der Verträge" bleiben und Integration nur dann stattfindet, wenn sie den nationalen Interessen der Mitgliedstaaten dient.
Was ist der Unterschied zum Neofunktionalismus?
Der Neofunktionalismus (nach Haas) sieht supranationale Institutionen als Treiber der Integration. In der GSVP zeigt sich jedoch, dass eher die Staaten als die EU-Kommission die Kontrolle behalten.
Was bedeutet PESCO?
PESCO steht für "Permanent Structured Cooperation" (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit) und ermöglicht es EU-Staaten, im Bereich Sicherheit und Verteidigung enger zu kooperieren.
Welche Rolle spielt die Europäische Sicherheitsstrategie?
Die Strategien von 2003 und 2008 bildeten den konzeptionellen Rahmen für die GSVP und definierten die Bedrohungslagen und Ziele der europäischen Außenpolitik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, EU-Außenpolitik. Europäische Integration im Bereich der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426210