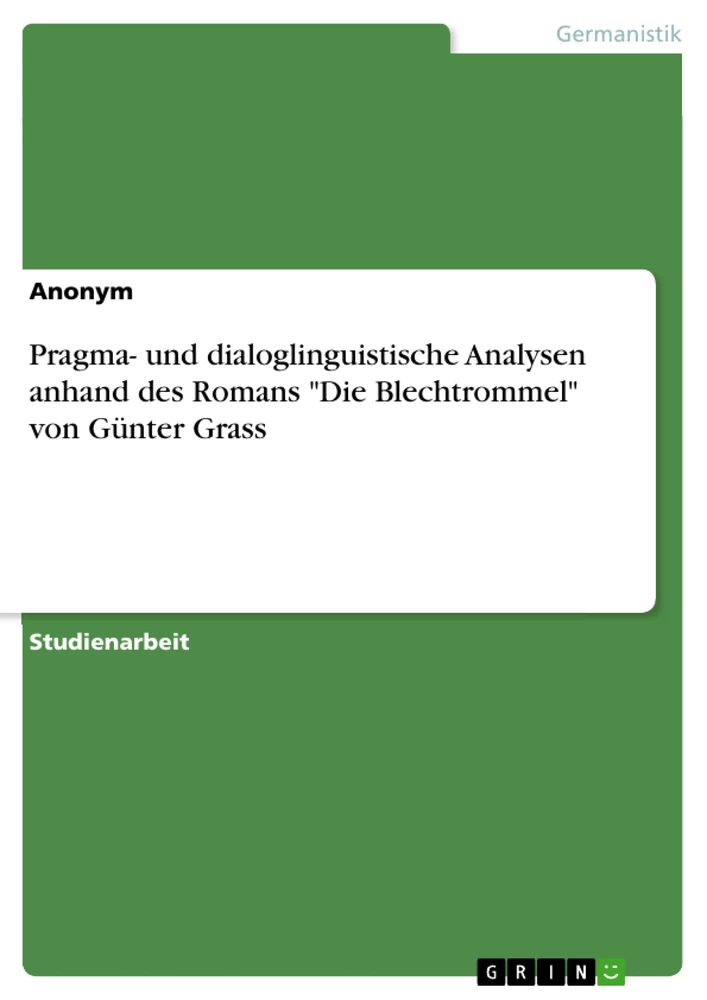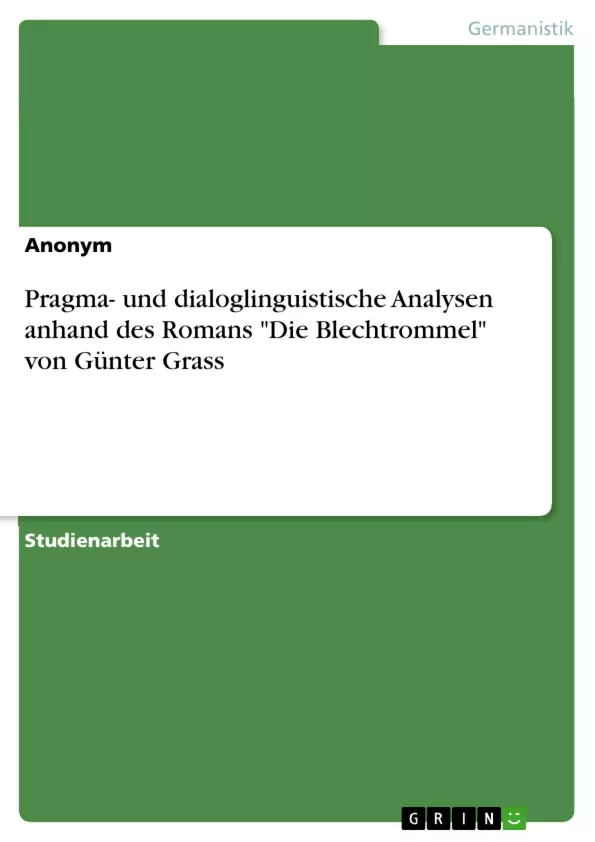Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Roman „Die Blechtrommel“ von Günter Grass. Anhand dieses Romans wird eine pragma- und dialoglinguistische Analyse mit besonderer Konzentration auf bestimmte Dialoggruppen durchgeführt. Zu den analysierenden Dialoggruppen gehören die Familiengespräche, Gespräche zwischen Oskar und Meister Bebra beziehungsweise die Gespräche der Soldaten am Atlantikwall. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beschreibung der Beziehung der sprachlichen Äußerung in Form von Dialogen zur literarischen Funktion. In dieser Untersuchung geht es um die Frage: Welche Beziehung besteht zwischen der Erzählrede und Figurenrede? Welche Funktionen erfüllen die Dialoge in diesem Roman? Wie korreliert die linguistische Analyse mit der literarischen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Erzähltechnik und die Formen der Redewiedergaben
- Dialoge in Erzähltexten
- Pragma- und dialoglinguistischer Ansatz als Mittel der Dialoganalyse
- Analyse I.: Familiengespräche
- Analyse II: Gespräche mit Bebra
- Analyse III.: Gespräch am Atlantikwall
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Roman "Die Blechtrommel" von Günter Grass anhand eines pragma- und dialoglinguistischen Ansatzes, wobei ein Fokus auf bestimmte Dialoggruppen innerhalb des Werks gelegt wird. Die Analyse zielt darauf ab, die Beziehung zwischen sprachlichen Äußerungen und ihrer literarischen Funktion in diesem bedeutenden Werk der Weltliteratur aufzuzeigen.
- Die Erzählstrategie und ihre Auswirkungen auf die Perspektive des Romans
- Die Formen der Redewiedergabe und ihre Funktionen in der Erzählung
- Die Charakterisierung von Figuren durch Dialoge und ihre Rolle im Handlungsverlauf
- Die Interaktion zwischen sprachlichen Äußerungen und narrativen Ebenen im Roman
- Die Beziehung zwischen linguistischer Analyse und literarischer Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Roman "Die Blechtrommel" als zentrales Untersuchungsobjekt vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die pragma- und dialoglinguistische Analyse bestimmter Dialoggruppen konzentriert.
Die Erzähltechnik und die Formen der Redewiedergaben: Dieses Kapitel beleuchtet die Erzählstrategie des Romans, insbesondere den Wechsel zwischen Oskars Perspektive als Erzähler und Protagonist. Die Dualität in der Oskars Erzählhaltung wird untersucht, sowie verschiedene Formen der Redewiedergabe, die zur Vermittlung der Geschichte beitragen.
Dialoge in Erzähltexten: Dieses Kapitel erörtert die allgemeine Funktion von Dialogen in literarischen Texten, insbesondere ihre Rolle in der Charakterisierung von Figuren, dem Vorantreiben der Handlung und der Darstellung von Beziehungen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen "Die Blechtrommel", "Günter Grass", "pragma- und dialoglinguistische Analyse", "Redewiedergabe", "Dialoganalyse", "Erzählstrategie", "Figurenrede", "literarische Funktion", "Dialoggruppen", "Familiengespräche", "Gespräche mit Bebra", "Gespräch am Atlantikwall".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der linguistischen Analyse von „Die Blechtrommel“?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen sprachlichen Äußerungen (Dialogen) und ihrer literarischen Funktion im Roman von Günter Grass.
Welche Dialoggruppen werden besonders untersucht?
Analysiert werden Familiengespräche, Dialoge zwischen Oskar und Meister Bebra sowie die Gespräche der Soldaten am Atlantikwall.
Wie wird Oskars Erzähltechnik beschrieben?
Die Analyse beleuchtet den Wechsel zwischen Oskars Perspektive als Erzähler und als handelnder Protagonist sowie die daraus resultierende Dualität der Erzählhaltung.
Welche Funktion haben Dialoge in diesem Erzähltext?
Dialoge dienen der Charakterisierung der Figuren, treiben die Handlung voran und spiegeln die sozialen Beziehungen innerhalb des Romans wider.
Was ist ein pragma- und dialoglinguistischer Ansatz?
Dieser Ansatz untersucht Sprache nicht isoliert, sondern in ihrem kommunikativen Kontext und fragt nach der Absicht und Wirkung der Sprechakte.
Wie korreliert linguistische Analyse mit literarischer Interpretation?
Die Arbeit zeigt auf, wie sprachliche Strukturen tiefere literarische Motive und die Erzählstrategie von Günter Grass unterstützen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Pragma- und dialoglinguistische Analysen anhand des Romans "Die Blechtrommel" von Günter Grass, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426218