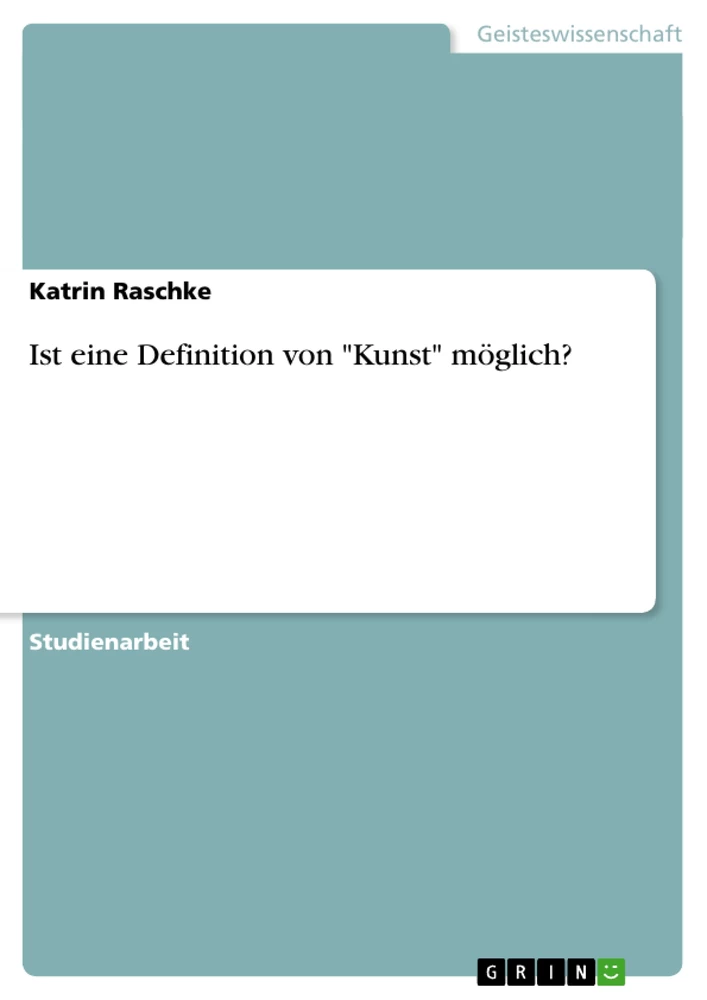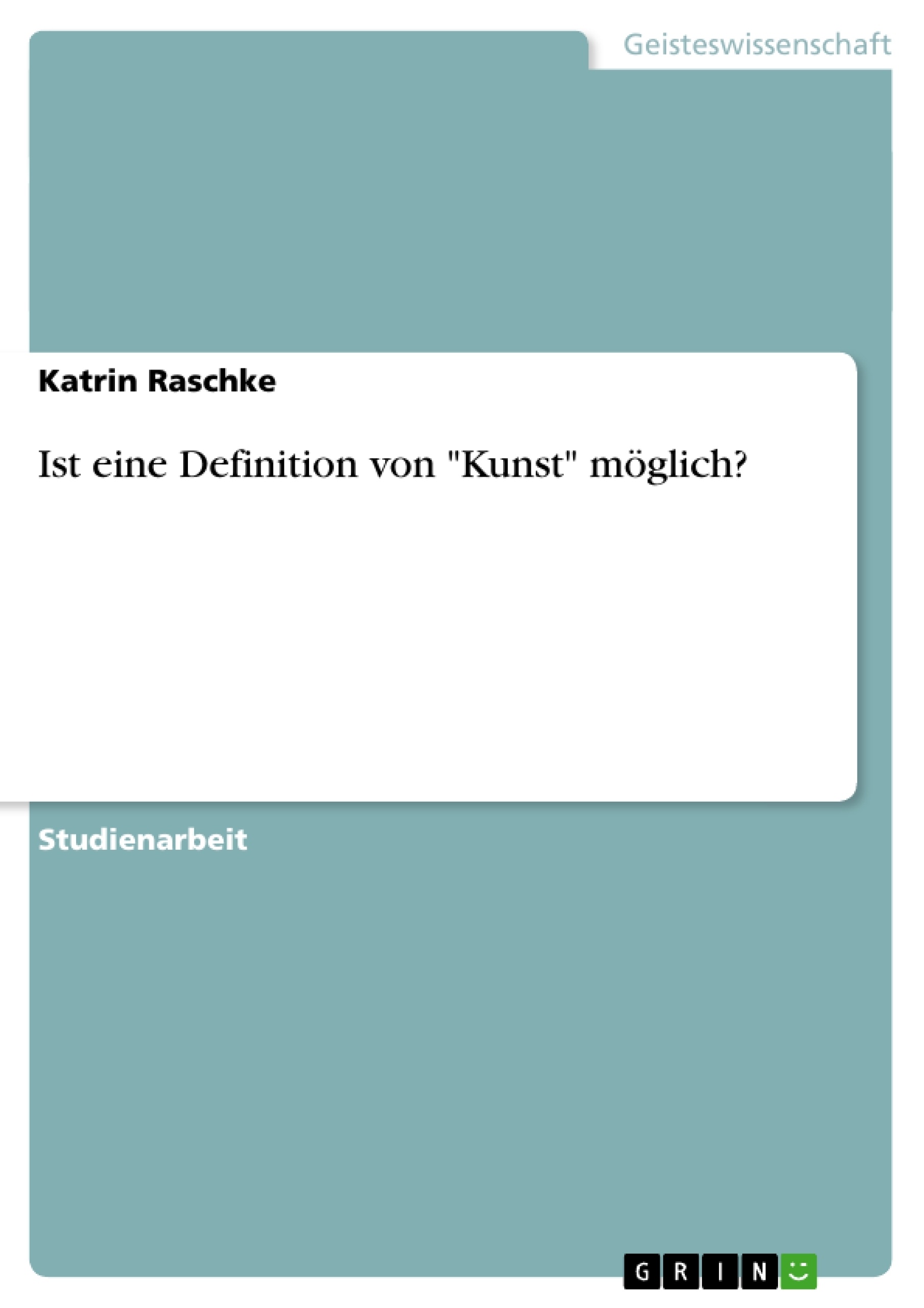Innerhalb dieser Arbeit werde ich mich mit der Frage beschäftigen, ob es überhaupt möglich ist eine Realdefinition im Sinne der Angabe einer Menge notwendiger und hinreichender Eigenschaften für „Kunst“ zu geben.
Zu Beginn werde ich zunächst eine historische und inhaltliche Einführung in die durch diese Frage ausgelöste Debatte in der Ästhetik oder – und jene Bezeichnung erscheint mir heutzutage angemessener – Kunstphilosophie geben. Hierbei werde ich besonderen Wert darauf legen, den Entstehungskontext für das Aufkommen dieser Fragestellung aufzuzeigen. Anschließend werde ich das m. E. zentrale Argument gegen die Möglichkeit einer Definition von „Kunst“ herausgreifen, das von Kritikern in mehr oder weniger derselben Form vorgebracht wurde. Bei diesem Argument handelt es sich um das so genannte „open concept argument“, das besagt, dass es sich bei dem Begriff der „Kunst“ um einen „offenen Begriff“ handelt, der es rein logisch unmöglich macht, notwendige und hinreichende Bedingungen anzugeben. Da sich Vertreter dieses Arguments zumeist auf Ludwig Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeiten stützen, werde ich diesen im darauf folgenden Abschnitt etwas näher untersuchen. Im letzten Teil meiner Hausarbeit werde ich sowohl das zuvor rekonstruierte „open concept argument“ als auch die Untermauerung durch Wittgensteins Familienähnlichkeitsbegriff kritisieren. Am Ende hoffe ich zumindest ansatzweise gezeigt zu haben, dass das „open concept argument“ fehlschlägt.
Als Textgrundlage werde ich vor allem Morris Weitz’ 1956 erschienenen Schlüsseltext „The Role of Theory in Aesthetics“ und William E. Kennicks Aufsatz „Does Traditional Aesthetics Rest on a Mistake?” verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische und inhaltliche Einführung in die Debatte
- Das "open concept argument"
- Ludwig Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeiten
- Kritik
- Zum "open concept argument"
- Zum Begriff der Familienähnlichkeiten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Möglichkeit einer Realdefinition für „Kunst“ im Sinne einer Auflistung notwendiger und hinreichender Eigenschaften. Hierfür werden die historische Entwicklung und inhaltliche Ausgestaltung der Debatte in der Kunstphilosophie beleuchtet, insbesondere das „open concept argument“ und Wittgensteins Konzept der Familienähnlichkeiten.
- Kritik an der „traditionellen Ästhetik“ (TÄ) und ihrer Suche nach einer Definition der Natur der Kunst
- Das „open concept argument“: Die Unmöglichkeit einer essentialistischen Definition von „Kunst“
- Der Familienähnlichkeitsbegriff bei Wittgenstein und seine Anwendung auf den Kunstbegriff
- Kritik an der Argumentation des „open concept argument“ und des Familienähnlichkeitsbegriffs
- Der Einfluss der analytischen Philosophie auf die Debatte um den Kunstbegriff
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Hausarbeit vor.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Debatte um eine Definition von „Kunst“ und präsentiert die Kritik an der „traditionellen Ästhetik“ durch Morris Weitz und William E. Kennick.
- Das dritte Kapitel behandelt das „open concept argument“, welches die Unmöglichkeit einer essentialistischen Definition von „Kunst“ postuliert.
- Das vierte Kapitel untersucht Ludwig Wittgensteins Begriff der Familienähnlichkeiten im Kontext der Kunstdebatte.
- Das fünfte Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung sowohl mit dem „open concept argument“ als auch mit Wittgensteins Konzept der Familienähnlichkeiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Kunstphilosophie, darunter die Definition von Kunst, der „open concept argument“, der Familienähnlichkeitsbegriff von Wittgenstein, die Kritik an der „traditionellen Ästhetik“ und die Rolle der analytischen Philosophie in der Kunstdebatte. Diese Schlüsselwörter spiegeln die zentralen Themen und Konzepte der Hausarbeit wider.
- Citar trabajo
- Katrin Raschke (Autor), 2005, Ist eine Definition von "Kunst" möglich?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42625