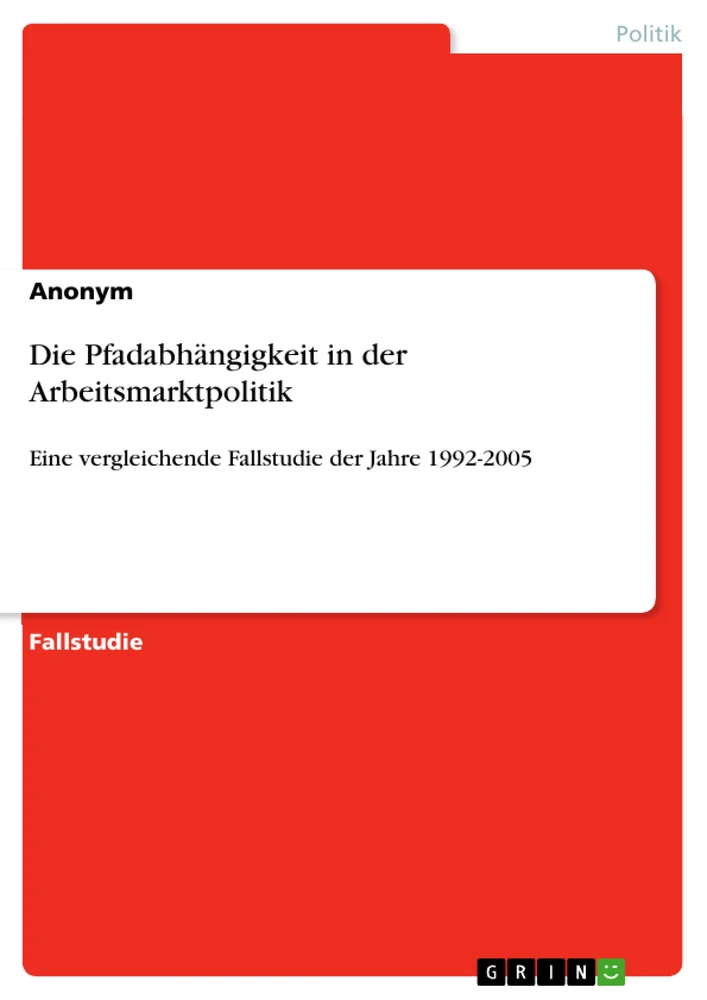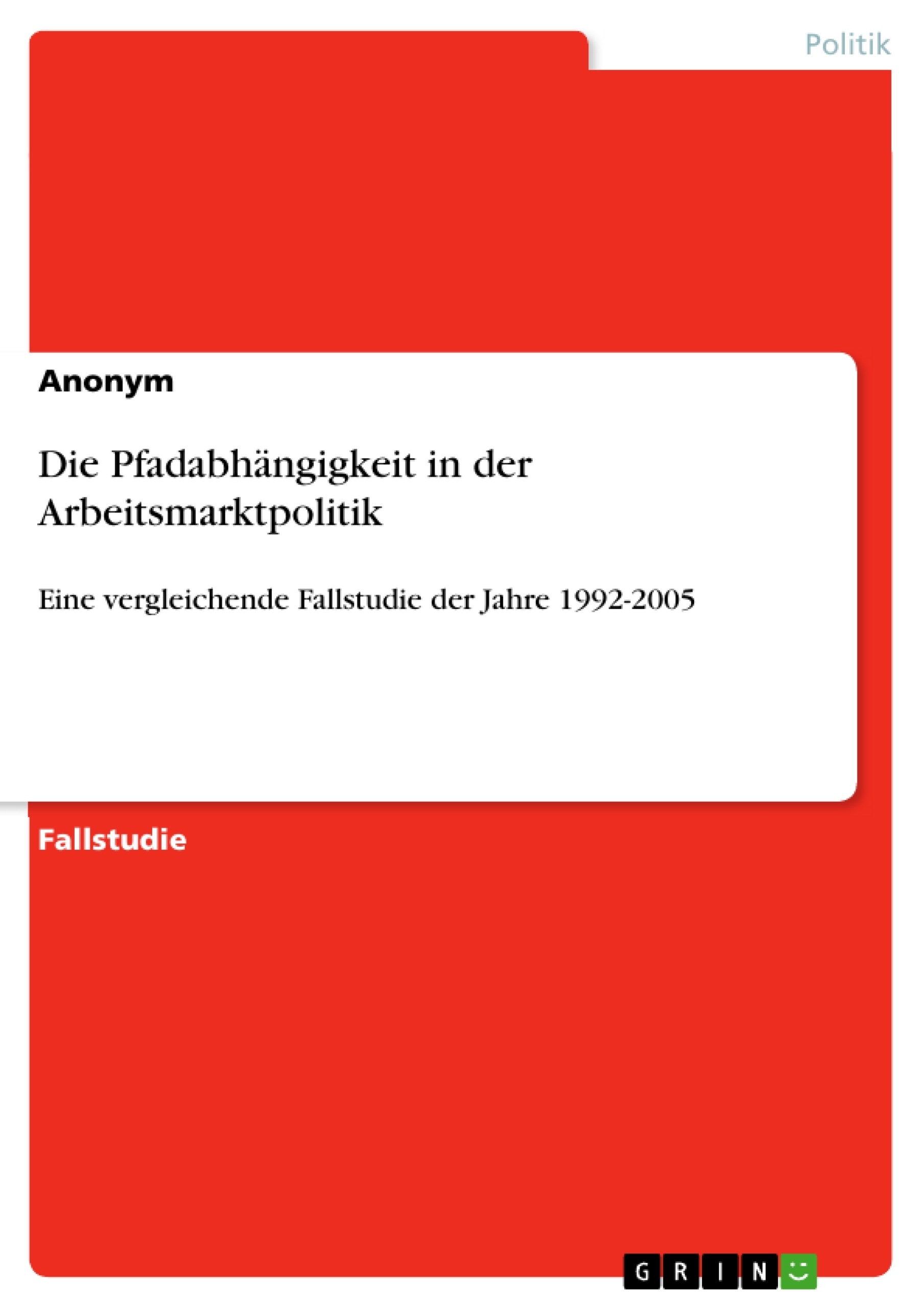Diese Arbeit versucht Merkmale für Pfadabhängigkeit oder Pfadwechsel in den Jahren 1992-2005 in der deutschen Arbeitsmarktpolitik nachzuweisen. Dies wird versucht mithilfe der Theorie der Pfadabhängigkeit nach Bernhard Ebbinghaus, der eine offene Variante der Pfadabhängigkeit begründet hat mit deren Hilfe auch Pfadwechsel begründet werden können.
In einem ersten Teil wird die Theorie der Pfadabhängigkeit in einem allgemeinen Sinne definiert und ihr Zustandekommen erklärt. In einem weiteren Schritt wird die Theorie der Pfadabhängigkeit den institutionellen Theorien zugeordnet und diese Zuordnung begründet. Um im Anschluss die verschiedenen Konzepte der Pfadabhängigkeit voneinander abgrenzen zu können, werden kurz die Pfadabhängigkeitskonzepte von Paul Pierson und Christoph Conrad vorgestellt. Daran schließt sich das Novum der „zwei Pfadabhängigkeitstheoreme“ von Bernhard Ebbinghaus an, dessen Konzept die Grundlage dieser Arbeit darstellt. Hierbei werden auch die Bedingungen für Pfadabhängigkeit und auch für einen Pfadwechsel bestimmt und aufgezählt.
Daran schließt sich die besondere Stellung der Sozialpolitik in der Theorie der Pfadabhängigkeit an zu deren Aufgaben die Arbeitsmarktpolitik zählt. Im zweiten Teil der Arbeit geht es um die eigentliche Fragestellung der Arbeit, die sich damit beschäftigt inwieweit vorangegangene Reformen oder Reformvorhaben in der Arbeitsmarktpolitik die zukünftigen Entscheidungen bestimmt haben. Hierzu werden die Jahre 1992-2005 in drei bis vier Jahresschritten untergliedert, um die stattgefundenen Entwicklungen und deren Einfluss auf zukünftige Ereignisse besser abbilden zu können. Im Anschluss hieran werden die Reformen, die nach Peter Hall (1993) in Reformen erster, zweiter und dritter Ordnung unterteilt werden auf ihre Tendenz zur Pfadabhängigkeit oder zum Pfadbruch analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pfadabhängigkeit: Geschichte und Definition
- Pfadabhängigkeit als Konzept institutioneller Theorie
- Verschiedene Betrachtungsweisen der Theorie der Pfadabhängigkeit
- Zwei Pfadabhängigkeitstheoreme nach Bernhard Ebbinghaus
- Bedingungen für eine Pfadabhängigkeit
- Bedingungen, die einen Pfadwechsel begünstigen können
- Pfadabhängigkeit in der Sozialpolitik
- Die Pfadabhängigkeit in der Arbeitsmarktpolitik - wie vorangegangene Entscheidungen zukünftige determinieren
- Die Jahre 1992-1995
- Die Jahre 1995-1998
- Die Jahre 1998-2002
- Die Jahre 2002-2005
- Zusammenfassung: Welche Bedingungen führten zu einem Pfadwechsel?
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Pfadabhängigkeitstheorie auf die deutsche Arbeitsmarktpolitik zwischen 1992 und 2005. Ziel ist es, anhand des Konzepts von Bernhard Ebbinghaus aufzuzeigen, inwieweit vergangene Entscheidungen zukünftige Entwicklungen beeinflusst haben und unter welchen Bedingungen Pfadwechsel möglich sind.
- Theorie der Pfadabhängigkeit nach Bernhard Ebbinghaus
- Analyse der deutschen Arbeitsmarktpolitik im Zeitraum 1992-2005
- Identifizierung von Pfadabhängigkeiten und Pfadwechseln
- Bestimmung der Bedingungen für Pfadabhängigkeit und Pfadwechsel
- Anwendung institutioneller Theorien auf die Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die deutsche Arbeitsmarktpolitik von 1992-2005 im Hinblick auf Pfadabhängigkeit und Pfadwechsel, basierend auf Ebbinghaus' Theorie. Der Fokus liegt auf der Analyse vergangener Entscheidungen und deren Einfluss auf zukünftige Entwicklungen. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil zur Definition und Einordnung der Pfadabhängigkeit und einen empirischen Teil zur Analyse der Arbeitsmarktpolitik im ausgewählten Zeitraum.
Pfadabhängigkeit: Geschichte und Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Pfadabhängigkeit und erläutert dessen Bedeutung für die Politikgestaltung. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven vorgestellt, unter anderem das „polya urn model“ und das „QWERTY-Paper“, die die Dynamik von Pfadabhängigkeiten illustrieren. Die eingeschränkte Handlungsfähigkeit von Regierungen aufgrund von „Politikererbe“ und die Rolle von „kleinen“ und „großen“ Entscheidungen werden hervorgehoben.
Pfadabhängigkeit als Konzept institutioneller Theorie: Hier wird die Pfadabhängigkeitstheorie im Kontext institutioneller Theorien verortet. Der „Status-quo-Bias“ von Institutionen und die begrenzte Anschlussfähigkeit der Pfadabhängigkeitstheorie an andere Theorien der Staatstätigkeitsforschung werden diskutiert. Die Unflexibilität von Institutionen und die Herausforderungen bei der Berücksichtigung von Alternativen werden als zentrale Aspekte behandelt.
Verschiedene Betrachtungsweisen der Theorie der Pfadabhängigkeit: Dieser Abschnitt vergleicht unterschiedliche Perspektiven auf die Pfadabhängigkeitstheorie, insbesondere die Ansätze von Paul Pierson und Christoph Conrad. Piersen fokussiert auf sich selbst verstärkende Prozesse und Rückwirkungen von Politik, während Conrad die Pfadabhängigkeit im Kontext der Sozialpolitik, am Beispiel der deutschen Alterssicherung, untersucht. Die unterschiedlichen Schwerpunkte und Anwendungskontexte der Theorie werden beleuchtet.
Zwei Pfadabhängigkeitstheoreme nach Bernhard Ebbinghaus: Das Kapitel beschreibt Ebbinghaus' Unterscheidung zwischen Diffusionspfaden und Entwicklungspfaden. Es erklärt die Eigenschaften beider Pfadtypen und ihre Bedeutung für das Verständnis institutionellen Wandels. Die Flexibilität und Offenheit von Entwicklungspfaden im Vergleich zu den deterministischen Diffusionspfaden werden betont, wobei die "road juncture" als entscheidender Punkt für die Auswahl eines Pfades hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Pfadabhängigkeit, institutionelle Theorie, Arbeitsmarktpolitik, Deutschland, 1992-2005, Bernhard Ebbinghaus, Pfadwechsel, Sozialpolitik, Reformen, Politik-Erblast, institutioneller Wandel, Increasing Returns.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Pfadabhängigkeit in der deutschen Arbeitsmarktpolitik (1992-2005)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Pfadabhängigkeitstheorie auf die deutsche Arbeitsmarktpolitik zwischen 1992 und 2005. Sie analysiert, inwieweit vergangene Entscheidungen zukünftige Entwicklungen beeinflusst haben und unter welchen Bedingungen Pfadwechsel möglich sind.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit basiert auf dem Konzept der Pfadabhängigkeit nach Bernhard Ebbinghaus, welches im Kontext institutioneller Theorien eingeordnet wird. Es werden insbesondere Ebbinghaus' Unterscheidung zwischen Diffusions- und Entwicklungspfaden und die Bedeutung von "road junctures" analysiert.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die deutsche Arbeitsmarktpolitik in den Zeiträumen 1992-1995, 1995-1998, 1998-2002 und 2002-2005. Diese Perioden werden im Detail untersucht, um Pfadabhängigkeiten und -wechsel zu identifizieren.
Welche Aspekte der Pfadabhängigkeit werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten der Pfadabhängigkeit, darunter Definitionen und unterschiedliche theoretische Perspektiven (z.B. Paul Pierson, Christoph Conrad), Bedingungen für Pfadabhängigkeit und Pfadwechsel, sowie die Rolle von Institutionen und „Politikererbe“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Definition und Geschichte der Pfadabhängigkeit, zur Einordnung in institutionelle Theorien, zu verschiedenen Betrachtungsweisen der Theorie, zu Ebbinghaus' Pfadabhängigkeitstheoremen, zu Bedingungen für Pfadabhängigkeit und -wechsel, zur Anwendung auf die deutsche Sozial- und Arbeitsmarktpolitik (mit detaillierter Analyse der genannten Zeiträume) , einer Zusammenfassung und Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pfadabhängigkeit, institutionelle Theorie, Arbeitsmarktpolitik, Deutschland, 1992-2005, Bernhard Ebbinghaus, Pfadwechsel, Sozialpolitik, Reformen, Politik-Erblast, institutioneller Wandel, Increasing Returns.
Wie werden Pfadabhängigkeiten und Pfadwechsel in der Arbeit identifiziert?
Die Arbeit identifiziert Pfadabhängigkeiten und -wechsel durch die Analyse der deutschen Arbeitsmarktpolitik in den definierten Zeiträumen. Dabei wird untersucht, wie vergangene Entscheidungen zukünftige Entwicklungen beeinflusst haben und welche Bedingungen zu Veränderungen geführt haben.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Bedingungen, die zu Pfadabhängigkeit und Pfadwechsel in der deutschen Arbeitsmarktpolitik geführt haben. Die Arbeit untersucht, wie das Konzept der Pfadabhängigkeit das Verständnis der politischen Entwicklungen in diesem Bereich erweitert. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung: Welche Bedingungen führten zu einem Pfadwechsel?" und in den Schlussbetrachtungen detailliert dargestellt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die Pfadabhängigkeit in der Arbeitsmarktpolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426397