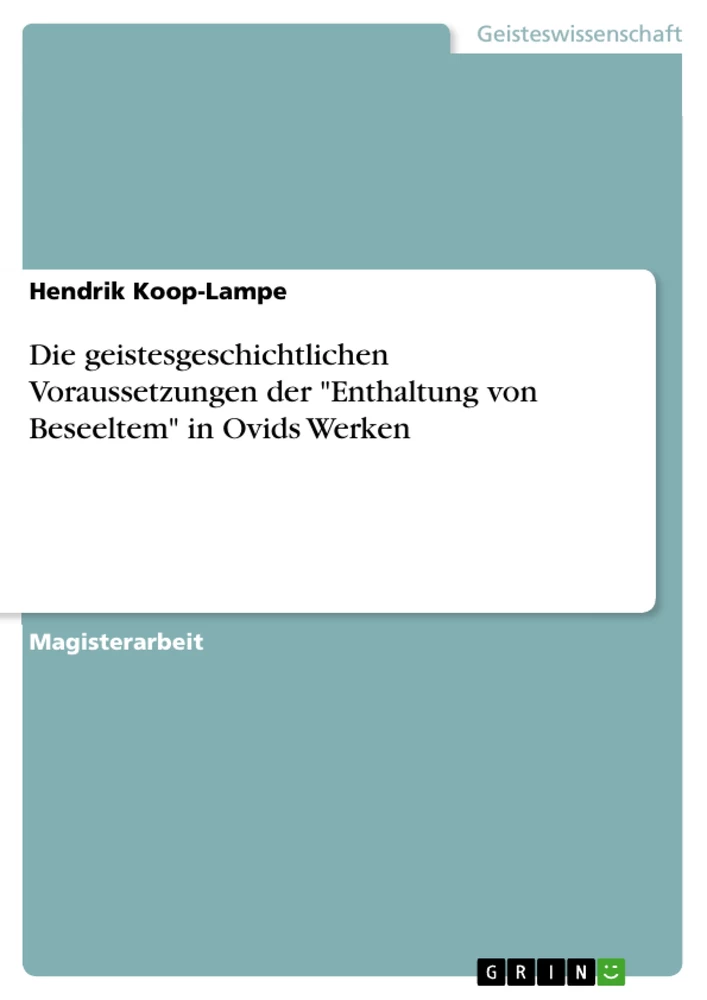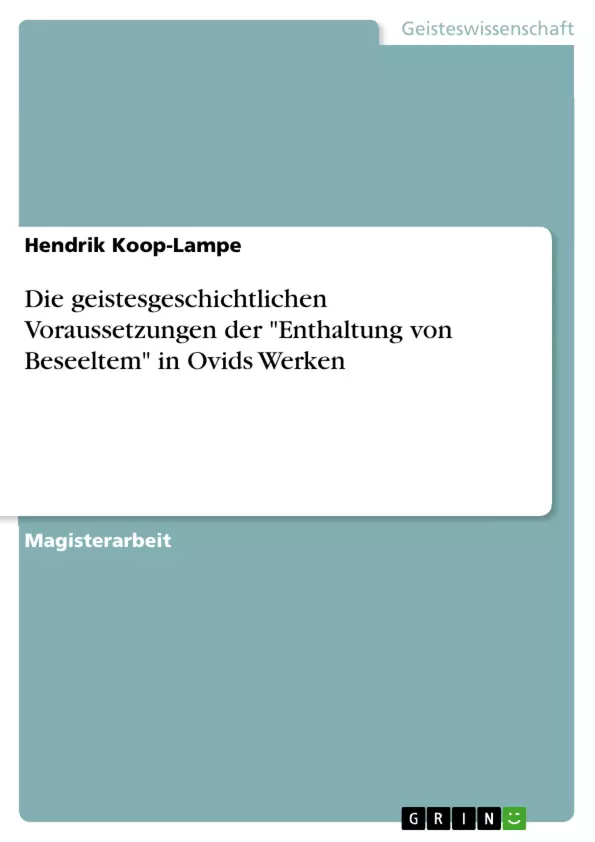Der Begriff „Enthaltung von Beseeltem“ begegnet zum ersten Mal bei Platon, der damit die orphische Lebensweise beschreibt: die damaligen Menschen hätten sich von sogenannten orphischen Lebensmitteln ernährt, indem sie sich alles Beseelten, also der Lebewesen enthielten, mit der Begründung, daß dies eine nach göttlichem Recht unerlaubte Speise sei. Ebenso verwarfen sie blutige Tieropfer und opferten den Göttern etwa Kuchen und Früchte, also unblutige, pflanzliche Opfergaben.
Die orphische Lebensweise scheint also das zu sein, was wir heute als „Vegetarismus“ bezeichnen. Der Begriff „Vegetarier“ wurde allerdings erst im 20. Jahrhundert aus dem älteren „Vegetarianer“ gekürzt, welcher im 19. Jahrhundert wiederum vom englischen „vegetarian“ entlehnt wurde. Zuvor nannte man eine solche Ernährungsweise unter anderem „pythagoreische Diät“. Während der Jahrhunderte zwischen Platons Nomoi und den Werken des Iamblichos und Porphyrios taucht der Begriff allerdings kein einziges Mal auf.
Dennoch muß dies nicht heißen, daß die abstinentia animalium bis dahin in der Literatur nicht thematisiert worden wäre. Die Enthaltung von Fleischverzehr bzw. Tieropfern begegnet bereits schemenhaft bei Hesiod, in indirekten Überlieferungen vom Orphismus und Pythagoreismus, in fragmentarischen Zeugnissen des Empedokles, im Politikos und der Politeia Platons, in Exzerpten des Theophrast und des Dikaiarch, und andeutungsweise bei Aratos, Poseidonios, Lukrez und Vergil, um dann in einem großangelegten Lehrvortrag des Pythagoras im fünfzehnten Buch der Metamorphosen Ovids ausführlich postuliert und mit vielen anderen Komponenten begründet und verknüpft zu werden.
Mit dieser vegetarischen Idee stehen in der gesamten literarischen Tradition eine ganze Reihe weiterer Lehren, Motive, Vorstellungen und Argumente im Zusammenhang, nämlich der sogenannte Weltalter- bzw. Metallmythos und die Erzählungen vom goldenen Geschlecht unter der Herrschaft des Kronos/Saturn, die Seelenwanderungslehre (Metempsychose), die Lehre von der Verwandtschaft der Lebewesen, die Elementenlehre, die vorsokratische Naturphilosophie, die Kulturgeschichte, die Aitiologie und die Kulturentstehungstheorie. Es wird zu untersuchen sein, welche Verbindungen all diese einzelnen Elemente in der Literatur von Hesiod bis Ovid eingegangen sind, wobei den wichtigsten geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für Ovids Behandlung des Themenkomplexes eigene Kapitel gewidmet sind: dem Pythagoreismus, Empedokles und Theophrast.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II.1. Die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen
- II.1.a. Pythagoreismus
- II.1.b. Empedokles
- II.1.c. Theophrast
- II.2. Die Enthaltung von Beseeltem im Werk des Ovid
- II.2.a. Der Geschlechtermythos Ov. met. 1, 89–162
- II.2.b. Die Pythagoras-Rede Ov. met. 15, 75–142
- II.2.c. Die Fasten
- II.2.d. Die Pythagoras-Rede Ov. met. 15, 143–478
- II.1. Die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen
- III. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der "Enthaltung von Beseeltem" (aлoxǹ εµчúxwv) in den Werken des römischen Dichters Ovid und ihren geistesgeschichtlichen Voraussetzungen. Sie untersucht, wie Ovid die vegetarische Lebensweise in seine Werke integriert und welche philosophischen Strömungen ihn dabei beeinflusst haben. Ziel ist es, die Idee der abstinentia animalium in Ovids Werk zu beleuchten und ihren Stellenwert im Kontext der antiken Philosophie und Literatur zu bestimmen.
- Die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen für die Enthaltung von Beseeltem, insbesondere der Pythagoreismus, Empedokles und Theophrast
- Die verschiedenen Aspekte der Enthaltung von Beseeltem im Werk des Ovid, wie z. B. der Geschlechtermythos, die Pythagoras-Rede und die Fasten
- Das Verhältnis von Tieropfern und Fleischkonsum zu vegetarischer Ernährung und unblutigen Opferpraktiken
- Die Bedeutung der "Enthaltung von Beseeltem" im Gesamtkontext der Metamorphosen
- Die literarische Leistung Ovids im Umgang mit der vegetarischen Idee und ihren philosophischen Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung führt den Begriff der "Enthaltung von Beseeltem" ein und beschreibt seine historische Entwicklung von der orphischen Lebensweise bis hin zu den neupythagoreischen Philosophen. Sie stellt dar, dass die vegetarische Lebensweise in der antiken Literatur bereits bei Hesiod, Empedokles und Platon thematisiert wurde.
II. Hauptteil
II.1. Die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen
Dieses Kapitel beleuchtet die philosophischen Grundlagen der "Enthaltung von Beseeltem", indem es den Pythagoreismus, Empedokles und Theophrast als wichtige Vorbilder für Ovids Behandlung dieses Themas untersucht. Es werden die jeweiligen philosophischen Lehren und ihre Bedeutung für die Entwicklung der vegetarischen Lebensweise dargestellt.
II.2. Die Enthaltung von Beseeltem im Werk des Ovid
Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Aspekte der Enthaltung von Beseeltem im Werk des Ovid. Es konzentriert sich auf die folgenden Aspekte: den Geschlechtermythos in den Metamorphosen, die Pythagoras-Rede in den Metamorphosen, die Fasten und die weitere Auseinandersetzung mit der vegetarischen Lebensweise in den Metamorphosen.
III. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung
Dieses Kapitel ist aufgrund der Vermeidung von Spoilern nicht Teil dieser Vorschau.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Enthaltung von Beseeltem, àлoxò ¿µчþúxwv, abstinentia animalium, Pythagoreismus, Empedokles, Theophrast, Ovid, Metamorphosen, Fasten, vegetarische Lebensweise, Geschlechtermythos, Tieropfer, Fleischkonsum, unblutige Opfer, Seelenwanderung.
- Citar trabajo
- Hendrik Koop-Lampe (Autor), 2014, Die geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der "Enthaltung von Beseeltem" in Ovids Werken, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426401