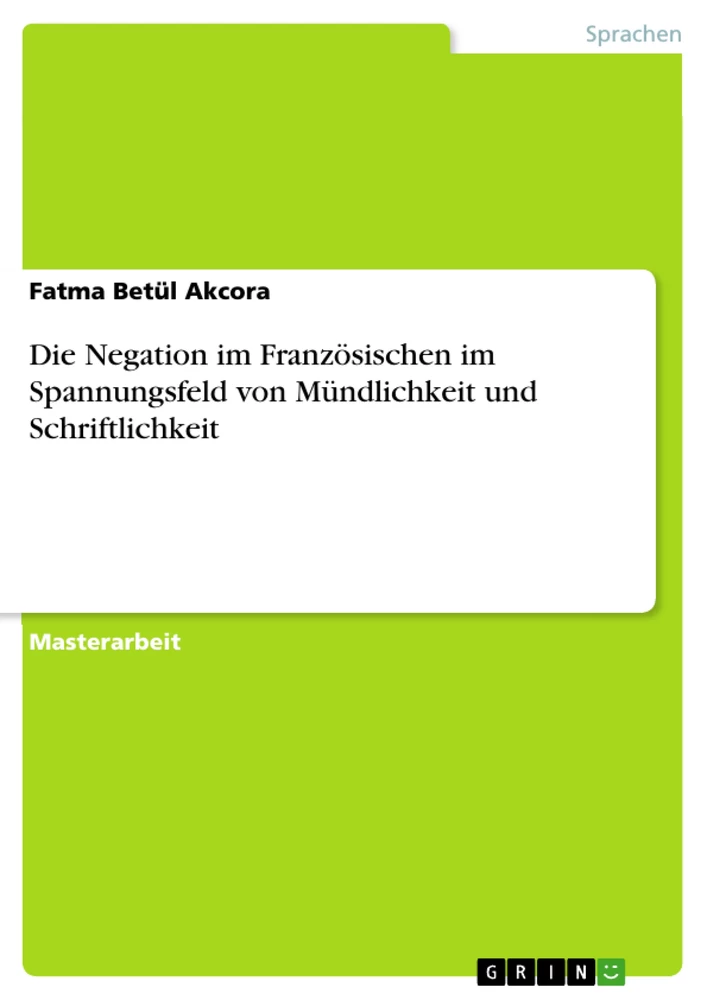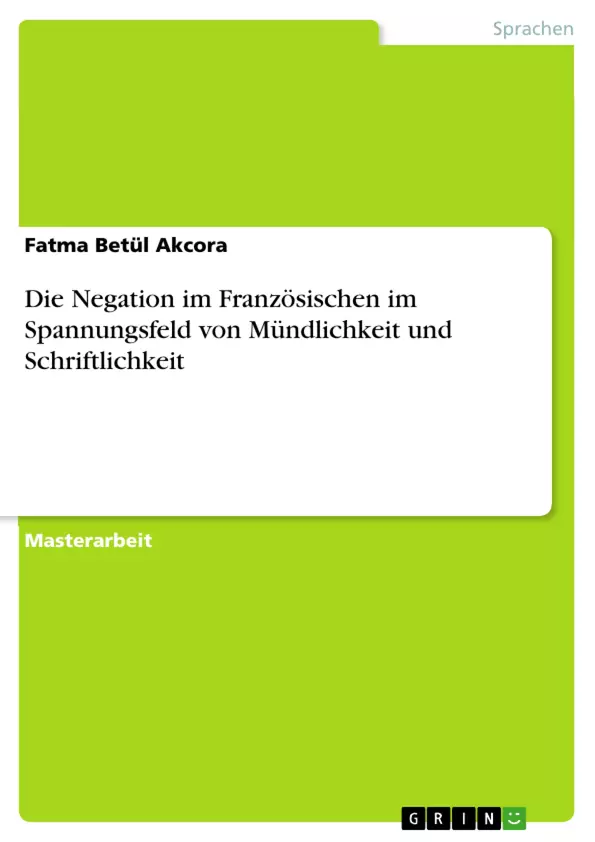Sprachen sind nicht statisch, sondern verändern sich ganz im Gegenteil mit der Zeit in wechselndem Tempo und in unterschiedlichem Ausmaß. Für den Wandel sind verschiedene Faktoren verantwortlich, die in zwei Gruppen unterteilt werden können: Faktoren der inneren und der äußeren Sprachgeschichte. Zu den ersteren zählen funktionale Schwächen des Systems, die bei den Sprechern den Wunsch erwecken, diese zu optimieren, das Ökonomieprinzip (Prinzip des geringsten Aufwands) sowie das Phänomen der Reanalyse. Unter der äußeren Sprachgeschichte werden geographische, soziale, kulturelle und politische Dimensionen einer Sprache subsummiert. Sie wird nicht nur durch die historischen Ereignisse, sondern auch durch Sprachkontakte sowie sprachpolitische Maßnahmen geprägt. Bei genauerem Betrachten der Entwicklung des Französischen kann festgestellt werden, dass sich seine Sprachgeschichte über mehrere Jahrhunderte streckt und es einen immensen Sprachwandel vorweisen kann. Um eine grobe Vorstellung über die Entwicklung der französischen Sprache zu gewinnen empfiehlt es sich, einen Blick auf seine Periodisierung zu werfen.
Um grundlegende Informationen zu vermitteln, erfolgt zu Beginn eine Erläuterung des Begriffs „Varietätenlinguistik“ und eine Veranschaulichung der unterschiedlichen Varietäten. Daraufhin werden die Begriffe „gesprochene“ und „geschriebene Sprache“ definiert, ihre Charakteristika konkretisiert und die
markantesten Unterschiede zwischen diesen beiden im Französischen kurz vorgestellt. Der Hauptteil dieser Arbeit widmet sich der voneinander abweichenden Negationsbildung in der französischen gesprochenen und geschriebenen Sprache. Hierfür wird die Entstehung der Verneinung im Französischen erläutert, ihre Entwicklung vom Lateinischen bis ins Neufranzösische dargestellt sowie auf den Jespersen-Zyklus eingegangen. Des Weiteren werden die inner- und außersprachlichen Faktoren, die einen Einfluss auf den Schwund der Partikel ne in der gesprochenen Sprache ausüben, ausgearbeitet. Den letzten Teil bildet eine Korpusanalyse, die ermöglichen soll, auf die Fragen zu antworten, ob und wenn ja welche Faktoren den Ausfall von ne herbeiführen, wann diese Partikel beibehalten wird und inwiefern das Alter, die Herkunft, das Geschlecht etc. des Sprechers eine Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Dimensionen der heutigen Varietätenlinguistik
- 2.1 Das Diasystem der Sprache nach Coseriu
- 2.2 Gesprochene und geschriebene Sprache
- 3. Unterschiede zwischen français parlé und français écrit
- 3.1 Die Gliederungssignale
- 3.2 Der Gebrauch der unbetonten Subjektpersonalpronomina
- 3.3 Die Interrogation
- 3.4 Die Angleichung des Partizips
- 3.5 Das Tempussystem
- 4. Die historische Entwicklung der Negation im Französischen
- 4.1 Die Negation im Lateinischen
- 4.2 Die Negation im Alt- und Mittelfranzösischen
- 4.3 Die Negation im Neufranzösischen
- 5. Der Jespersen-Zyklus
- 6. Einflussfaktoren für den Ausfall von ne
- 6.1 Innersprachliche Einflüsse
- 6.2 Außersprachliche Einflüsse
- 7. Das Korpus
- 7.1 Begründung für die Wahl
- 7.2 Darstellung des Korpus
- 8. Analyse des Korpus
- 8.1 Außersprachliche Kriterien
- 8.2 Innersprachliche Kriterien
- 8.3 Weitere Negationsformen
- 9. Interpretation der Ergebnisse
- 10. Ist ±ne das Ergebnis einer potentiellen Diglossiesituation im Französischen?
- 11. Die Expansion von ±ne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Negation im Französischen und ihren Wandel im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ziel ist es, die Entwicklung der Negation im Laufe der französischen Sprachgeschichte zu analysieren und die Einflussfaktoren – sowohl innersprachlicher als auch außersprachlicher Natur – zu identifizieren und zu bewerten.
- Entwicklung der Negation im Französischen über verschiedene Sprachperioden
- Einfluss von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf die Negationsformen
- Analyse der innersprachlichen Faktoren (z.B. Grammatik, Syntax)
- Analyse der außersprachlichen Faktoren (z.B. soziale, regionale Einflüsse)
- Der Jespersen-Zyklus im Kontext der französischen Negation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung zitiert Victor Hugo, um die Dynamik und den ständigen Wandel von Sprachen zu betonen. Sie führt in die Thematik der Sprachentwicklung ein, differenziert zwischen innerer und äußerer Sprachgeschichte und liefert eine kurze Übersicht über die Periodisierung des Französischen (Altfranzösisch, Mittelfranzösisch, Neufranzösisch), wobei die jeweiligen zeitlichen Eingrenzungen und kennzeichnende Merkmale skizziert werden. Der Fokus liegt auf der Nicht-Statik von Sprachen und der Notwendigkeit, deren Wandel zu untersuchen.
2. Die Dimensionen der heutigen Varietätenlinguistik: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Dimensionen der Varietätenlinguistik nach Coseriu (diatopisch, diastratisch, diaphasisch), um ein theoretisches Fundament für die Analyse der Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache zu legen. Es dient als methodische Grundlage für die spätere Untersuchung der Negation in unterschiedlichen Kontexten.
3. Unterschiede zwischen français parlé und français écrit: Dieses Kapitel beleuchtet die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache im Französischen, indem es spezifische Merkmale wie Gliederungssignale, den Gebrauch unbetonter Pronomen, Interrogationsformen, Partizip-Angleichungen und das Tempussystem vergleicht. Diese Gegenüberstellung bildet die Grundlage für das Verständnis der Variationen in der Negationsbildung.
4. Die historische Entwicklung der Negation im Französischen: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung der Negation vom Lateinischen über das Alt- und Mittelfranzösische bis ins Neufranzösische. Es beschreibt die Veränderungen der Negationsstrukturen und -partikeln im Laufe der Zeit, legenden den Weg für eine tiefere Analyse der gegenwärtigen Verwendung der Negation.
5. Der Jespersen-Zyklus: Dieses Kapitel erklärt den Jespersen-Zyklus als ein linguistisches Phänomen, das die Entwicklung von Negationsstrukturen beschreibt, und analysiert seine Relevanz für die Entwicklung der französischen Negation. Der Fokus liegt auf der Beschreibung dieses sprachlichen Prozesses und seiner Anwendung auf das Französische.
6. Einflussfaktoren für den Ausfall von „ne“: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die zum Ausfall der Negationspartikel „ne“ im Französischen geführt haben. Es unterscheidet zwischen innersprachlichen (grammatikalische Strukturen, Sprachökonomie) und außersprachlichen (soziale, regionale Faktoren) Einflüssen und beleuchtet deren Interaktion. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung des Phänomens des „ne“-Ausfalls.
7. Das Korpus: Dieses Kapitel beschreibt das für die Studie verwendete Korpus, begründet dessen Auswahl und präsentiert dessen Eigenschaften. Es legt die methodische Grundlage für die Analyse im folgenden Kapitel dar.
8. Analyse des Korpus: Dieses Kapitel analysiert das Korpus, indem es sowohl außersprachliche (Alter, Geschlecht, kommunikative Situation) als auch innersprachliche (Pronomen, Tempus, Satztyp, Dislokation, Negation von Infinitiven) Faktoren untersucht, um deren Einfluss auf die Verwendung der Negation zu bestimmen. Das Kapitel liefert detaillierte Ergebnisse der Korpusanalyse und Zwischenzusammenfassungen zu den einzelnen Einflussfaktoren.
Schlüsselwörter
Negation, Französisch, Varietätenlinguistik, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprachwandel, Jespersen-Zyklus, Korpusanalyse, innersprachliche Faktoren, außersprachliche Faktoren, französische Sprachgeschichte, „ne“-Ausfall.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Die Negation im Französischen
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Entwicklung und den Wandel der Negation im Französischen, insbesondere den Einfluss von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf die Negationsformen. Der Fokus liegt auf der Analyse der innersprachlichen und außersprachlichen Faktoren, die diesen Wandel beeinflussen.
Welche Aspekte der Negation werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Negation vom Lateinischen über das Alt- und Mittelfranzösische bis ins Neufranzösische. Sie analysiert den Jespersen-Zyklus im Kontext der französischen Negation und untersucht die Faktoren, die zum Ausfall der Negationspartikel „ne“ geführt haben (innersprachliche und außersprachliche Einflüsse). Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich zwischen gesprochener (français parlé) und geschriebener (français écrit) Sprache.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine korpusbasierte Methode. Es wird ein spezifisches Korpus analysiert, wobei sowohl außersprachliche Kriterien (Alter, Geschlecht, kommunikative Situation) als auch innersprachliche Kriterien (Pronomen, Tempus, Satztyp etc.) berücksichtigt werden. Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen der Varietätenlinguistik, insbesondere Coserius Modell des Diasystems.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Korpusanalyse, die den Einfluss der untersuchten Faktoren auf die Verwendung der Negation aufzeigen. Die Interpretation der Ergebnisse soll klären, ob der Wandel der Negation im Französischen als Ergebnis einer potentiellen Diglossiesituation verstanden werden kann, und beleuchtet die Expansion von „±ne“.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in elf Kapitel: Einleitung, Dimensionen der Varietätenlinguistik, Unterschiede zwischen français parlé und français écrit, historische Entwicklung der Negation im Französischen, der Jespersen-Zyklus, Einflussfaktoren für den Ausfall von „ne“, Beschreibung des Korpus, Analyse des Korpus, Interpretation der Ergebnisse, Diglossiesituation im Französischen und die Expansion von „±ne“.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Negation, Französisch, Varietätenlinguistik, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprachwandel, Jespersen-Zyklus, Korpusanalyse, innersprachliche Faktoren, außersprachliche Faktoren, französische Sprachgeschichte, „ne“-Ausfall.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Negation im Französischen zu analysieren und die Einflussfaktoren – sowohl innersprachlicher als auch außersprachlicher Natur – zu identifizieren und zu bewerten. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Negation und dem Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
- Arbeit zitieren
- M.o.A. Fatma Betül Akcora (Autor:in), 2017, Die Negation im Französischen im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426476