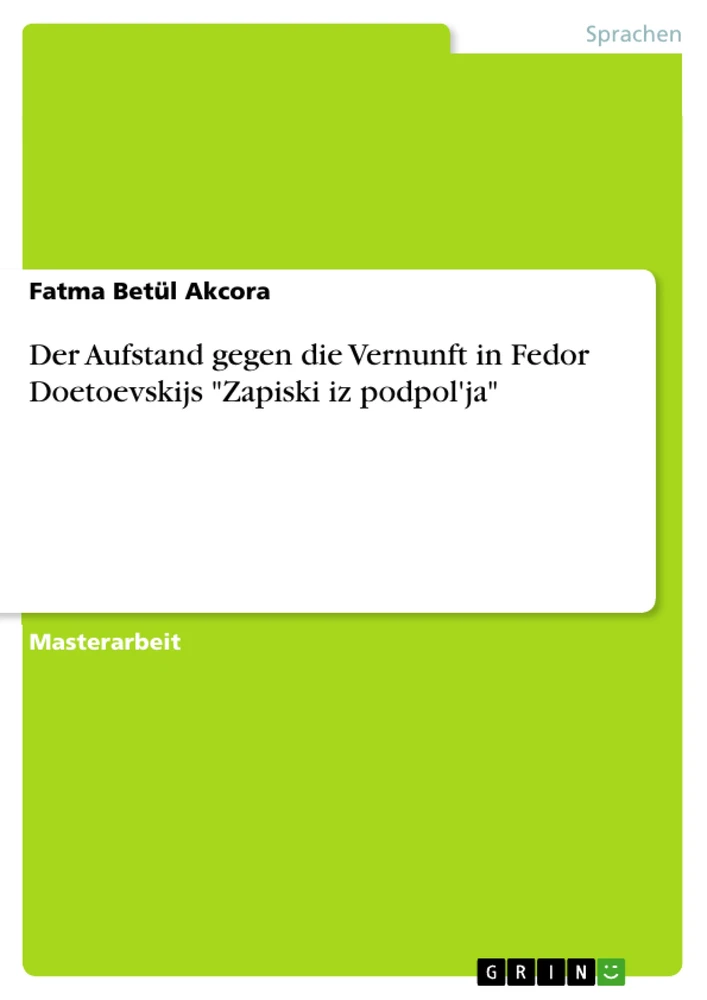Zweifellos verfügt jeder Schriftsteller über eine charakteristische Note, die es ihm ermöglicht, sich von allen anderen Autoren zu unterscheiden und zu profilieren. Aus diesem Grund sollte damit ein möglichst richtiges Lesen sowie Verstehen eines Werks gewährleistet werden kann, auf die persönlichen Besonderheiten des jeweiligen Verfassers geachtet werden. So offeriert sich in Bezug auf den russischen Schriftsteller Dostoevskij und seine literarischen Schöpfungen in der Regel das Stichwort „philosophischer Roman“, zumal er in seinen Schriften nicht nur soziale und religiöse, sondern auch psychologische Probleme auf einer philosophischen Ebene behandelt. Mit den Arbeiten Dostoevskijs setzen sich Menschen unterschiedlicher Gebiete auseinander und sie faszinieren Autoren, Kritiker sowie Leser zu allen Zeiten.
Die oben erwähnten Sätze schrieb der zu jener Zeit achtzehnjährige Dostoevskij in einem Brief vom 16. August 1839 an seinen Bruder und sowohl sein Leben als auch seine einzigartigen Werke lassen erkennen, dass er diesem Motto stets gefolgt ist. Seine Anschauungen sowie Erkenntnisse über den Menschen, die Religion, die Politik etc. konkretisierte er, indem er sie dank seiner Romane in Gestalten, Geschehnisse und Symbole umsetzte. Dieses Vorgehen tritt auch in seinem Kurzroman Zapiski iz podpol'ja zum Vorschein, der in jeglicher Hinsicht ein Meisterstück darstellt: Von dem Inhalt, über die Darstellungsform, bis hin zu den Charakterzügen und zur Weltanschauung des Protagonisten repräsentiert der Roman ein überaus scharfsinniges sowie zynisches Werk, das seinesgleichen sucht. Insbesondere die Auseinandersetzung des Ich-Erzählers mit der Ratio, der Gesellschaft und den Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts stellt eine höchst umstrittene Problematik dar, die insgeheim das Interesse vieler Wissenschaftler bzw. Menschen unterschiedlicher Bereiche weckte. Obwohl die Themen, die sich im Werk herauskristallisieren, immer wieder unter verschiedenen Aspekten gedeutet wurden, bleibt dennoch viel Raum für Interpretation.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Hintergrund
- 2.1 Das Russische Zarenreich gegen Ende des 18. Jahrhunderts
- 2.2 Das Russische Zarenreich im 19. Jahrhundert
- 3. Biographie von Fëdor Michajlovič Dostoevskij
- 4. Dostoevskij und der Realismus
- 5. Zapiski iz podpol'ja
- 5.1 Inhaltsangabe
- 5.2 Die Darstellungsform des Romans
- 5.3 Der Kellerlochmensch
- 5.3.1 Wer ist der Kellerlochmensch?
- 5.3.2 Charakterisierung des Kellerlochmenschen
- 5.4 Der Protagonist und sein Menschenbild
- 5.5 Sankt Petersburg als Schauplatz
- 5.6 Zur Entstehungsgeschichte des Romans
- 6. Der Nihilismus
- 6.1 Ursprung und Definition
- 6.2 Der Nihilismus in der russischen Literatur
- 7. Der Aufstand gegen die Vernunft in Zapiski iz podpol'ja
- 7.1 Das Kellerloch
- 7.2 Das Duell
- 7.3 Der Kellerlochmensch und Liza
- 7.4 Der Kristallpalast
- 7.5 Die Arithmetik
- 7.6 Der Ameisenhaufen
- 8. Dostoevskij als Psychologe
- 9. Dostoevskij und der Kellerlochmensch
- 10. Son smešnogo čeloveka
- 10.1 Inhaltsangabe
- 10.2 Charakterisierung des Ich-Erzählers
- 10.3 Die Utopie nach Dostoevskij
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Aufstand gegen die Vernunft im Dostoevskij-Roman "Zapiski iz podpol'ja". Ziel ist es, die Gründe für die Ablehnung der Vernunft durch den Ich-Erzähler zu untersuchen und zu verstehen, wie diese Rebellion sich manifestiert und wohin sie führt. Die Arbeit analysiert die Psychologie des Protagonisten und sein Weltbild, wobei der Fokus auf die zentralen Themen des Romans liegt, darunter:
- Die Kritik an der Rationalität und der modernen Gesellschaft
- Die Rolle des Nihilismus im Werk
- Die Suche nach Sinn und Identität in einer zunehmend rationalisierten Welt
- Die Darstellung des Menschen als komplexes, widersprüchliches Wesen
- Die Ambivalenz der menschlichen Existenz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Kontext des Romans, wobei das Russische Zarenreich im 18. und 19. Jahrhundert sowie die Biografie von Dostoevskij beleuchtet werden. Anschließend wird der Realismus als literarische Epoche und die spezifische Darstellungsform des Romans "Zapiski iz podpol'ja" untersucht. Die Kapitel beschäftigen sich dann mit dem Protagonisten, seinem Weltbild und seinem Aufstand gegen die Vernunft. Hierbei werden insbesondere das Kellerloch, das Duell und der Kristallpalast als zentrale Elemente des Romans analysiert. Die Arbeit endet mit einem Blick auf Dostoevskij als Psychologen und einer Auseinandersetzung mit seiner Utopievorstellung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet den Aufstand gegen die Vernunft in Dostoevskijs "Zapiski iz podpol'ja" und fokussiert auf die Psychologie des Protagonisten, die Kritik an der Rationalität, den Nihilismus, die Suche nach Sinn und die Ambivalenz der menschlichen Existenz. Der Roman fungiert als Spiegelbild der sozialen und philosophischen Konflikte des 19. Jahrhunderts und wird als psychologisches Porträt eines Mannes gedeutet, der sich gegen die gesellschaftlichen Normen und die dominierende Rationalität auflehnt. Die Arbeit analysiert die komplexen inneren Konflikte des Protagonisten, die Suche nach Freiheit und die Frage nach dem Sinn des Lebens in einer Welt, die zunehmend von rationalen Prinzipien beherrscht wird.
- Quote paper
- M.o.A. Fatma Betül Akcora (Author), 2018, Der Aufstand gegen die Vernunft in Fedor Doetoevskijs "Zapiski iz podpol'ja", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426477