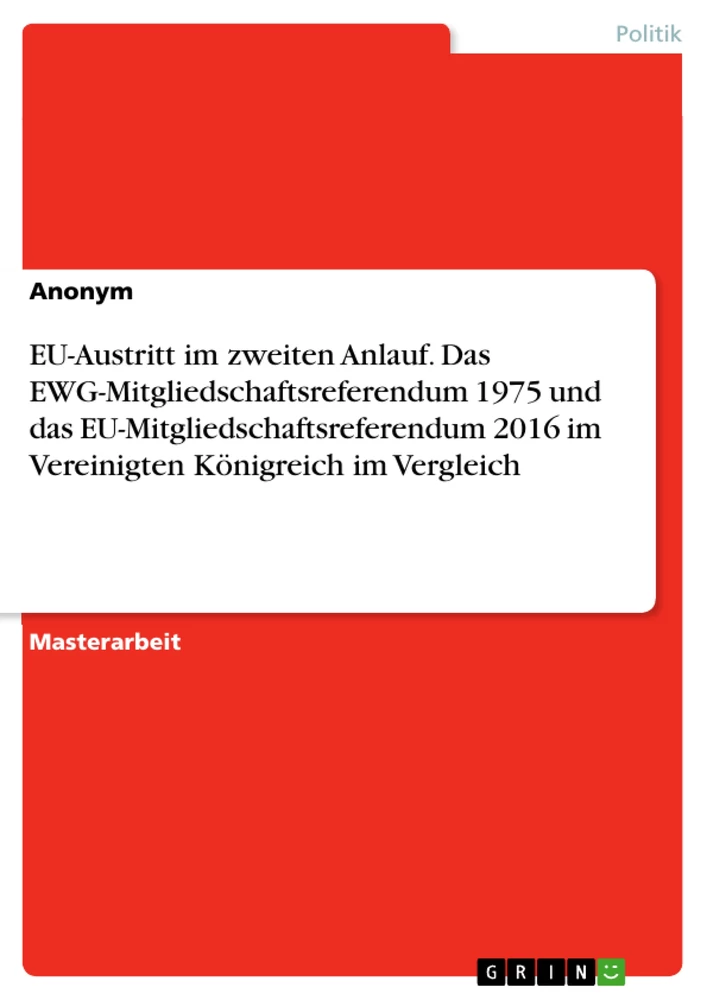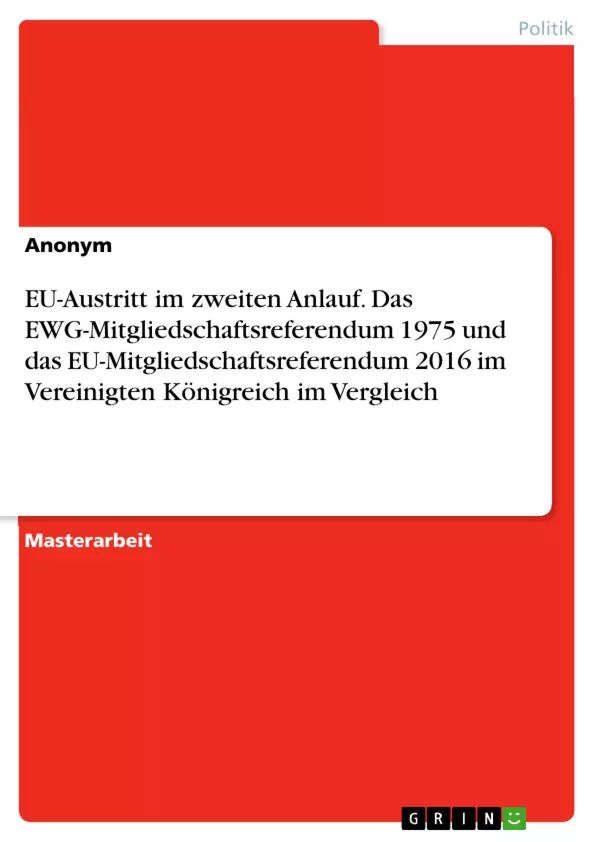Obwohl seit dem Mitgliedschaftsreferendum im Jahr 2016 viele Überlegungen angestellt wurden, um das lange Zeit für undenkbar gehaltene Ergebnis, das zu einem Austritt Großbritanniens aus der EU führen wird, zu deuten, hat dies nichts an der geringen Kenntnis und der öffentlichen Gleichgültigkeit für die Geschichte der europäischen Integration verändert. Denn auch wenn der EU-Austritt Großbritanniens in vielen Analysen einerseits in den Zusammenhang mit der britischen Geschichte und andererseits mit der Gegenwart gebracht wird, und eine Vielzahl von Forschern die Gründe für das Resultat im britischen Nationalcharakter sucht und etwa Beispiele für einen tief verwurzelten Sonderweg in Kultur und Geschichte heranzieht, wird er nur sehr undifferenziert im Lichte der Geschichte der europäischen Integration gesehen. Zu diesen undifferenzierten Betrachtungen passt, dass gemeinhin übersehen wird, dass die Briten am 23. Juni 2016 nicht zum ersten Mal über den Verbleib in der EU abstimmen durften. Schon im Juni 1975 kam es im Vereinigten Königreich zu einem Referendum über die Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften (EG), in dem sich noch mehr als zwei Drittel der Wähler für einen Verbleib aussprachen.
Wie konnte es jedoch zu diesen zwei unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Und was sind die weiteren Unterschiede und was die Gemeinsamkeiten der beiden Referenden? Ein direkter Vergleich gibt Aufschluss darüber. Aufgrund der oben genannten Gründe ist es folgerichtig, dabei die grundsätzlichen Probleme Großbritanniens mit der europäischen Integration zu untersuchen und den langfristigen Ursachen der nationalhistorischen Spezifika eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu wirft der Autor bei seinem Vergleich nicht nur einen Blick auf die Referenden an sich, sondern auch auf die politischen Begleitumstände, während welcher sie abgehalten wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen und Methodik
- Theoretische Grundlage: EU-Skepsis
- Vergleichende Methode
- Vorgeschichte I.
- EWG-Mitgliedschaftsreferendum 1975
- Reformverhandlungen
- Rechtsgrundlagen
- Rahmenbedingungen
- Kampagnen
- Ergebnisse
- Vorgeschichte II.
- EU-Mitgliedschaftsreferendum 2016
- Reformverhandlungen
- Rechtsgrundlagen
- Rahmenbedingungen
- Kampagnen
- Ergebnisse
- Vergleich des EWG-Mitgliedschaftsreferendums 1975 und des EU-Mitgliedschaftsreferendums 2016
- Gemeinsamkeiten
- Unterschiede
- Diskussion und Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert das EWG-Mitgliedschaftsreferendum von 1975 und das EU-Mitgliedschaftsreferendum von 2016 im Vereinigten Königreich im Vergleich. Die Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Referenden und analysiert die Faktoren, die zu den jeweiligen Ergebnissen führten. Darüber hinaus werden die politischen Begleitumstände der Referenden betrachtet.
- Die Geschichte der britischen EU-Skepsis
- Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Referenden
- Die Rolle der Medien und der Kampagnen
- Der Einfluss der nationalen Identität auf die Entscheidung der Wähler
- Die Bedeutung der europäischen Integration für Großbritannien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Das zweite Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen und die Methodik der Arbeit. Die Kapitel 3 und 5 behandeln die Vorgeschichte der beiden Referenden. Die Kapitel 4 und 6 befassen sich mit den beiden Referenden selbst, einschließlich der Reformverhandlungen, Rechtsgrundlagen, Rahmenbedingungen, Kampagnen und Ergebnisse. Kapitel 7 analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Referenden. Die Arbeit endet mit einer Diskussion und einem Fazit.
Schlüsselwörter
EU-Austritt, EWG-Mitgliedschaftsreferendum, EU-Mitgliedschaftsreferendum, Vereinigtes Königreich, Referendum, EU-Skepsis, europäische Integration, nationale Identität, politische Rahmenbedingungen, Medien, Kampagnen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, EU-Austritt im zweiten Anlauf. Das EWG-Mitgliedschaftsreferendum 1975 und das EU-Mitgliedschaftsreferendum 2016 im Vereinigten Königreich im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426485