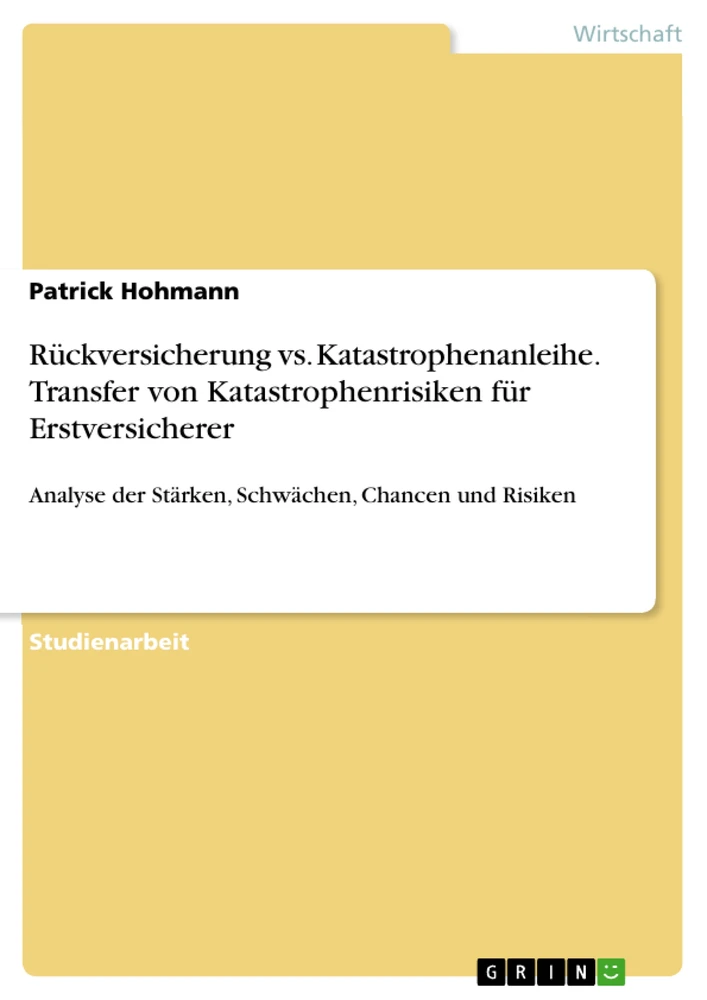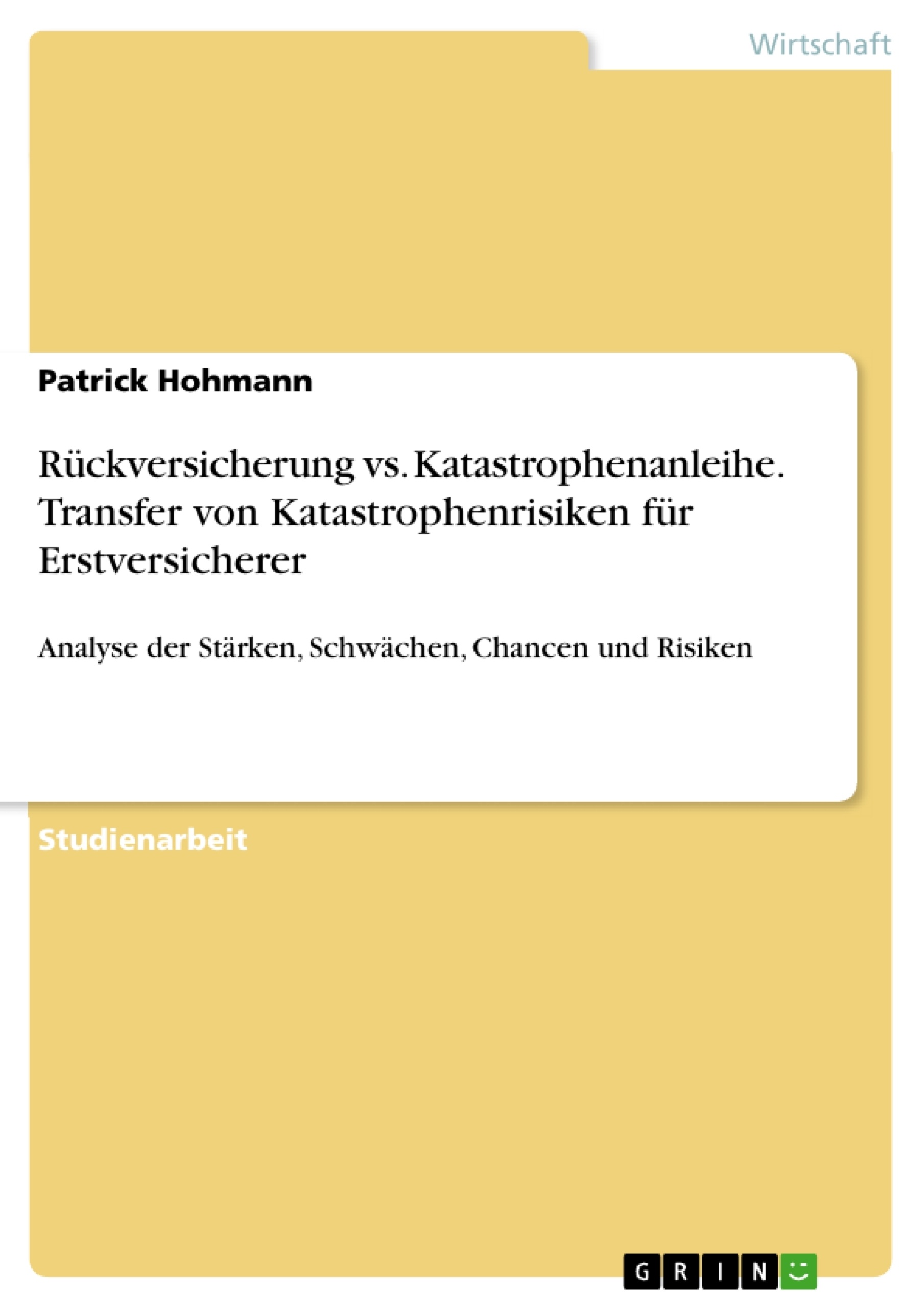Sind Versicherer im Falle eines Großereignisses zahlungsfähig? Soll das Risiko auf den Kapitalmarkt übertragen oder eine klassische Rückversicherung abgeschlossen werden? Vor diesem Hintergrund beleuchtet diese Arbeit in den folgenden beiden Kapiteln zum einen die Entwicklung und die Auswirkungen von Katastrophenereignissen auf die Versicherungsbranche sowie zum anderen die klassische und die alternative Methode für den Transfer von Katastrophenrisiken.
Es soll durch eine SWOT-Analyse der beiden Methoden sowie durch eine Gegenüberstellung der Erkenntnisse deduktiv die Frage geklärt werden, ob eine der beiden Varianten für einen Erstversicherer vorteilhafter ist oder ob die Entscheidung für welche Variante dieser sich entscheidet indifferent ist und von welchen Faktoren dies abhängig ist.
Die Veränderung des Klimas auf der Erde ist eines der Themen des 21. Jahrhunderts. Der Klimawandel schreitet immer weiter voran und die entstandenen Schäden durch Katastrophenereignisse steigen ebenfalls kontinuierlich. Das Wetter ist somit nicht nur ein Umweltthema. Es ist auch ein signifikanter Faktor, der die Weltwirtschaft direkt oder indirekt beeinflusst. Zugleich entstand in der Versicherungsbranche eine Diskussion über die Kapitalbasis von Versicherungsunternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Katastrophen
- 2.1 Katastrophenereignisse und deren Entwicklung
- 2.2 Auswirkungen auf die Versicherungsbranche
- 3 Klassischer Risikotransfer mittels Rückversicherung
- 3.1 Grundlagen und Modelle der Rückversicherung
- 3.2 Atomisierung von Risiken durch Rückversicherung
- 4 Alternativer Risikotransfer mittels Katastrophenanleihen
- 4.1 Grundlagen von Katastrophenanleihen
- 4.2 Anleihespezifische Merkmale
- 4.3 Trigger-Events und Bewertung von Katastrophenanleihen
- 5 Analyse von Rückversicherung und Katastrophenanleihe
- 5.1 SWOT-Analyse zur Rückversicherung
- 5.2 SWOT-Analyse zu Katastrophenanleihen
- 5.3 Vergleich zwischen Rückversicherung und Katastrophenanleihe
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Rückversicherung und der Katastrophenanleihe als alternative Methoden zum Transfer von Katastrophenrisiken für Erstversicherer. Ziel ist es, die Vor- und Nachteile beider Ansätze zu vergleichen und herauszufinden, welche Variante für Erstversicherer vorteilhafter ist oder ob die Entscheidung indifferent ist und von welchen Faktoren sie abhängt.
- Entwicklung und Auswirkungen von Katastrophenereignissen auf die Versicherungsbranche
- Grundlagen und Modelle der klassischen Rückversicherung
- Funktionsprinzipien und spezifische Merkmale von Katastrophenanleihen
- SWOT-Analyse der beiden Risikotransfermethoden
- Vergleich der Rückversicherung und der Katastrophenanleihe anhand der SWOT-Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Klimawandels im 21. Jahrhundert und seine Auswirkungen auf die Versicherungsbranche. Es wird diskutiert, ob Versicherer im Falle eines Großereignisses zahlungsfähig sind und welche Möglichkeiten zur Risikoverlagerung bestehen. Kapitel 2 analysiert die Entwicklung von Katastrophenereignissen und deren Auswirkungen auf die Versicherungsbranche. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Grundlagen und Modellen der klassischen Rückversicherung, wobei die Atomisierung von Risiken durch Rückversicherung im Vordergrund steht. In Kapitel 4 werden die Grundlagen von Katastrophenanleihen, anleihespezifische Merkmale und Trigger-Events sowie die Bewertung dieser Finanzinstrumente erläutert.
Schlüsselwörter
Katastrophenrisiko, Rückversicherung, Katastrophenanleihe, Risikotransfer, Erstversicherer, SWOT-Analyse, Klimawandel, Versicherungsbranche, Finanzmarkt, Kapitalmarkt
- Arbeit zitieren
- Patrick Hohmann (Autor:in), 2018, Rückversicherung vs. Katastrophenanleihe. Transfer von Katastrophenrisiken für Erstversicherer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426593