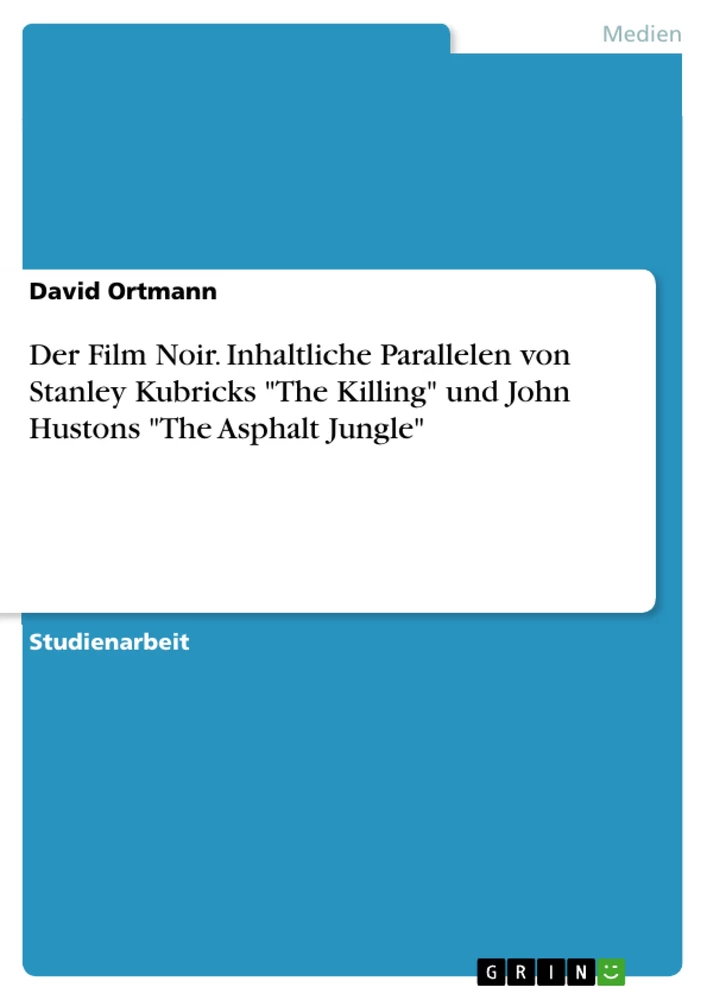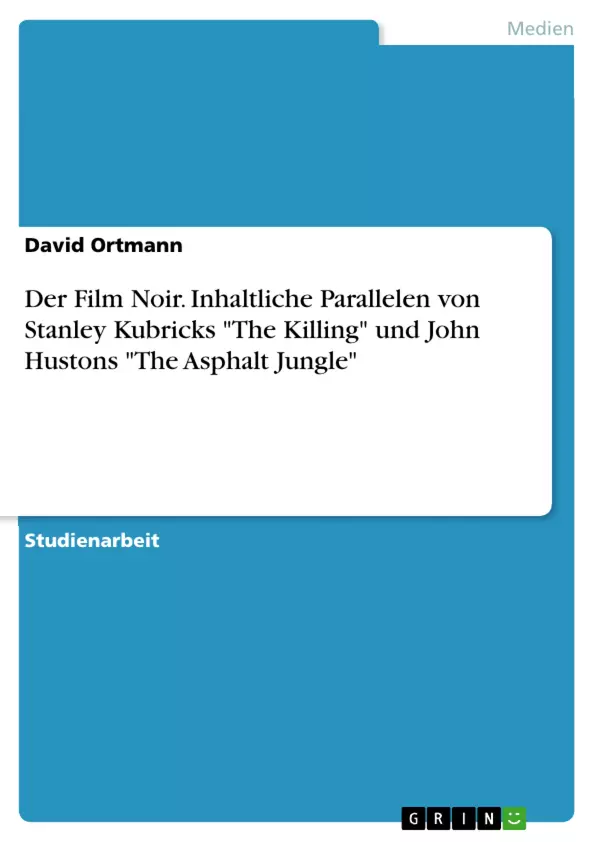"The Killing" aus dem Jahr 1956, ist nach vorherrschender Kritikermeinung der erste wichtige Film Kubricks. Der Film reiht sich ein in eine Folge von Filmen, denen das Thema vom letzten großen Einbruch gemeinsam ist. Einer dieser früheren Filme ist "The Asphalt Jungle" von John Huston aus dem Jahre 1950. Georg Seeßlen sagt zur Modellfunktion dieses Films: "Nach dem Vorbild von "The Asphalt Jungle", doch zumeist ohne dessen allegorische Implikationen, schildern mehrere Filme der Folgezeit die Planung und Durchführung eines Raubes oder Überfalls mit dem letzendlichen Scheitern des Coups", und er nennt unter anderen Kubricks Film, ohne weiter auf ihn einzugehen.
In dieser Arbeit soll nun eine Interpretation Kubricks Film durch einen Vergleich mit seinem Vorläuferfilm versucht werden, zumal Kubrick geradezu zu einem Vergleich mit dem nur sechs Jahre früher entstandenen Film seines Landsmannes einlädt, da er als Haupthelden ebenfalls Sterling Hayden einsetzt und so deutlich macht, dass es sich bei den Parallelen in beiden Werken keineswegs um eine zufällige Ähnlichkeit handelt, sondern um eine kreative Auseinandersetzung mit John Hustons Film. Um herauszufinden, was Kubrick übernimmt, vor allem aber, was er anders macht, soll die Analyse auf zwei Ebenen durchgeführt werden. In einem ersten Schritt sollen auf der Makroebene Vergleiche angestellt werden, die sich auf die Grobstruktur der beiden Filme beziehen. Nachdem diese erschlossen ist, soll anhand des Vergleichs einzelner Sequenzen ins Detail gegangen werden, um dann in einem letzten Schritt die Frage nach der Intention Kubricks zu beantworten und den Film auch hinsichtlich des Film noir – Genres einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Vorgehensweise
- Vergleich auf der Makroebene
- Motive
- Figuren
- Figurenkonstellation in The Asphalt Jungle
- Figurenkonstellation in The Killing
- Zur Erzählstruktur
- Zum Stil
- Vergleich auf der Mikroebene
- Vergleich der Expositionen
- Exposition - The Asphalt Jungle
- Vorspann The Killing
- Vergleich der Planungssequenz
- Vergleich der Schlusssequenzen
- The Asphalt Jungle
- The Killing
- „The Killing“ Versuch einer Einordnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht Stanley Kubricks Film „The Killing“ aus dem Jahr 1956 im Vergleich mit John Hustons „The Asphalt Jungle“ von 1950. Die Arbeit analysiert die beiden Filme auf der Makro- und Mikroebene, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu identifizieren. Sie will herausarbeiten, welche Elemente Kubrick aus dem Vorläuferfilm übernimmt und welche er anders gestaltet. Die Arbeit soll darüber hinaus Kubricks Intentionen und die Einordnung des Films innerhalb des Film noir - Genres beleuchten.
- Der Vergleich von „The Killing“ und „The Asphalt Jungle“ auf der Makro- und Mikroebene
- Die Analyse der Figurenkonstellation und ihrer Charakterisierung
- Die Untersuchung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in Bezug auf die Erzählstruktur und den Stil der beiden Filme
- Die Einordnung von „The Killing“ innerhalb des Film noir - Genres
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Filme vor und beschreibt die Vorgehensweise der Arbeit. Kapitel 2 widmet sich dem Vergleich der beiden Filme auf der Makroebene. Es werden die Motive, die Figurenkonstellation und die Erzählstruktur der beiden Filme untersucht. In Kapitel 3 erfolgt der Vergleich der Expositionen, der Planungssequenz und der Schlusssequenzen der beiden Filme. Kapitel 4 setzt sich mit der Intention Kubricks und der Einordnung von „The Killing“ innerhalb des Film noir - Genres auseinander.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Film noir, Gangsterfilm, Figurenkonstellation, Erzählstruktur, Stilvergleich, Stanley Kubrick, John Huston, „The Killing“, „The Asphalt Jungle“, Thematische Parallelen.
- Quote paper
- MA David Ortmann (Author), 2007, Der Film Noir. Inhaltliche Parallelen von Stanley Kubricks "The Killing" und John Hustons "The Asphalt Jungle", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426676