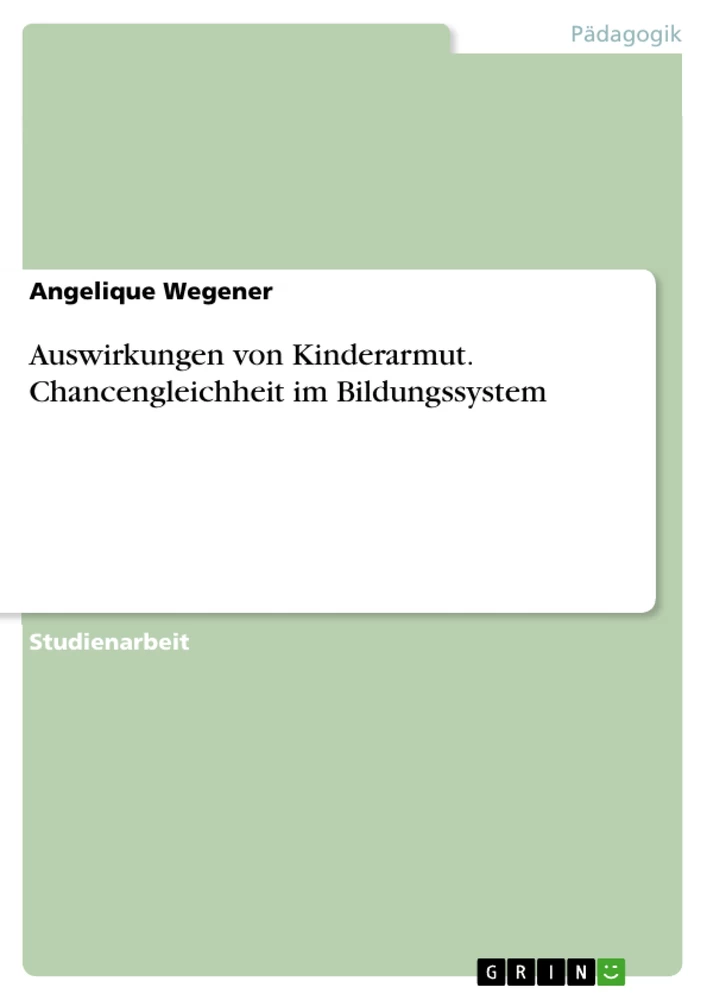Über viele Jahre hinweg, fand die Armutslage der Kinder und Jugendlichen und die daraus resultierenden Folgen in der Politik und Gesellschaft wenig Beachtung. Vielmehr wurde es mal beiläufig im Bereich Familienarmut erwähnt oder gar verleugnet. Es gab keine Kinderarmut in einer starken und konsumreichen Gesellschaft wie Deutschland. Das Verleumden führte dennoch nicht dazu, dass die Armut der Kinder und Jugendlichen sich in Deutschland verbessert. Es trat eher das Gegenteil auf.
In den letzten Jahren stieg die Zahl der Kinder- und Jugendlichen, welche in prekären Familienverhältnissen aufwachsen deutlich an. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter den Armutsverhältnissen der Eltern und können gegen ihre Lebenslage nicht unternehmen. Sie sind darauf angewiesen, dass sich in der Gesellschaft etwas tut, dass die Menschen auf sie aufmerksam werden und dass die Politik endlich Gegenmaßnahmen beschließt.
Folglich stellt sich die Frage, welche kurzfristigen, sowie langfristigen Auswirkungen das Leben in Armutsverhältnisse für Kinder und Jugendliche hat. Ziel der vorliegenden Hausarbeit ist es, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und zudem mögliche Bekämpfungsmethoden vorzustellen. Die Hausarbeit setzt vier Schwerpunkte. Im ersten und zweiten Teil werden zunächst die hier zugrunde gelegte Definition des Armutsbegriffs, sowie die möglichen Ursachen für Kinderarmut in Deutschland vorgestellt. Nach kurzer Annährung an das Thema, werden im dritten und vierten Teil die Folgen von Kinderarmut und mögliche Bekämpfungsmethoden erläutert. Die Hausarbeit schließt mit einem persönlichen Fazit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Definitionen
- 1. Armut
- 2. Kindheit und Kinderarmut
- 3. Chancengleichheit
- 4. Bildungsteilhabe
- 5. Entwicklung der Armutslage in Deutschland
- II. Risikogruppen für Kinderarmut
- III. Folgen von Armut
- 1. Gesundheitliche Folgen
- 2. Fehlende Teilhabemöglichkeiten
- 3. Bildungschancen
- IV. Bekämpfungsmethoden
- B. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Kinderarmut in Deutschland. Ziel ist es, die Folgen dieser Armutsverhältnisse für Kinder und Jugendliche zu analysieren und mögliche Bekämpfungsmethoden aufzuzeigen. Dabei werden die Definition des Armutsbegriffs und die Ursachen für Kinderarmut in Deutschland beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt auf den Folgen von Kinderarmut in den Bereichen Gesundheit, Teilhabemöglichkeiten und Bildungschancen. Abschließend werden verschiedene Ansätze zur Bekämpfung von Kinderarmut vorgestellt.
- Definition des Armutsbegriffs und Arten von Armut
- Ursachen für Kinderarmut in Deutschland
- Gesundheitliche Folgen von Kinderarmut
- Eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten von Kindern in Armut
- Bildungschancen von Kindern aus armutsbetroffenen Familien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problematik der Kinderarmut in Deutschland dar und betont die wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen, die in prekären Familienverhältnissen aufwachsen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Auswirkungen von Kinderarmut auf die Lebenslagen betroffener Kinder und Jugendliche zu untersuchen und mögliche Bekämpfungsmethoden aufzuzeigen. Die Hausarbeit gliedert sich in vier Schwerpunkte: Definition des Armutsbegriffs, Ursachen für Kinderarmut, Folgen von Kinderarmut und Bekämpfungsmethoden.
I. Definitionen
1. Armut
Der Abschnitt beleuchtet den komplexen Armutsbegriff und unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Während absolute Armut durch Mangel an lebensnotwendigen Ressourcen charakterisiert ist, wird relative Armut anhand des Wohlstands der jeweiligen Gesellschaft gemessen. In Deutschland wird von relativer Armut ausgegangen, wobei Haushalte als arm gelten, deren Einkommen weniger als 60% des bedarfsgewichteten mittleren Nettoeinkommens beträgt.
2. Kindheit und Kinderarmut
Dieser Abschnitt betrachtet die Definition von Kindheit und Kinderarmut. Kinder gelten als arm, wenn ihre Familien materielle Not leiden oder Transferleistungen beziehen. Darüber hinaus muss eine Unterversorgung in den vier Lebensdimensionen eines Kindes (materielle Versorgung, kulturelle Versorgung, soziale Kontakte und gesundheitliche Situation) vorliegen.
3. Chancengleichheit
Der Abschnitt betont die Bedeutung von Chancengleichheit für alle Menschen, unabhängig von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund. Es werden die entsprechenden Artikel im Grundgesetz zitiert und die Ergebnisse des Chancenspiegels der Bertelsmann-Stiftung dargestellt, welche auf Defizite im deutschen Bildungssystem hinsichtlich Chancengleichheit hinweisen.
4. Bildungsteilhabe
Dieser Abschnitt erklärt den Begriff der Bildungsteilhabe und betont den Rechtsanspruch auf Teilhabe und Bildungsförderung für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Es werden die entsprechenden Paragraphen im SGB II und SGB XII genannt, die die Leistungen zur Teilhabe und Bildungsförderung regeln.
II. Risikogruppen für Kinderarmut
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Risikogruppen für Kinderarmut in Deutschland. Er untersucht die verschiedenen Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in Armut aufzuwachsen.
III. Folgen von Armut
1. Gesundheitliche Folgen
Dieser Abschnitt beleuchtet die negativen Auswirkungen von Kinderarmut auf die Gesundheit. Er analysiert die Zusammenhänge zwischen Armut und körperlicher und psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
2. Fehlende Teilhabemöglichkeiten
Dieser Abschnitt untersucht, wie Kinderarmut die Teilhabemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen am sozialen und kulturellen Leben einschränkt. Er analysiert die Folgen für die soziale Integration und Entwicklung von Kindern in Armut.
3. Bildungschancen
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Kinderarmut auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen. Er analysiert die Folgen für den schulischen Erfolg und die Berufswahl von Kindern aus armutsbetroffenen Familien.
IV. Bekämpfungsmethoden
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Ansätze zur Bekämpfung von Kinderarmut vor. Er diskutiert die Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen und Politiken, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen von Kindern in Armut zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der vorliegenden Hausarbeit sind Kinderarmut, Armut, Chancengleichheit, Bildungsteilhabe, soziale Ungleichheit, Bildungschancen, Gesundheit, Teilhabemöglichkeiten, Risikofaktoren, Bekämpfungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Armut in Deutschland definiert?
In Deutschland wird meist von relativer Armut gesprochen. Haushalte gelten als armutsgefährdet, wenn ihr Einkommen weniger als 60 % des mittleren Nettoeinkommens der Bevölkerung beträgt.
Was sind die Folgen von Kinderarmut für die Gesundheit?
Kinder in Armut leiden häufiger unter gesundheitlichen Einschränkungen, sowohl körperlicher als auch psychischer Natur, bedingt durch schlechtere Ernährung, Wohnverhältnisse und Stress.
Wie beeinflusst Armut die Bildungschancen?
Armut schränkt die Bildungsteilhabe massiv ein. Kinder aus armutsbetroffenen Familien haben statistisch gesehen geringere Chancen auf höhere Bildungsabschlüsse und beruflichen Erfolg.
Was bedeutet "Bildungsteilhabe"?
Bildungsteilhabe beschreibt den Rechtsanspruch auf Zugang zu Bildungsförderung und sozialen Aktivitäten, der gesetzlich im SGB II und SGB XII verankert ist, um Benachteiligungen auszugleichen.
Welche Risikogruppen gibt es für Kinderarmut?
Besonders gefährdet sind Kinder von Alleinerziehenden, Kinder aus kinderreichen Familien sowie Kinder in Familien mit Migrationshintergrund oder Arbeitslosigkeit der Eltern.
- Quote paper
- Angelique Wegener (Author), 2017, Auswirkungen von Kinderarmut. Chancengleichheit im Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426800