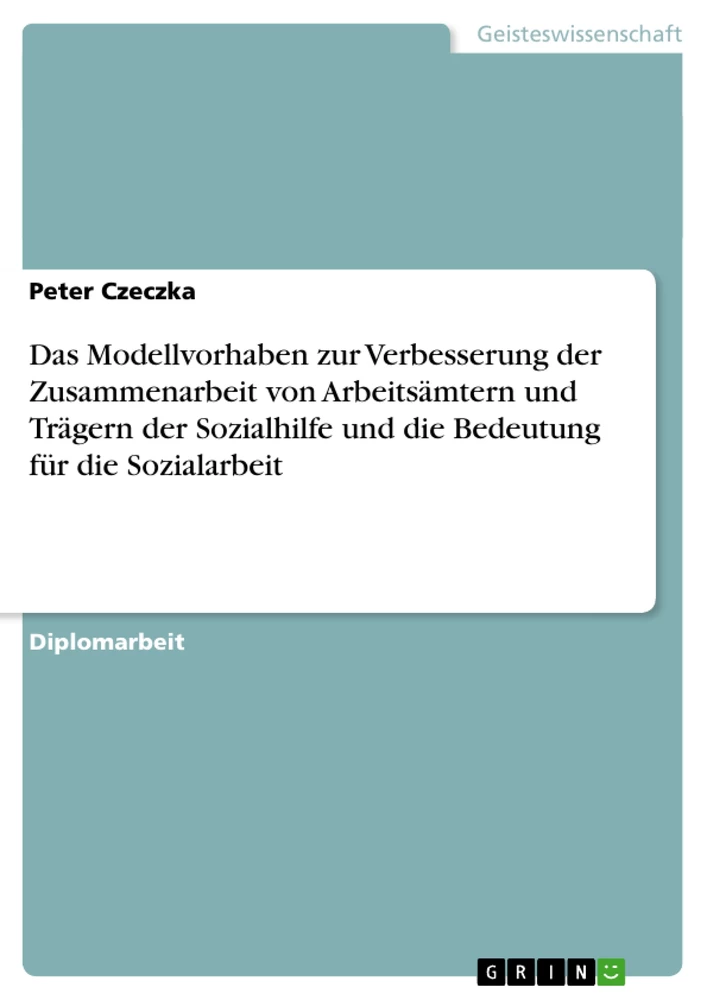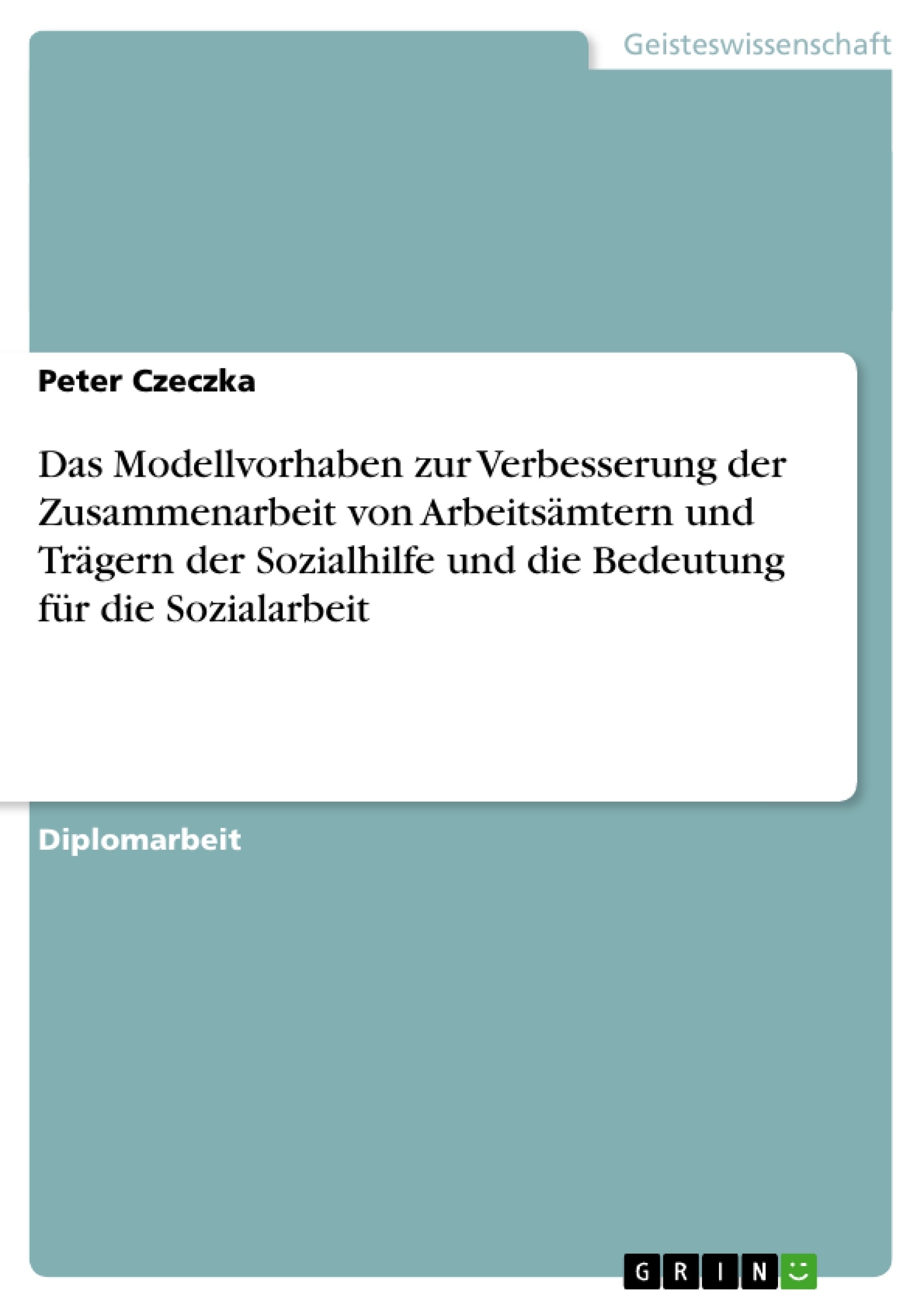Während in der BRD bis Mitte der 1970er Jahre weitgehend Vollbeschäftigung herrschte, nahm die Zahl der Arbeitslosen seitdem stetig zu. Anfang der 1980er Jahre wurde erstmals die Grenze von zwei Millionen Arbeitslosen überschritten. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung und eines gleichzeitigen Rückgangs des Wirtschaftswachstums erreichte die Erwerbslosenquote in den 1990er Jahren ein bis dahin unbekanntes Niveau. Das Phänomen der Massenarbeitslosigkeit ist seitdem eines der wichtigsten Themen der bundesdeutschen Innenpolitik. Laut einer im Juni 2004 veröffentlichten Studie der Gesellschaft für Konsumforschung halten 77% aller Deutschen die Arbeitslosigkeit für das dringlichste Problem in Deutschland.
In seiner Neujahrsansprache vom 31. Dezember 1998 formulierte der neu gewählte Bundeskanzler Gerhard Schröder als „wichtigstes Ziel“ der künftigen Politik der Koalition aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen den „Abbau der Arbeitslosigkeit“. Bis 2005, so der Regierungschef, solle die Arbeitslosigkeit halbiert werden.
Um sowohl die Zahl der Arbeitslosen – 4,4 Mio. im April 2004 - als auch die wachsende Zahl der erwerbslosen SozialhilfeempfängerInnen zu verringern und damit die von den sozialen Sicherungssystemen getragenen Folgekosten der Arbeitslosigkeit zu senken, wurden bzw. werden zahlreiche Reformen und Maßnahmen diskutiert und zum Teil bereits umgesetzt. Die unterschiedlichen Ansätze, die auf verschiedenen Ebenen (bundesweit, landesweit, regional, lokal) zu unterschiedlichen Zeitpunkten – und in der Regel ohne erkennbare Koordinierung - erprobt und praktiziert werden, verbindet die gemeinsame Zielsetzung einer besseren und schnelleren Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Als ein Beispiel sei an dieser Stelle das Gesetz zur Reform der arbeitsmarkpolitischen Instrumente (Job- AQTIV- Gesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2002) genannt, das Handlungsansätze wie Profiling, Assessment und Eingliederungsvereinbarungen verankert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die bisherigen sozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik Deutschland
- Entstehung und Entwicklung des Sozialstaates
- Die Lohnersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit: Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe
- Die Sozialhilfe
- Die Problematik der Doppelstruktur von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
- Das Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe (MoZArT)
- Rechtliche Grundlagen und Zielsetzung
- Die Auswahl der Projekte und ihre Kategorisierung
- Die Durchführung der Modellvorhaben anhand ausgewählter Beispiele
- Evaluation und Ergebnisse
- Die Vorschläge der Kommission "Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" zu Job-Centern und Arbeitslosengeld II und deren Umsetzung
- Die Job Center
- Das Arbeitslosengeld II
- Die Kritik an den beschlossenen Reformen
- Die aktuelle Diskussion zur Umsetzung von Hartz IV
- Die Bedeutung der Sozialarbeit in den künftigen Job-Centern
- Case Management als Arbeitsmethode in den Job-Centern
- Sozialarbeit im Rahmen von MOZART
- Mögliche Perspektiven sozialer Arbeit in den Job-Centern
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Reform des deutschen Sozialversicherungssystems mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen dem Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe (MoZArT) und der Einführung von Job-Centern sowie Arbeitslosengeld II aufzuzeigen. Dabei werden die Entstehung und Entwicklung des deutschen Sozialstaates sowie die Problematik der Doppelstruktur von Arbeitslosen- und Sozialhilfe beleuchtet. Zudem werden die rechtlichen Grundlagen und Ziele von MoZArT, die Durchführung ausgewählter Projekte und die Evaluation der Ergebnisse dargestellt. Weiterhin werden die Vorschläge der Hartz-Kommission zu Job-Centern und Arbeitslosengeld II sowie die Kritik an diesen Reformen untersucht. Abschließend wird die Bedeutung der Sozialarbeit in den künftigen Job-Centern unter Berücksichtigung des Case Managements und der Perspektiven sozialer Arbeit im Rahmen von MOZArT diskutiert.
- Die Reform des deutschen Sozialversicherungssystems
- Das Modellvorhaben MoZArT
- Die Einführung von Job-Centern und Arbeitslosengeld II
- Die Bedeutung der Sozialarbeit im Kontext der Reformen
- Das Case Management als Arbeitsmethode
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des deutschen Sozialstaates sowie den bestehenden Transferleistungen Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Die Problematik der Doppelstruktur von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wird ebenfalls beleuchtet. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf das Modellvorhaben MoZArT und beleuchtet dessen rechtliche Grundlagen und Zielsetzung. Des Weiteren werden ausgewählte Projekte und die durch Evaluation erzielten Ergebnisse beschrieben. Im dritten Kapitel werden die Vorschläge der Hartz-Kommission zu Job-Centern und Arbeitslosengeld II sowie die Kritik an den beschlossenen Reformen untersucht. Zudem werden die Unterschiede zwischen dem bisherigen und dem zukünftigen sozialen Sicherungssystem aufgezeigt. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Bedeutung und Rolle der Sozialarbeit in den geplanten Job-Centern. Die Methode des Case Managements wird näher erläutert und es wird untersucht, ob und in welcher Form SozialarbeiterInnen/ SozialpädagogInnen an den Reformen beteiligt sein können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem deutschen Sozialstaat, der Arbeitslosenhilfe, der Sozialhilfe, dem Modellvorhaben MoZArT, Job-Centern, Arbeitslosengeld II, Case Management und der Rolle der Sozialarbeit im Kontext der Reformen. Die Arbeit analysiert die Reform des deutschen Sozialversicherungssystems und die Bedeutung der Sozialarbeit in den künftigen Job-Centern.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Modellvorhabens MoZArT?
Das Ziel war die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsämtern und Sozialhilfeträgern, um die Doppelstrukturen abzubauen und Arbeitslose sowie Sozialhilfeempfänger schneller in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Was ist die „Doppelstruktur“ von Arbeitslosen- und Sozialhilfe?
Vor den Hartz-Reformen gab es zwei getrennte Systeme für Bedürftige: die Arbeitslosenhilfe (beim Arbeitsamt) und die Sozialhilfe (beim Sozialamt). Dies führte oft zu unklaren Zuständigkeiten und ineffizienter Betreuung.
Welche Rolle spielt Case Management in den Job-Centern?
Case Management ist eine Arbeitsmethode, bei der eine individuelle, ganzheitliche Betreuung der Klienten stattfindet. Es dient dazu, komplexe Problemlagen zu koordinieren und die berufliche Eingliederung zu unterstützen.
Was sind die zentralen Punkte der Hartz-IV-Reform?
Zentrale Punkte waren die Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II (Hartz IV) sowie die Einrichtung von Job-Centern als zentrale Anlaufstellen.
Welche Bedeutung hat Sozialarbeit im Kontext dieser Reformen?
Sozialarbeit gewinnt an Bedeutung, da viele Erwerbslose multiple Vermittlungshemmnisse haben, die über rein berufliche Qualifikationen hinausgehen und eine sozialpädagogische Unterstützung erfordern.
- Citar trabajo
- Peter Czeczka (Autor), 2004, Das Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsämtern und Trägern der Sozialhilfe und die Bedeutung für die Sozialarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42685