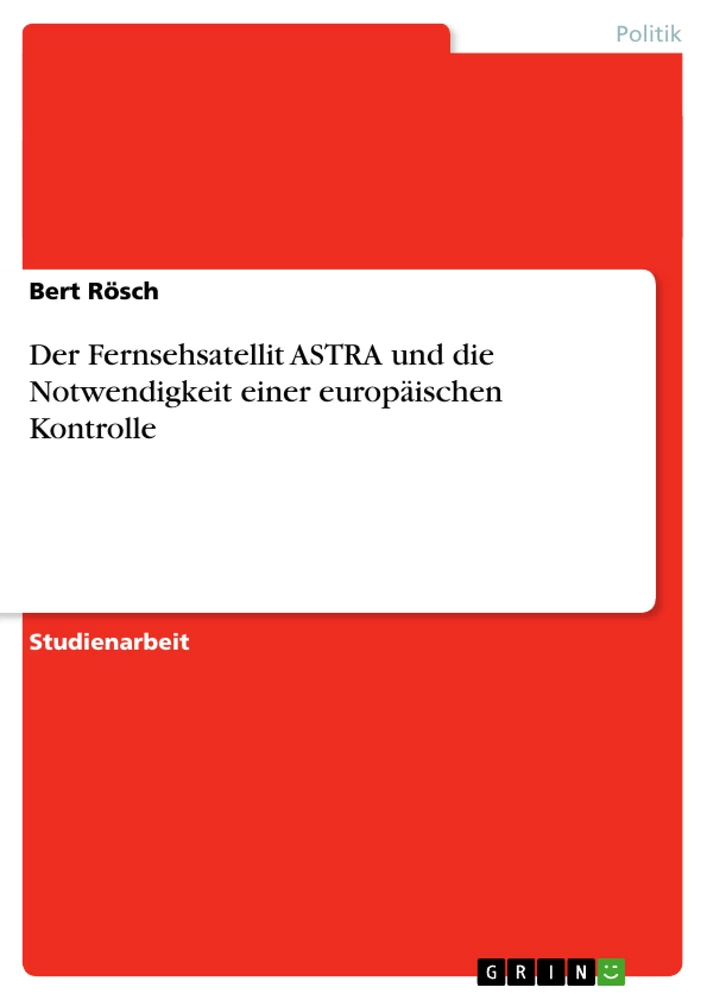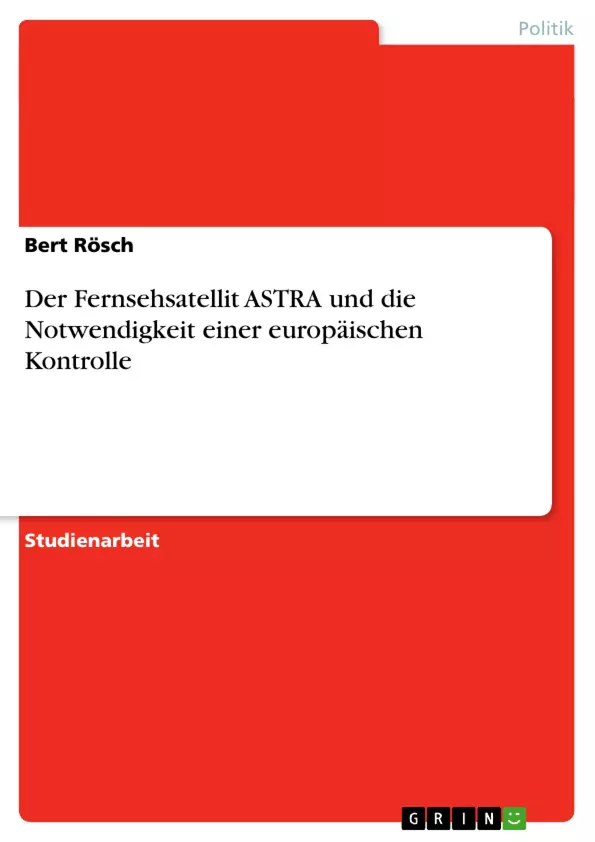Gut acht Jahre nach seinem Start hat sich der private Fernsehsatellit Astra zum alleinigen Marktführer in Europa entwickelt. 21,73 Millionen europäische Haushalte haben ihre Empfangsanlagen, sogenannte Satellitenschüsseln, auf den luxemburgischen Himmels¬körper ausgerichtet. Dies sind 90 Prozent aller europäischen Satellitenhaushalte. In Deutschland empfangen 1,21 Millionen Haushalte ihre Programme über Astra. Dazu kommen 15,4 Millionen deutsche Haushalte, bei denen die Astra-Programme ins Kabel¬netz eingespeist sind.
Der von dem privaten luxemburgischen Konsortium Societé Européenne des Satellites (SES) betriebene Satellit hat damit ein Quasi-Monopol in der Fernsehausstrahlung über Satellit inne. Umso verwunderlicher ist es, wenn man betrachtet, wer diesen privaten Monopolisten beaufsichtigt: Die Kontrolle, die vom luxemburgischen Staat ausgeübt wird, ist fast nur formaler Art. Schließlich ist Luxemburg als Anteilseigner vorrangig an einem wirtschaftlichem Erfolg des Unternehmens interessiert. Auch von den europä¬ischen Institutionen (Europäische Union und Europarat) gingen bisher keine gesetzgeberischen Maßnahmen aus, die eine effektive Aufsicht gewährleisten könnten. Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage auf, wie es möglich war, daß sich Astra bisher jeglicher Kontrolle entziehen konnte bzw. warum es die europäischen Institutionen nicht geschafft haben, dieses neue Medium zu regulieren, zumal die Meinungsvielfalt in Europa ob der dubiosen Transpondervergabe-Politik des Betreibers immer mehr gefährdet ist. Schließlich entwickelt sich das Medium Satellit immer mehr zum Standardversorger für Fernsehprogramme, da die Preis- und Programmvorteile der Satelliten das Kabel immer mehr verdrängen.
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Zudem soll erläutert werden, wie eine Kontrolle der Satellitenbetreiber aussehen könnte und wie wirksam sie wäre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Astras Weg zum Monopol
- Die Gründungsgeschichte
- Eutelsats Verhinderungspolitik
- Die Transpondervergabepolitik
- Zusammenfassung und Notwendigkeit einer Kontrolle
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Satellitenfernsehens
- Die Regelungen bis zur Fernsehrichtlinie: Freier Informationsfluß versus staatliche Souveräntität
- Die Fernsehrichtlinie und die Europaratskonvention
- Bewertung der Richtlinie
- Die kulturpolitische Kompetenz im Maastricher Vertrag
- Die Fernsehnorm MAC
- Chancen einer europäischen Medienaufsicht
- Die Rundfunkfreiheit
- Die Gestaltungsmodelle des Rundfunks
- Vor- und Nachteile einer europäischen Medienaufsicht
- Ansätze einer europäischen Medienaufsicht
- Der aktuelle Stand einer europäischen Medienaufsicht
- Zusammenfassung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Fernsehsatelliten Astra zum Quasi-Monopol in Europa und untersucht die Notwendigkeit einer europäischen Kontrolle des Unternehmens. Ziel ist es, die Hintergründe für die fehlende Aufsicht über Astra aufzuzeigen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beleuchten und die Chancen einer europäischen Medienaufsicht zu evaluieren.
- Die Entwicklung des privaten Fernsehsatelliten Astra zum Marktführer in Europa
- Die Rolle des luxemburgischen Staates als Anteilseigner und seine Aufsichtsfunktion
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Satellitenfernsehens in Europa, insbesondere die Fernsehrichtlinie
- Die Chancen und Herausforderungen einer europäischen Medienaufsicht
- Der aktuelle Stand der Debatte über eine europäische Kontrolle von Satellitenanbietern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Geschichte von Astra und beschreibt, wie es durch die Überwindung von Widerständen, insbesondere der französischen Regierung, zum Marktführer wurde. Die umstrittene Transpondervergabepolitik wird als wichtiger Aspekt für die Notwendigkeit einer Kontrolle hervorgehoben.
Das zweite Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen des Satellitenfernsehens, wobei die Fernsehrichtlinie der Europäischen Kommission als zentrales Element betrachtet wird. Es werden die Grenzen der europäischen Gesetzgebung in Bezug auf die Satellitenkontrolle sowie das Interesse der EU an Deregulierung des Rundfunkmarktes diskutiert.
Das dritte Kapitel untersucht die Realisierungsmöglichkeiten einer europäischen Medienaufsicht. Hier werden das Pluralismus-Konzept, die verschiedenen Modelle der medienpolitischen Gestaltung und die Vor- und Nachteile einer Medienkontrolle analysiert.
Schlüsselwörter
Fernsehsatellit, Astra, Monopol, Medienaufsicht, europäische Medienpolitik, Fernsehrichtlinie, Rundfunkfreiheit, Pluralismus, Transpondervergabe, Satellitenkontrolle, Luxemburger Staat, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Wie erreichte der Satellit Astra seine Monopolstellung in Europa?
Durch die Überwindung staatlicher Widerstände und eine gezielte Transpondervergabepolitik wurde Astra zum Standardversorger für rund 90 Prozent der europäischen Satellitenhaushalte.
Warum wird die mangelnde Kontrolle über Astra kritisiert?
Die Aufsicht durch den luxemburgischen Staat gilt als rein formal, da Luxemburg als Anteilseigner primär an wirtschaftlichem Erfolg interessiert ist.
Was ist die EU-Fernsehrichtlinie?
Die Fernsehrichtlinie ist ein zentrales rechtliches Instrument der EU, das jedoch bisher keine effektive Aufsicht über private Satellitenmonopolisten sicherstellen konnte.
Welche Gefahr besteht für die Meinungsvielfalt?
Durch die dubiose Transpondervergabe-Politik eines privaten Monopolisten könnte der freie Zugang zu Informationen und die Vielfalt der Programme gefährdet werden.
Welche Modelle für eine europäische Medienaufsicht werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Gestaltungsmodelle, die auf dem Pluralismus-Konzept basieren und eine staatenübergreifende Kontrolle ermöglichen könnten.
- Quote paper
- Bert Rösch (Author), 1996, Der Fernsehsatellit ASTRA und die Notwendigkeit einer europäischen Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42688